Das Böse ist das Normale
Als literarisches Jahrhundertwerk wurde das Original "Les Bienveillantes" in Frankreich gefeiert. Dieser Roman, der nun auf Deutsch erscheint, enthält neben langen grauen Passagen poetische Schönheit und auch großen Schwulst. Jonathan Littell entpolitisiert den Nationalsozialismus und zeichnet Mord und Grausamkeit als menschliche Konstanten.
Am Ende hockt SS-Obersturmbannführer Max Aue im zerstörten Berliner Zoo neben einem sterbenden Flusspferd. Der Krieg ist verloren, der Massenmord ausgeführt, die Schimpansen machen sich aus dem Staub. Mit diesem unwirklichen Bild endet, nach monströsen 1384 Seiten, der Roman "Die Wohlgesinnten" von Jonathan Littell.
Man muss sich, um ans Ende zu gelangen, durch andere Bilder kämpfen: das frisch geborene Baby, dessen Kopf am Ofen zerschmettert wird, die Leichenberge beim Massaker von Babi Jar. Die Autobiografie des promovierten Juristen Max Aue, der nichts bereut, ist eine Zumutung. Aue kündigt an, zu erzählen, "wie es gewesen ist", als ob wir selbst nichts wüssten vom "Dritten Reich". Und doch hat er Recht: Einen solchen Ich-Erzähler, der so schamlos auf seine furchtbaren Kriegserlebnisse zurückblickt, hat es vermutlich noch nie gegeben.
Als literarisches Jahrhundertwerk wurde "Les Bienveillantes" in Frankreich gefeiert. Das ist es nicht. Dieser Roman enthält neben langen grauen Passagen poetische Schönheit und großen Schwulst. Vor allem aber ist Littells Hauptfigur merkwürdig flach, eine Schablone, sowohl über- wie unterpsychologisiert. Mal ist er tragischer Muttermörder, mal blasser Bürokrat und keines der Teile ergibt eine Figur.
Ein Skandal ist der Roman gleichwohl, weil Littell es wagt, völlig unbefangen die Täter zu Wort kommen zu lassen. Moral interessiert ihn nicht. Der amerikanisch-französische Jude Littell liefert den Anti-Goldhagen, die Widerlegung der These, dass sich im Massenmord an den Juden etwas spezifisch Deutsches manifestiert habe. Für Littell ist jeder ein Deutscher, das sagt er in seinen vielen Interviews. Und sein Protagonist, der Mörder Max Aue, ruft dem Leser schon auf den ersten Seiten die provozierenden Sätze zu:
"Ich bin schuldig, ihr seid es nicht, wie schön für euch. Trotzdem könnt ihr euch sagen, dass ihr das, was ich getan habe, genauso hättet tun können. Vielleicht mit weniger Eifer, dafür möglicherweise auch mit weniger Verzweiflung, jedenfalls aber auf die eine oder andere Art. Die moderne Geschichte hat, denke ich, hinreichend bewiesen, dass jeder Mensch, oder fast jeder, unter gewissen Voraussetzungen das tut, was man ihm sagt."
Littell entpolitisiert den Nationalsozialismus. Mord und Grausamkeiten, das ist der skandalöse Befund Littells, sind legitime menschliche Konstanten. Das Böse ist das Normale. Deshalb schildert er nicht Gesellschaft und Politik, sondern jenen biografischen und intellektuellen Doppel-Sog, der den jungen Max Aue in den Nationalsozialismus hineinzieht und ihn an den Rand der Massengräber in der Ukraine führt.
Da ist eine unglückliche Jugend, der deutsche Vater, der den Achtjährigen über Nacht verlässt, der Hass auf die französische Mutter, die unglückliche inzestuöse Beziehung zu seiner Zwillingsschwester. In dem, was Aue als echte nationale Revolution in seinem Vaterland deutet, als endgültigen Bruch mit der Vergangenheit, erkennt er sich schließlich wieder:
"Im Grunde ist das kollektive Problem der Deutschen das gleiche wie meines; auch sie sind bemüht, sich von einer schmerzlichen Vergangenheit zu befreien, reinen Tisch zu machen, um ganz neu anfangen zu können. So sind sie auf die radikalste aller Lösungen verfallen, den Mord, den grausigen Schrecken des Mordes. Aber war der Mord eine Lösung?"
Der junge Aue ist zugleich ein kultivierter Intellektueller, ein gebildeter Humanist, der sich mit den Einheimischen im Kaukasus auf Altgriechisch unterhält. In Paris kommt er schon früh in Kontakt mit den französischen Protofaschisten und fühlt sich angezogen von der Radikalität des Faschismus. Schon als Kind treibt ihn "der leidenschaftliche Wunsch nach dem Absoluten und nach Grenzüberschreitung". Für ihn ist der Nationalsozialismus weniger politische Anschauung, als vielmehr eine harte, ästhetische Lebensform. Hier erscheint der Faschismus als Wahn, aber eben auch als Haltung, aus der es kein Entrinnen gibt. Beides, das Unverwurzelte und die Sehnsucht nach dem radikalen Leben, lassen Aue einer jungen Jüdin in der Ukraine eine Kugel in den Kopf schießen, dass ihr Kopf platzt wie "eine überreife Frucht".
Littell führt eine postmoderne Anthropologie vor: Alles ist möglich, nichts zählt. Der Roman ist ein Angriff auf den Versuch, den Nationalsozialismus, im Großen und Ganzen – also theoretisch - verstehen zu wollen. Littell hat sich auf diesen Angriff gut vorbereitet: Er hat sie alle gelesen, die Hillbergs und Brownings, die Fests und die Kershaws, und mit ihnen polstert er nun seinen Roman aus. "Alles stimmt. Die Namen der Leute, der Orte", sagt Claude Lanzmann, der Regisseur von "Shoah". Und dass man diesen Roman doch weiter liest, liegt an seiner faszinierenden Genauigkeit. Die Präzision, mit der der nicht einmal 40-jährige Littell Fakten und Fiktion verwebt, ist pedantisch und zugleich elegant. Das Authentische ist furchtbar und faszinierend, und das ist die Ambivalenz, die den Leser bis zum Ende nicht loslässt.
Littell schickt seinen Protagonisten mit den Einsatzgruppen in die Ukraine, nach Südrussland und den Kaukasus und nach Stalingrad. Später wird Aue persönlicher "Sonderbeauftragter des Reichsführers SS für den Arbeitseinsatz". Er ist ein Logistiker, dem an Auschwitz die Unordnung missfällt, nicht das Töten. Mitten im Morden kämpft er für Professionalität.
Doch seine Tätigkeit in der Vernichtungsbürokratie Heinrich Himmlers ist bald kaum mehr als ein Vorwand, um die Besetzungsliste dieses Theaters der Grausamkeiten abzuarbeiten. Littells SS-Mann diskutiert mit Adolf Eichmann Kants "Kritik der praktischen Vernunft", er geht mit Speer auf die Jagd, in Auschwitz steht er an der Rampe und plaudert mit Mengele, in Posen sitzt er bei Himmlers berühmter Rede im Publikum. "Je suis partout", "Ich bin überall", nannte sich die Zeitung der radikalen Rechten in Frankreich, und so ergeht es auch Aue. Er ist überall, er trifft sie alle – und verliert in diesem Milieu seine Konturen. Er wird erzählerisches Mittel zum Zweck.
Das Buch, das als Perversion eines Bildungsromans beginnt, gerät schließlich zu einem surrealen Schelmenroman. Littell reiht kaleidoskopisch Bilder aneinander, die Charakterbildung seines jungen Helden interessiert ihn nie wirklich. In dieser ewigen Wiederkehr des Gleichen ist Entwicklung nicht möglich. Dafür taucht Max Aue in jedem Bild, das wir vom "Dritten Reich" haben, irgendwann auf. Als er in den letzten Kriegstagen im Führerbunker Adolf Hitler in die Nase beißt, gibt er sich schließlich als das zu erkennen, was er in Wahrheit immer gewesen ist: ein Schwejk des Zweiten Weltkrieges, der Forrest Gump des deutschen Faschismus, die Katze zur jüdischen "Maus" aus dem Holocaust-Comic Art Spiegelmans.
Diese unpolitische, an Moral uninteressierte Bilderflut verändert unsere Sicht auf den Nationalsozialismus wohl kaum. Sie macht aber deutlich, dass unsere Sicht eine Frage der Wahrnehmung ist. In diesem Sinne markiert "Die Wohlgesinnten" einen weiteren Historisierungsschub jener furchtbaren Epoche. Nun ist auch der nationalsozialistische Täter in der Gegenwart angekommen, in der alles möglich ist.
Max Aue überlebt den Krieg und setzt sich nach Frankreich ab. Doch die antiken Rachegöttinnen, die "Wohlgesinnten", spüren ihn auch dort auf. Es ist wohl ironisch in einem sonst humorfreien Buch, dass Nietzsches schwuler Übermensch in SS-Uniform von einst nun in konventioneller Bürgerlichkeit lebt, als Ehemann, Vater und Fabrikant von Spitzenwäsche.
Jonathan Littell: Die Wohlgesinnten
Aus dem Französischen von Hainer Kober
Berlin Verlag, 2008
Man muss sich, um ans Ende zu gelangen, durch andere Bilder kämpfen: das frisch geborene Baby, dessen Kopf am Ofen zerschmettert wird, die Leichenberge beim Massaker von Babi Jar. Die Autobiografie des promovierten Juristen Max Aue, der nichts bereut, ist eine Zumutung. Aue kündigt an, zu erzählen, "wie es gewesen ist", als ob wir selbst nichts wüssten vom "Dritten Reich". Und doch hat er Recht: Einen solchen Ich-Erzähler, der so schamlos auf seine furchtbaren Kriegserlebnisse zurückblickt, hat es vermutlich noch nie gegeben.
Als literarisches Jahrhundertwerk wurde "Les Bienveillantes" in Frankreich gefeiert. Das ist es nicht. Dieser Roman enthält neben langen grauen Passagen poetische Schönheit und großen Schwulst. Vor allem aber ist Littells Hauptfigur merkwürdig flach, eine Schablone, sowohl über- wie unterpsychologisiert. Mal ist er tragischer Muttermörder, mal blasser Bürokrat und keines der Teile ergibt eine Figur.
Ein Skandal ist der Roman gleichwohl, weil Littell es wagt, völlig unbefangen die Täter zu Wort kommen zu lassen. Moral interessiert ihn nicht. Der amerikanisch-französische Jude Littell liefert den Anti-Goldhagen, die Widerlegung der These, dass sich im Massenmord an den Juden etwas spezifisch Deutsches manifestiert habe. Für Littell ist jeder ein Deutscher, das sagt er in seinen vielen Interviews. Und sein Protagonist, der Mörder Max Aue, ruft dem Leser schon auf den ersten Seiten die provozierenden Sätze zu:
"Ich bin schuldig, ihr seid es nicht, wie schön für euch. Trotzdem könnt ihr euch sagen, dass ihr das, was ich getan habe, genauso hättet tun können. Vielleicht mit weniger Eifer, dafür möglicherweise auch mit weniger Verzweiflung, jedenfalls aber auf die eine oder andere Art. Die moderne Geschichte hat, denke ich, hinreichend bewiesen, dass jeder Mensch, oder fast jeder, unter gewissen Voraussetzungen das tut, was man ihm sagt."
Littell entpolitisiert den Nationalsozialismus. Mord und Grausamkeiten, das ist der skandalöse Befund Littells, sind legitime menschliche Konstanten. Das Böse ist das Normale. Deshalb schildert er nicht Gesellschaft und Politik, sondern jenen biografischen und intellektuellen Doppel-Sog, der den jungen Max Aue in den Nationalsozialismus hineinzieht und ihn an den Rand der Massengräber in der Ukraine führt.
Da ist eine unglückliche Jugend, der deutsche Vater, der den Achtjährigen über Nacht verlässt, der Hass auf die französische Mutter, die unglückliche inzestuöse Beziehung zu seiner Zwillingsschwester. In dem, was Aue als echte nationale Revolution in seinem Vaterland deutet, als endgültigen Bruch mit der Vergangenheit, erkennt er sich schließlich wieder:
"Im Grunde ist das kollektive Problem der Deutschen das gleiche wie meines; auch sie sind bemüht, sich von einer schmerzlichen Vergangenheit zu befreien, reinen Tisch zu machen, um ganz neu anfangen zu können. So sind sie auf die radikalste aller Lösungen verfallen, den Mord, den grausigen Schrecken des Mordes. Aber war der Mord eine Lösung?"
Der junge Aue ist zugleich ein kultivierter Intellektueller, ein gebildeter Humanist, der sich mit den Einheimischen im Kaukasus auf Altgriechisch unterhält. In Paris kommt er schon früh in Kontakt mit den französischen Protofaschisten und fühlt sich angezogen von der Radikalität des Faschismus. Schon als Kind treibt ihn "der leidenschaftliche Wunsch nach dem Absoluten und nach Grenzüberschreitung". Für ihn ist der Nationalsozialismus weniger politische Anschauung, als vielmehr eine harte, ästhetische Lebensform. Hier erscheint der Faschismus als Wahn, aber eben auch als Haltung, aus der es kein Entrinnen gibt. Beides, das Unverwurzelte und die Sehnsucht nach dem radikalen Leben, lassen Aue einer jungen Jüdin in der Ukraine eine Kugel in den Kopf schießen, dass ihr Kopf platzt wie "eine überreife Frucht".
Littell führt eine postmoderne Anthropologie vor: Alles ist möglich, nichts zählt. Der Roman ist ein Angriff auf den Versuch, den Nationalsozialismus, im Großen und Ganzen – also theoretisch - verstehen zu wollen. Littell hat sich auf diesen Angriff gut vorbereitet: Er hat sie alle gelesen, die Hillbergs und Brownings, die Fests und die Kershaws, und mit ihnen polstert er nun seinen Roman aus. "Alles stimmt. Die Namen der Leute, der Orte", sagt Claude Lanzmann, der Regisseur von "Shoah". Und dass man diesen Roman doch weiter liest, liegt an seiner faszinierenden Genauigkeit. Die Präzision, mit der der nicht einmal 40-jährige Littell Fakten und Fiktion verwebt, ist pedantisch und zugleich elegant. Das Authentische ist furchtbar und faszinierend, und das ist die Ambivalenz, die den Leser bis zum Ende nicht loslässt.
Littell schickt seinen Protagonisten mit den Einsatzgruppen in die Ukraine, nach Südrussland und den Kaukasus und nach Stalingrad. Später wird Aue persönlicher "Sonderbeauftragter des Reichsführers SS für den Arbeitseinsatz". Er ist ein Logistiker, dem an Auschwitz die Unordnung missfällt, nicht das Töten. Mitten im Morden kämpft er für Professionalität.
Doch seine Tätigkeit in der Vernichtungsbürokratie Heinrich Himmlers ist bald kaum mehr als ein Vorwand, um die Besetzungsliste dieses Theaters der Grausamkeiten abzuarbeiten. Littells SS-Mann diskutiert mit Adolf Eichmann Kants "Kritik der praktischen Vernunft", er geht mit Speer auf die Jagd, in Auschwitz steht er an der Rampe und plaudert mit Mengele, in Posen sitzt er bei Himmlers berühmter Rede im Publikum. "Je suis partout", "Ich bin überall", nannte sich die Zeitung der radikalen Rechten in Frankreich, und so ergeht es auch Aue. Er ist überall, er trifft sie alle – und verliert in diesem Milieu seine Konturen. Er wird erzählerisches Mittel zum Zweck.
Das Buch, das als Perversion eines Bildungsromans beginnt, gerät schließlich zu einem surrealen Schelmenroman. Littell reiht kaleidoskopisch Bilder aneinander, die Charakterbildung seines jungen Helden interessiert ihn nie wirklich. In dieser ewigen Wiederkehr des Gleichen ist Entwicklung nicht möglich. Dafür taucht Max Aue in jedem Bild, das wir vom "Dritten Reich" haben, irgendwann auf. Als er in den letzten Kriegstagen im Führerbunker Adolf Hitler in die Nase beißt, gibt er sich schließlich als das zu erkennen, was er in Wahrheit immer gewesen ist: ein Schwejk des Zweiten Weltkrieges, der Forrest Gump des deutschen Faschismus, die Katze zur jüdischen "Maus" aus dem Holocaust-Comic Art Spiegelmans.
Diese unpolitische, an Moral uninteressierte Bilderflut verändert unsere Sicht auf den Nationalsozialismus wohl kaum. Sie macht aber deutlich, dass unsere Sicht eine Frage der Wahrnehmung ist. In diesem Sinne markiert "Die Wohlgesinnten" einen weiteren Historisierungsschub jener furchtbaren Epoche. Nun ist auch der nationalsozialistische Täter in der Gegenwart angekommen, in der alles möglich ist.
Max Aue überlebt den Krieg und setzt sich nach Frankreich ab. Doch die antiken Rachegöttinnen, die "Wohlgesinnten", spüren ihn auch dort auf. Es ist wohl ironisch in einem sonst humorfreien Buch, dass Nietzsches schwuler Übermensch in SS-Uniform von einst nun in konventioneller Bürgerlichkeit lebt, als Ehemann, Vater und Fabrikant von Spitzenwäsche.
Jonathan Littell: Die Wohlgesinnten
Aus dem Französischen von Hainer Kober
Berlin Verlag, 2008
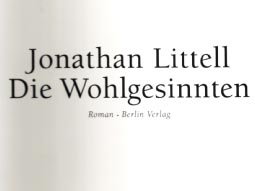
Jonathan Littell: Die Wohlgesinnten© Berlin Verlag
