Das Wirken einer Einheitspartei
Das Buch "Die SED" stellte die Geschichte der sozialistischen Partei dar. Dabei argumentieren Andreas Malycha, ein ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiters des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, und Peter Jochen Winters, ein früherer "FAZ"-Redakteur, in ihren Kapiteln über die Ära Ulbricht und Honeckers Macht weitgehend ähnlich.
Wenn ein ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED und ein ehemaliger Redakteur der "FAZ" gemeinsam ein Buch zur Geschichte der SED vorlegen, kommt Neugierde auf. Wächst hier zusammen, was zusammengehört? Oder wird dem Leser eine kontroverse Sicht auf die Geschichte dieser kommunistischen Partei geboten, die die Geschicke in der SBZ/DDR bestimmte?
Die Antwort fällt nach der mitunter ermüdenden Lektüre von 480 Seiten leicht: Die Autoren argumentieren in ihren Kapiteln weitgehend ähnlich: Andreas Malycha hat über die Ära Ulbricht, Peter Jochen Winters über die Ära Honecker geschrieben.
In ihrer Einführung behaupten die Autoren fälschlich, die Rolle der SED sei in Forschungen zur DDR bisher unterbelichtet. Das Gegenteil ist der Fall: In einer Vielzahl von Büchern wird das Wirken der SED anhand von Archivunterlagen und Zeitzeugenberichten detailliert nachgezeichnet. Darüber hinaus nimmt die SED bei Gesamtdarstellungen zur DDR eine herausragende Rolle ein. Neu ist nur der Anspruch, den die Autoren an ihr Werk stellen:
"Die SED blieb, wollte sie Massenpartei sein und bleiben, über ihre Mitglieder und deren Familienangehörigen auf vielfältige Weise mit der Gesellschaft verbunden. Eine gänzliche Isolation der Parteibasis von der Bevölkerung hat es nie gegeben. Nur vor diesem Hintergrund lässt sich verstehen, warum die SED ihre fehlende demokratische Legitimation zum Teil kompensieren konnte. Hinzu kam, dass die Propaganda der SED für eine bestimmte Zeit die Vorstellungswelt, das Lebensgefühl und das Weltbild großer Teile der Bevölkerung beeinflussen konnte."
Leider wird diese These im Buch nicht belegt, ja nicht einmal illustriert. Die Verführungskraft, die die kommunistische Ideologie gerade auf viele Akademiker in der DDR ausübte, wird überhaupt nicht thematisiert, obwohl sich doch einer der Autoren ihr verpflichtet fühlte.
Obwohl auch negative Seiten der SED-Politik dargestellt werden, wird dennoch fortlaufend behauptet, es hätte innerhalb der SED reformkommunistische Kräfte gegeben. So wird zum Beispiel suggeriert, einer der führenden SED-Kader, Anton Ackermann, hätte seine These vom "besonderen deutschen Weg zum Kommunismus" aufrichtig gemeint und sei später bei der offiziellen Rücknahme dieser These zum "Prügelknaben" gemacht worden.
Tatsächlich aber diente diese These der Täuschung vor allem ehemaliger Sozialdemokraten in der SED, wie Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck freimütig bekundeten. Damals sei es darum gegangen, "der großen Scheu, die in den sozialdemokratischen Kreisen vor einer Revolution und vor einem gewaltsamen Weg vorhanden war, Rechnung zu tragen (…)"." Dies erfährt der Leser freilich nicht. Derartige Unvollständigkeiten ziehen sich durch das gesamte Kapitel von Malycha. Zwei weitere Beispiele sollen dies demonstrieren.
Erwähnt wird, dass der Kommunist Paul Merker – ein ehemaliger West-Emigrant – 1950 das SED-Politbüro verlassen musste und gegen ihn ein Schauprozess vorbereitet wurde, weil die Parteiführung ihn als Zionisten brandmarkte. Warum dies geschah, bleibt unerwähnt. Merker hatte sich für Entschädigungszahlungen der DDR an nicht rückkehrwillige deutsche Juden eingesetzt, woraufhin ihm die Parteiführung vorwarf, er würde die "Verschiebung deutschen Volksvermögens" fordern. Schließlich sei das jüdische Eigentum durch die Ausbeutung deutscher Arbeiter entstanden.
Geradezu grotesk wird es, wenn Malycha behauptet, der Marxismus-Leninismus hätte humanistische und undogmatische Gedankengänge, und Wolfgang Harich anführt, der angeblich mehr innerparteiliche Demokratie gefordert hatte und gemeinsam mit anderen Kommunisten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde.
Die erbärmliche Selbstkritik, die Harich vor Gericht ablegte, ist dem Autor keine Zeile wert. Hierdurch würde deutlich, dass selbst vermeintlich kritische Intellektuelle innerhalb der Partei in ihrem tiefsten Innersten ideologisch verblendete Kommunisten blieben.
Wie sehr bei Malycha die realsozialistische Sozialisation auch sprachlich nachwirkt, zeigt sich bei der Bezeichnung von DDR-Flüchtlingen als "Übersiedler" und bei seiner objektivistischen Begründung für die sozialistische Umgestaltung der DDR.
""Wie in den osteuropäischen Ländern hatten die ökonomischen und sozialen Umbrüche – Bodenreform, Verstaatlichung der großen Industriebetriebe – auch in der sowjetischen Besatzungszone zu einer Wirtschafts- und Sozialordnung geführt, die gesamtgesellschaftlicher Planung bedurfte."
Die Aufgaben der einzelnen Parteigliederungen, die Kompetenzverteilungen innerhalb des Apparates und auch das Verhältnis zwischen Partei und Staat werden korrekt dargestellt.
"In der Hierarchie standen die Fachabteilungen bzw. Kommissionen des ZK-Apparates nach wie vor über dem jeweils zugeordneten Ministerium und anderen Regierungsstellen. Fachlich bedeutsame Entscheidungen fielen nicht in den Ministerien, sondern in der jeweils federführenden ZK-Fachabteilung."
Die DDR war, ohne dass es in diesem Buch explizit ausgesprochen wird, im wahrsten Sinne des Wortes ein SED-Staat. Leider bleibt auch unerwähnt, wie die SED den "neuen Menschen" schaffen wollte und welche Rolle dabei den staatlichen Institutionen, der marxistisch-leninistischen Schulung und dem Betrieb zukam.
Der langjährige DDR-Korrespondent der "FAZ", Peter Jochen Winters, beginnt sein Kapitel gleich mit zwei sachlichen Fehlern: Er behauptet fälschlich, Ulbricht habe nach seiner Entmachtung nicht mehr an den Sitzungen des Politbüros teilnehmen dürfen, und Honecker habe die Konstruktion der DDR als "sozialistische Nation" formuliert.
Tatsächlich hat Ulbricht nach seiner Entmachtung weiterhin, wenn auch zeitlich eingeschränkt, an Politbürositzungen teilgenommen, und die Rede von einer "sozialistischen Nation" und dem Ende einer einheitlichen deutschen Nation stammt von ihm und nicht erst von Honecker.
Anders als von den beiden Autoren behauptet, existierte kein genereller Dissens zwischen Ulbricht und Honecker bezüglich des Verhaltens gegenüber der Sowjetunion und der Bundesrepublik.
Winters Darstellung der Honecker-Ära konzentriert sich auf die Bedeutung der von Honecker propagierten "Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik", die von der Bevölkerung vor allem als Primat des Sozialen verstanden wurde. Der Autor kommentiert zurecht:
"In der Bevölkerung geriet das Verständnis dafür, dass man auch in einer ‚sozialistischen Gesellschaft’ erst durch eigene Leistung erarbeiten müsse, was man konsumieren wolle, in Vergessenheit."
Da auch Winters von vermeintlichen Reformkräften in der SED, die jedoch kein Gehör gefunden hätten, ausgeht, entsteht der Eindruck, als ob beide Autoren Mitglieder und Funktionäre der SED in Schutz nehmen und alles Negative auf die jeweilige SED-Führung schieben wollten. So schreibt Winter ohne Beleg:
"Honecker und sein überaltertes Politbüro verloren massiv an Vertrauen selbst bei den linientreuen Genossen. Aus Wut über das Verhalten der SED-Führung gegenüber dem von Gorbatschow angestoßenen ‚neuen Denken’ wuchs der Mut zu alternativem und oppositionellem Denken und Handeln nicht zuletzt auch an der Parteibasis."
Realiter äußerte sich die Parteibasis jedoch erst öffentlich, als es schon zu spät und die Mauer gefallen war. An der Zahl der Parteistrafen und Parteiausschlüsse jedenfalls lässt sich ein renitentes Verhalten der SED-Parteibasis nicht nachweisen. Selbst die Parteiaustritte hielten sich bis zum Sommer 1989 in sehr engen Grenzen. Erst mit Beginn der Massenflucht und der Demonstrationen verzeichnet die Mitgliederstatistik massenhafte Austritte.
Aus unerfindlichen Gründen wird der letzte von der SED gestellte DDR-Ministerpräsident Hans Modrow dafür gelobt, dass er sich angeblich nicht mehr seiner Partei, sondern nur noch der Volkskammer verantwortlich gefühlt habe. Tatsächlich aber versuchte Modrow, um die Öffentlichkeit zu täuschen, die Ziele der Partei stärker über den Staatsapparat durchzusetzen, was ihm durch mehrere Gesetze zur Privilegierung alter Genossen gelang.
Seine Rolle beim gewaltsamen Vorgehen von Sicherheitskräften gegen Demonstranten in Dresden im Oktober 1989 wird verharmlost und sein Widerstand gegen die Auflösung des MfS ebenfalls nicht angemessen gewürdigt. Außerdem wird die Zahl der inoffiziellen Mitarbeiter fälschlich mit 100.000 anstatt richtigerweise mit etwa 170.000 angegeben.
Die Ausführungen zur Weiterentwicklung der SED im wiedervereinigten Deutschland sind weitgehend nichtssagend und enden in dem Fazit, dass unklar sei, ob diese Partei, die sich nun Die Linke nennt, eine postkommunistische oder eine demokratische sei. Dieses Buch enthält nichts Neues, dafür viele Halbwahrheiten und falsche Informationen. Es betreibt auf subtile Weise eine Weichzeichnung der SED.
Andreas Malycha/Peter Jochen Winters: Die SED. Geschichte einer deutschen Partei
Verlag C.H. Beck, München 2009
Die Antwort fällt nach der mitunter ermüdenden Lektüre von 480 Seiten leicht: Die Autoren argumentieren in ihren Kapiteln weitgehend ähnlich: Andreas Malycha hat über die Ära Ulbricht, Peter Jochen Winters über die Ära Honecker geschrieben.
In ihrer Einführung behaupten die Autoren fälschlich, die Rolle der SED sei in Forschungen zur DDR bisher unterbelichtet. Das Gegenteil ist der Fall: In einer Vielzahl von Büchern wird das Wirken der SED anhand von Archivunterlagen und Zeitzeugenberichten detailliert nachgezeichnet. Darüber hinaus nimmt die SED bei Gesamtdarstellungen zur DDR eine herausragende Rolle ein. Neu ist nur der Anspruch, den die Autoren an ihr Werk stellen:
"Die SED blieb, wollte sie Massenpartei sein und bleiben, über ihre Mitglieder und deren Familienangehörigen auf vielfältige Weise mit der Gesellschaft verbunden. Eine gänzliche Isolation der Parteibasis von der Bevölkerung hat es nie gegeben. Nur vor diesem Hintergrund lässt sich verstehen, warum die SED ihre fehlende demokratische Legitimation zum Teil kompensieren konnte. Hinzu kam, dass die Propaganda der SED für eine bestimmte Zeit die Vorstellungswelt, das Lebensgefühl und das Weltbild großer Teile der Bevölkerung beeinflussen konnte."
Leider wird diese These im Buch nicht belegt, ja nicht einmal illustriert. Die Verführungskraft, die die kommunistische Ideologie gerade auf viele Akademiker in der DDR ausübte, wird überhaupt nicht thematisiert, obwohl sich doch einer der Autoren ihr verpflichtet fühlte.
Obwohl auch negative Seiten der SED-Politik dargestellt werden, wird dennoch fortlaufend behauptet, es hätte innerhalb der SED reformkommunistische Kräfte gegeben. So wird zum Beispiel suggeriert, einer der führenden SED-Kader, Anton Ackermann, hätte seine These vom "besonderen deutschen Weg zum Kommunismus" aufrichtig gemeint und sei später bei der offiziellen Rücknahme dieser These zum "Prügelknaben" gemacht worden.
Tatsächlich aber diente diese These der Täuschung vor allem ehemaliger Sozialdemokraten in der SED, wie Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck freimütig bekundeten. Damals sei es darum gegangen, "der großen Scheu, die in den sozialdemokratischen Kreisen vor einer Revolution und vor einem gewaltsamen Weg vorhanden war, Rechnung zu tragen (…)"." Dies erfährt der Leser freilich nicht. Derartige Unvollständigkeiten ziehen sich durch das gesamte Kapitel von Malycha. Zwei weitere Beispiele sollen dies demonstrieren.
Erwähnt wird, dass der Kommunist Paul Merker – ein ehemaliger West-Emigrant – 1950 das SED-Politbüro verlassen musste und gegen ihn ein Schauprozess vorbereitet wurde, weil die Parteiführung ihn als Zionisten brandmarkte. Warum dies geschah, bleibt unerwähnt. Merker hatte sich für Entschädigungszahlungen der DDR an nicht rückkehrwillige deutsche Juden eingesetzt, woraufhin ihm die Parteiführung vorwarf, er würde die "Verschiebung deutschen Volksvermögens" fordern. Schließlich sei das jüdische Eigentum durch die Ausbeutung deutscher Arbeiter entstanden.
Geradezu grotesk wird es, wenn Malycha behauptet, der Marxismus-Leninismus hätte humanistische und undogmatische Gedankengänge, und Wolfgang Harich anführt, der angeblich mehr innerparteiliche Demokratie gefordert hatte und gemeinsam mit anderen Kommunisten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde.
Die erbärmliche Selbstkritik, die Harich vor Gericht ablegte, ist dem Autor keine Zeile wert. Hierdurch würde deutlich, dass selbst vermeintlich kritische Intellektuelle innerhalb der Partei in ihrem tiefsten Innersten ideologisch verblendete Kommunisten blieben.
Wie sehr bei Malycha die realsozialistische Sozialisation auch sprachlich nachwirkt, zeigt sich bei der Bezeichnung von DDR-Flüchtlingen als "Übersiedler" und bei seiner objektivistischen Begründung für die sozialistische Umgestaltung der DDR.
""Wie in den osteuropäischen Ländern hatten die ökonomischen und sozialen Umbrüche – Bodenreform, Verstaatlichung der großen Industriebetriebe – auch in der sowjetischen Besatzungszone zu einer Wirtschafts- und Sozialordnung geführt, die gesamtgesellschaftlicher Planung bedurfte."
Die Aufgaben der einzelnen Parteigliederungen, die Kompetenzverteilungen innerhalb des Apparates und auch das Verhältnis zwischen Partei und Staat werden korrekt dargestellt.
"In der Hierarchie standen die Fachabteilungen bzw. Kommissionen des ZK-Apparates nach wie vor über dem jeweils zugeordneten Ministerium und anderen Regierungsstellen. Fachlich bedeutsame Entscheidungen fielen nicht in den Ministerien, sondern in der jeweils federführenden ZK-Fachabteilung."
Die DDR war, ohne dass es in diesem Buch explizit ausgesprochen wird, im wahrsten Sinne des Wortes ein SED-Staat. Leider bleibt auch unerwähnt, wie die SED den "neuen Menschen" schaffen wollte und welche Rolle dabei den staatlichen Institutionen, der marxistisch-leninistischen Schulung und dem Betrieb zukam.
Der langjährige DDR-Korrespondent der "FAZ", Peter Jochen Winters, beginnt sein Kapitel gleich mit zwei sachlichen Fehlern: Er behauptet fälschlich, Ulbricht habe nach seiner Entmachtung nicht mehr an den Sitzungen des Politbüros teilnehmen dürfen, und Honecker habe die Konstruktion der DDR als "sozialistische Nation" formuliert.
Tatsächlich hat Ulbricht nach seiner Entmachtung weiterhin, wenn auch zeitlich eingeschränkt, an Politbürositzungen teilgenommen, und die Rede von einer "sozialistischen Nation" und dem Ende einer einheitlichen deutschen Nation stammt von ihm und nicht erst von Honecker.
Anders als von den beiden Autoren behauptet, existierte kein genereller Dissens zwischen Ulbricht und Honecker bezüglich des Verhaltens gegenüber der Sowjetunion und der Bundesrepublik.
Winters Darstellung der Honecker-Ära konzentriert sich auf die Bedeutung der von Honecker propagierten "Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik", die von der Bevölkerung vor allem als Primat des Sozialen verstanden wurde. Der Autor kommentiert zurecht:
"In der Bevölkerung geriet das Verständnis dafür, dass man auch in einer ‚sozialistischen Gesellschaft’ erst durch eigene Leistung erarbeiten müsse, was man konsumieren wolle, in Vergessenheit."
Da auch Winters von vermeintlichen Reformkräften in der SED, die jedoch kein Gehör gefunden hätten, ausgeht, entsteht der Eindruck, als ob beide Autoren Mitglieder und Funktionäre der SED in Schutz nehmen und alles Negative auf die jeweilige SED-Führung schieben wollten. So schreibt Winter ohne Beleg:
"Honecker und sein überaltertes Politbüro verloren massiv an Vertrauen selbst bei den linientreuen Genossen. Aus Wut über das Verhalten der SED-Führung gegenüber dem von Gorbatschow angestoßenen ‚neuen Denken’ wuchs der Mut zu alternativem und oppositionellem Denken und Handeln nicht zuletzt auch an der Parteibasis."
Realiter äußerte sich die Parteibasis jedoch erst öffentlich, als es schon zu spät und die Mauer gefallen war. An der Zahl der Parteistrafen und Parteiausschlüsse jedenfalls lässt sich ein renitentes Verhalten der SED-Parteibasis nicht nachweisen. Selbst die Parteiaustritte hielten sich bis zum Sommer 1989 in sehr engen Grenzen. Erst mit Beginn der Massenflucht und der Demonstrationen verzeichnet die Mitgliederstatistik massenhafte Austritte.
Aus unerfindlichen Gründen wird der letzte von der SED gestellte DDR-Ministerpräsident Hans Modrow dafür gelobt, dass er sich angeblich nicht mehr seiner Partei, sondern nur noch der Volkskammer verantwortlich gefühlt habe. Tatsächlich aber versuchte Modrow, um die Öffentlichkeit zu täuschen, die Ziele der Partei stärker über den Staatsapparat durchzusetzen, was ihm durch mehrere Gesetze zur Privilegierung alter Genossen gelang.
Seine Rolle beim gewaltsamen Vorgehen von Sicherheitskräften gegen Demonstranten in Dresden im Oktober 1989 wird verharmlost und sein Widerstand gegen die Auflösung des MfS ebenfalls nicht angemessen gewürdigt. Außerdem wird die Zahl der inoffiziellen Mitarbeiter fälschlich mit 100.000 anstatt richtigerweise mit etwa 170.000 angegeben.
Die Ausführungen zur Weiterentwicklung der SED im wiedervereinigten Deutschland sind weitgehend nichtssagend und enden in dem Fazit, dass unklar sei, ob diese Partei, die sich nun Die Linke nennt, eine postkommunistische oder eine demokratische sei. Dieses Buch enthält nichts Neues, dafür viele Halbwahrheiten und falsche Informationen. Es betreibt auf subtile Weise eine Weichzeichnung der SED.
Andreas Malycha/Peter Jochen Winters: Die SED. Geschichte einer deutschen Partei
Verlag C.H. Beck, München 2009
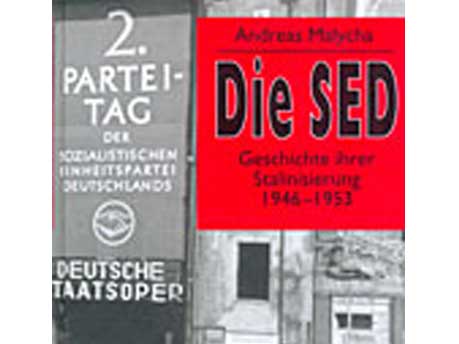
Cover: "Andreas Malycha/Peter Jochen Winters: Die SED"© Verlag C.H. Beck
