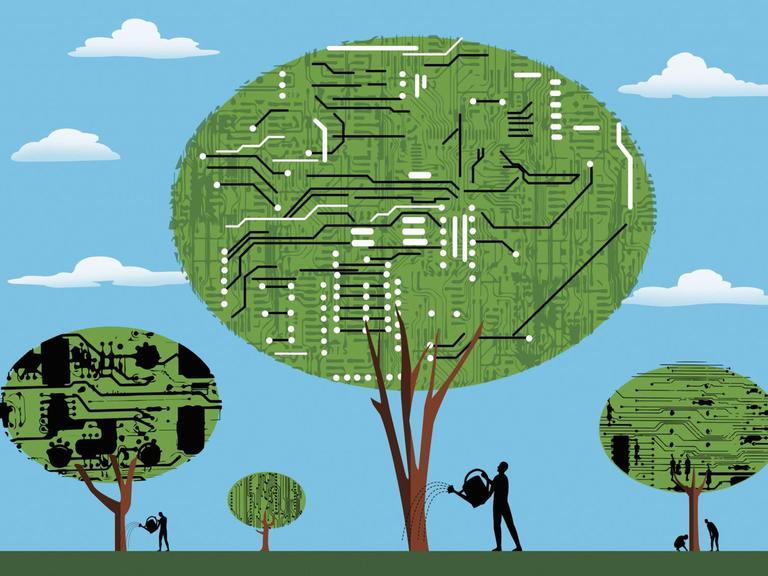Dave Eggers: "Every"
Aus dem Amerikanischen von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel
Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln 2021
592 Seiten, 25 Euro
Ein Maschinenfeind schlägt Alarm
06:09 Minuten
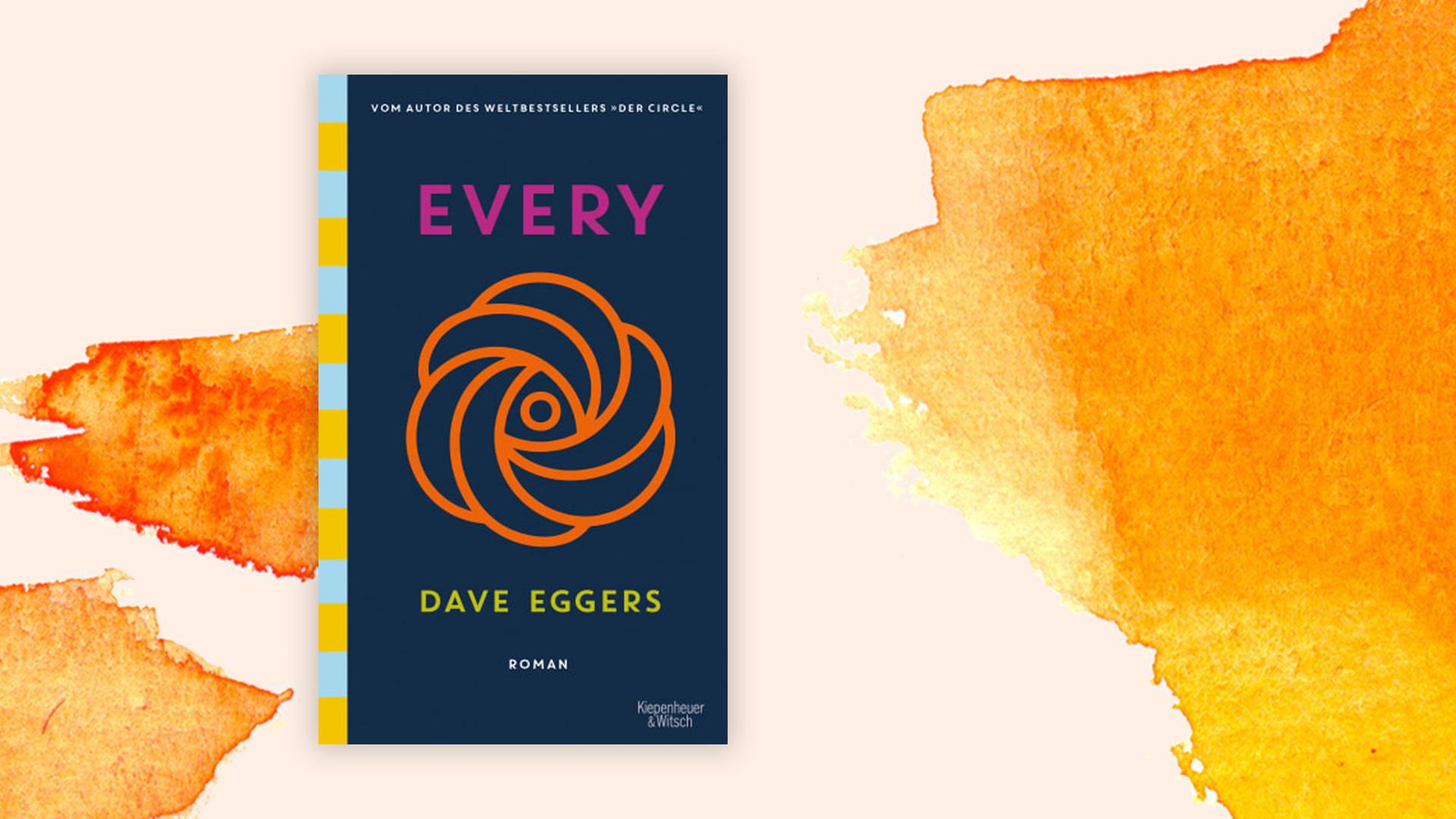
Mit dem Roman "The Circle" über einen mächtigen Tech-Konzern traf Dave Eggers einen Nerv. In der Fortsetzung "Every" lässt er das Unternehmen in jede menschliche Interaktion vordringen. Doch als Satire ist das zu stumpf und als Dystopie zu lauwarm.
Es klingt heute ein wenig wie Fantasy, aber es gab eine Zeit, in der soziale Relevanz in der amerikanischen Mainstreamliteratur schlicht keine Rolle spielte, in der weiße Mittelstandsprobleme für sich zu stehen schienen, ohne politische Analysemodelle im Rücken. In diese Leere trat Anfang der Nullerjahre Dave Eggers und verkündete, dass Schriftsteller den Auftrag hätten, die Welt wenigstens ein bisschen zum Besseren zu verändern und zu ihrem Verstehen beizutragen.
Diese neue Ernsthaftigkeit hatte und hat seine historische Berechtigung, und auch wenn er und seine Mitstreiter oft selbst eben wieder nur weiße Mittelständler waren: Dass der amerikanische Buchmarkt heute wenigstens etwas diverser und progressiver ist als damals, ist auch Eggers' Verdienst, und kein geringer.
Publikum mit Facebookkonto und Facebookangst
Eggers' eigene Bücher über Ungerechtigkeit, Fluchterfahrung, Polizeigewalt und globale Geldströme fielen hinter seine Ansprüche oft zurück, lasen sich eher wie gute Absichten denn wie Zola oder Sinclair. Trotzdem wurden einige von ihnen durch reine Gegenwärtigkeit in den Erfolg gehievt, und so wurde seine Dystopie "The Circle" über ein großes Tech-Unternehmen 2013 zum Bestseller für ein Publikum mit Facebookkonto und Facebookangst.
"Every" ist die direkte Fortschreibung des inzwischen auch verfilmten Romans. Die damalige Hauptfigur Mae Holland, deren Aufstieg bei "Circle" vom Naivling zur bösen Tech-Göttin den Hauptplot ausmachte, taucht hier bis zum Finale nur im Hintergrund auf. Ihre Entsprechung ist die junge Delaney Wells, die beim gleichen, inzwischen zu "Every" umgetauften Unternehmen anfängt. Erzählte der Vorgänger die Geschichte einer Verführung, geht es bei "Every" um Täuschung und Wahrheit.
Lügendetektor für bessere Freundschaften
Delaney hat den Plan, das Unternehmen von innen zu zerlegen, auch wenn sie sich dafür an seinen Missetaten beteiligen muss. Konkret bedeutet das: dabei helfen, durch Apps und Webdienste das soziale Gefüge, ja jede menschliche Interaktion, völlig neu zu strukturieren. Natürlich zum vermeintlich Besseren, Wahrhaftigeren, wie "Every" beteuert.
So funktioniert die App "Friendy" wie ein präziser Lügendetektor, der in Beziehungen und Freundschaften jede kleinste Unwahrheit aufspürt und ahndet.
Leerer Alarmismus
Es ist eine Binse, dass Science-Fiction in Wahrheit immer nur Literatur über die Gegenwart ist, Tendenzen und Zustände konsequent zu Ende denkt. Die große Schwäche von "Every" ist, dass sich Eggers nicht entscheiden kann, ob er vor dem Jetzt oder dem Kommenden warnen will. Ein Grund dafür ist, dass Eggers, als erklärter Maschinenfeind, dieses Jetzt einfach nicht versteht.
Jede Person, die viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringt, weiß (hoffentlich), wie sehr die Dynamiken von Aufmerksamkeit, Konversation und Empörung das eigene Denken verändern, einfach krank machen. Darüber muss geschrieben werden, davor kann sogar gewarnt werden. Eggers will genau das tun, aber weil er nicht weiß, wie es sich anfühlt, produziert er nur leeren Alarmismus, der teils so schrill tönt, dass man Facebook fast in Schutz nehmen will. Der große Verfechter realitätsgesättigter Literatur wird oft vom Irrsinn und den Abgründen der Realität überholt.
Wässriger Diskursbeitrag
Das andere große Problem: Das Buch ist nicht lustig, will es vielleicht auch gar nicht unbedingt sein, haut einem aber trotzdem alle paar Seiten mit einer platten Andeutung ("ein E-Commerce-Gigant, der nach einem südamerikanischen Dschungel benannt ist") oder einer Art Witz ("eine alte Serie namens Riverdale") in die Rippen.
Für eine Satire zu stumpf, für eine Dystopie zu lauwarm, für einen Diskursbeitrag zu wässrig: Am Ende bietet "Every" nicht mehr als ein paar unausgegorene Dialoge über Reformismus oder Revolution und die Frage, ob nicht auch mal jemand an die Kinder denkt.
Marxisten mögen anmerken, dass das eh nicht funktionieren kann, ein Roman über Kapitalanhäufung und Gesellschaft ohne Sinn für Dialektik. Sozialkritischen Exposés, ob marxistisch oder nicht, wird oft Didaktizismus vorgeworfen, und in dieser Hinsicht ist "Every" doch eine Innovation: Der Tonfall des Romans ist nicht lehrerhaft, sondern der eines besorgten Vaters auf einem Elternabend, der zum dritten Mal debattieren möchte, ob im Klassenzimmer denn wirklich ein PC stehen muss.