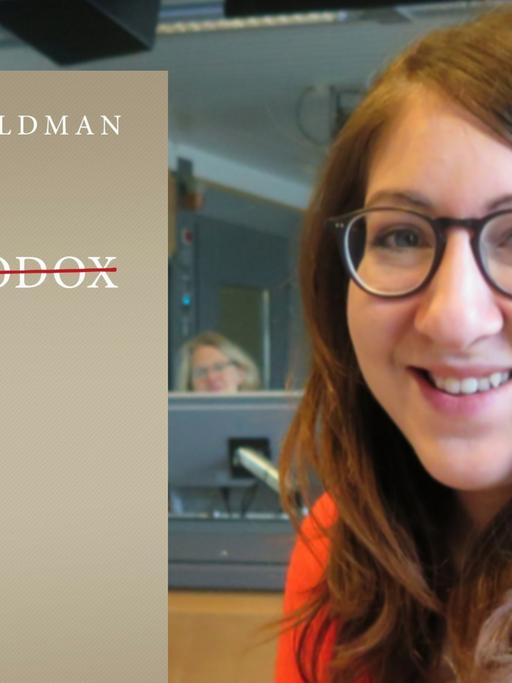"Ich glaube vor allem an die Menschen in Deutschland"

Als junge Frau ließ sie eine ultraorthodoxe jüdische Sekte in New York hinter sich, jetzt ist sie 31 und lebt in Berlin. Darüber, über die Abwehrhaltung in der Ausländerbehörde und einen Neonazi im Spaßbad sprechen wir mit Deborah Feldman.
Im Studio ist heute eine neue deutsche Staatsbürgerin, die in einer Woche zum ersten Mal wählen wird in Deutschland. Es ist die Schriftstellerin und Bestsellerautorin Deborah Feldman aus New York. Sie wurde in der ultraorthodoxen Sekte der Satmarer Juden groß und lebt nun in Deutschland, in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur: Frau Feldman, "Tacheles" heißt unsere Sendung, Tacheles auf Jiddisch, Ihrer Muttersprache. Wie war denn Ihre spontane Reaktion auf unsere Einladung zu Tacheles?
Deborah Feldman: Ich dachte, die Sendung geht um das Judentum, weil, ich kenne das Wort natürlich aus meiner Vergangenheit. Und das ist ja am Samstag. Vielleicht ist dann eine Schabbat-Sendung, dachte ich.
Tacheles hatte in Deutschland andere Bedeutung
Interessant ist es, dass das Wort Tacheles hier so eine Bedeutung hat, als würde man zur Sache kommen. Tacheles in meiner Gemeinschaft ist ein Wort für diese Handlungen und Gespräche, die mit praktischen Dingen zu tun haben, als Gegensatz zum Spirituellen. Weil, in meiner Gemeinschaft wird ja auch Thora diskutiert, Talmud, die Spiritualität, Religion, Gott. Also, wenn man Tacheles spricht, dann spricht man über die alltägliche praktische Angelegenheit, die eigentlich in Konkurrenz stehen zur Spiritualität.
Deutschlandfunk Kultur: Hier wollen wir über beide sprechen, also über ganz praktische Sachen, über Ihr Leben und Ihre Sichtweise hier auf das Deutschland, in dem Sie jetzt angekommen sind; aber natürlich auch über spirituelle Dinge und Dinge, die sie erlebt haben, die Sie bewegt haben und die Ihre Entwicklung ausgemacht haben.
Sie sind 31 Jahre jung und haben nun schon zwei Bestseller verfasst, sind aus einer Welt, aus einer hermetischen Welt ausgebrochen und angekommen in der modernen Welt und dann auch noch in Berlin. Ausgerechnet in Deutschland, dem Land, das einen großen Teil Ihrer Vorfahren vernichtet hat, sind Sie nun angekommen.
Wie erleben Sie dieses Land als neue Bürgerin wenige Tage vor der Bundestagswahl?
Deutschland fast ein Vorbild im Westen
Deborah Feldman: Also, für mich ist das fast so, als würde Deutschland erst nach dem Krieg anfangen, zumindest als Land, das ich wahrnehme. Für mich ist es so, dass das Deutschland heutzutage eigentlich ein Vorbild im Westen geworden ist – im Vergleich auch zu der amerikanischen Gesellschaft, die ich auch übrigens spät im Leben entdeckt habe. Ich bin ja nicht in Amerika aufgewachsen. Ich bin in einer Art von osteuropäischem Schtetl aufgewachsen mit europäischen Traditionen, Sprache, Weltanschauung. Und dann kam ich erst mit 23 raus und musste die amerikanische Gesellschaft kennenlernen.
Und ich habe schnell verstehen können, dass es kein soziales Sicherheitsnetz gibt, dass viele durch die Maschen der Demokratie fallen können und dass dieses Zweiparteiensystem selten Fortschritte ermöglicht, weil man immer sozusagen, wie man sagt, in diesem Schlachtfeld eingesperrt ist oder eingeschränkt.
Und in Deutschland ist mir langsam klar geworden, dass es mit diesem Vielfaltsystem, mit diesen vielen Stimmen, und auch dieser Möglichkeit, parteilos Kandidat zu sein, keine Starre in der Politik gibt. Es bewegt sich oft. Es bewegt sich manchmal in Richtungen, die man nicht gut findet, aber es bewegt sich. Es ist beweglich. Und das bringt viel Hoffnung, besonders für eine Ausländerin.
Deutschlandfunk Kultur: Viel Hoffnung für eine Ausländerin, die aber auch die Brüche in dieser Gesellschaft erlebt. Ich hätte von Ihnen gerne gewusst: Für wie stabil halten Sie die deutsche Demokratie, wenn Sie schauen angesichts der Flüchtlingszuwanderung, von Antisemitismus in der Gesellschaft, auch von gewisser Radikalität, gerade sprechen wir wieder über die NSU-Morde. Wie stark ist diese Gesellschaft und diese Demokratie?
Deborah Feldman: Also, als ich ankam, habe ich nicht gedacht, dass es eine große Stabilität gibt. Ich hatte auch viele Vorurteile. Jetzt, da ich schon drei Jahre hier lebe, glaube ich mehr dran. Also, ich glaube vor allem an die Menschen in Deutschland. Ich glaube an ihr Bewusstsein. Ich denke, die haben einen hohen Sinn für Verantwortung. Und die beobachten ihre eigene und Entscheidungen und Schritte, als würde man auf die gesamte Geschichte blicken. Das ist so ein ganz großer Blick, eine große Sicht.
Und ich finde, das, was wir jetzt sehen mit dem Rechtsruck, mit dieser Wut und so, klar, das ist natürlich verstörend. Viel Schlimmeres beobachtet man jetzt in Amerika, in England. Ich glaube, so was wird es immer geben, immer wieder. Das ist ein Zyklus.
Was mich aber viel mehr beeindruckt und prägt, ist die Reaktion drauf. Ich finde, die Reaktion hier kommt nicht aus Empörung oder Überraschung oder Überforderung, sondern es gibt eine gewisse Kenntnis, eine gewisse Erfahrung, was man in Gesprächen, im Dialog richtig merkt, was man in Amerika oder England nicht sehen würde, nämlich: Man kennt dies schon. Dies ist hier den Deutschen sozusagen vertraut. Man hat das schon hier mehrmals erlebt. Man geht irgendwie souverän und selbstbewusster damit um im Vergleich zum Beispiel zu den Linken in Amerika, als Hillary Clinton verloren hat. Im Vergleich zu dieser Unfähigkeit zu glauben, dass so was passieren kann, dieser Mangel an Bereitschaft anzuerkennen, was sich im eigenen Land wirklich abspielt, was für Kräfte und Strömungen sich langsam bilden und auch wieder zurückbilden.
Deutschlandfunk Kultur: Aber das zu sehen und das schon zu kennen, heißt ja nicht, dass man davor gefeit ist.
Deborah Feldman: Nee.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben ja auch Pegida-Demonstrationen hier erlebt. Sie verfolgen ja die politische Diskussion intensiv, auch rechtspopulistische. Das bindet sich dann wieder mit Trump, mit den Fake-News, mit der Extra-Wirklichkeit. Was ist in Deutschland anders?
Deborah Feldman: Also, ich komme immer wieder auf das Bewusstsein der Menschen zurück, weil, ich habe hier wirklich sehr viele Menschen kennengelernt, die aus unterschiedlichen Hintergründen kommen, aber ein sehr großes Bewusstsein für Geschichte und für Politik haben. Und das macht mir sehr viel Mut, es ist ermutigend. Es ist eigentlich ein klarer Beweis. In so einer Zeit wird ständig über die Wahl gesprochen. Es wird ständig Politik gemacht. Überall, wo ich hingehe, sprechen Menschen mit mir über Politik. Die Menschen sind interessiert. Die wollen sich mit Politikern austauschen. Es geht sie an.
Soziale Gerechtigkeit als großes Thema
Es war halt nicht so, wo ich herkomme. Es war immer so eine kleine Minderheit, die sich politisch engagiert hat, und immer auch ganz entfernt von den Bedürfnissen der Mehrheit. Und hier empfinde ich es nicht so. Ich empfinde hier, dass alle Parteien sich für soziale Gerechtigkeit interessieren. Das. was in Amerika gar nicht auf dem Radar ist, ist eine Priorität. Und da entsteht eine gewisse Beziehung zwischen Politik und den Menschen, weil, die Menschen werden alle als gleich wertvoll eingeschätzt.
Es ist nicht so, dass hier die Armen eigentlich total sich überlassen werden. Es gibt auch natürlich Schwierigkeiten, aber die Gesellschaft liefert nicht diese Botschaft "Ihr seid uns gar nicht wichtig".
Und in Amerika ist es wirklich so, dass, wenn man arm aufwächst, dann empfindet man wirklich dies als Realität: "Wir sind nicht wichtig. Wir dürfen nie ankommen. Unsere Bedürfnisse werden nie Bedeutung haben."
Deutschlandfunk Kultur: Sie sagen, im Grunde sind diese Gegensätze etwas gemildert, obwohl natürlich so eine Bewegung wie Pegida oder auch der Zuspruch zu AfD daher kommt, dass sich viele Menschen für abgehängt halten, eben nicht teilhaben an dem gesellschaftlichen Prozess, der Wohlstand für alle bietet.
Deborah Feldman: Das ist ja interessant. Ich denke nicht, dass es um Wohlstand geht. Ich denke, es geht eher um Angst, Wohlstand zu verlieren. Diese Menschen, die sich gerade ausgegrenzt fühlen, die interessieren mich auch sehr. Ich bin schon persönlich in Kontakt mit denen getreten. Ich habe schon Gespräche mit solchen Menschen geführt. Mir ist immer aufgefallen, eigentlich fehlt diesen Menschen nichts, aber die sind überzeugt, dass sie mehr verdient haben. Das finde ich sehr interessant.
Eine Frau hat mir zum Beispiel erklärt, dass das, was sie macht in ihrem Leben als Karriere, da würde sie in der Schweiz zum Beispiel viel mehr dafür kriegen. Der Grund, warum sie nicht das kriegt, was sie denkt, das sie verdient hat, ist, weil die Flüchtlinge es ihr wegnehmen. Das heißt, da passiert so eine Art Verständnisbogen im Kopf, was der Realität gar nicht entspricht. Und das entsteht eigentlich aus dem eigenen Selbstbild. Man ist überzeugt, dass man mehr vom Leben haben soll. Und weil man das nicht hat, denkt man, da muss jemand dran schuld sein. Und dann guckt man sofort auf die ersten Sündenböcke. Das ist klar.
Deutschlandfunk Kultur: Wenn Sie das so genau sezierend beschreiben, die Welt der zu kurz Gekommenen, die meinen, dass sie nicht genügend bekommen, nicht das bekommen, was sie verdient haben, ist das ein Kennzeichen in Ihrer Gesellschaft hier oder der europäischen Gesellschaften?
"Es geht langsam abwärts"
Deborah Feldmann: Ich glaube, es ist ein Kennzeichnen der westlichen, privilegierten Gesellschaft, weil es uns eigentlich an nichts fehlt; und wir denken, der Grund, warum uns nichts fehlt, ist, weil wir es verdient haben, weil wir besser sind.
Und das ist eine Selbstwahrnehmung, die wir langsam gezüchtet haben. Ich würde sagen, seit der Zweite Weltkrieg vorbei ist, haben wir eigentlich eine Utopie gründen wollen und es gibt dieses Selbstverständnis, dass es für jede Generation eigentlich besser gehen soll. Mittlerweile geht’s nicht besser, es geht langsam abwärts.
Aber ich glaube, diese Überzeugung hat wirklich mit einer verzerrten Selbstwahrnehmung zu tun und einer verzerrten Wahrnehmung der Welt und wie die Geschichte sich entwickelt. Also, man denkt, alles, was man bisher errungen hat, bleibt sowieso, ist selbstverständlich. Es geht nur darum, wie wir mehr erringen können.
Aber eigentlich ist es nicht so. Eigentlich ist es so, dass alles, was wir gerade haben, ist wichtig und wir müssen weiter dafür kämpfen und nicht vergessen, wie glücklich wir sind, das zu haben. Ich denke nicht darüber hinaus, die Freiheit, die Menschenrechte und die Sicherheit zu gewähren, weil, die sind sozusagen die urwichtigen Sachen. Und alles andere ist ja am Ende Quatsch. Auch wenn man in der Schweiz viermal so viel verdient wie in Deutschland, was hat das denn im Leben ausgemacht. Die Schweiz ist ja viel teurer. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, wenn man sagt "Ja, das könnte besser sein" – Wir haben schon so viel. Es ist unfassbar, wie viel wir haben, besonders wenn wir uns mit anderen Ländern, die nicht im Westen sind, vergleichen.
Deutschlandfunk Kultur: Der Kampf um Geld und um Statussymbole, die Frage, ob man das auch bekommt, was man verdient hat, Deborah Feldman, ist das etwas, was in Deutschland schon stark ist, aber nicht so stark wie in den USA?
Ethischer Bezug zu Geld
Deborah Feldman: Also, in Berlin erlebe ich das gar nicht. Weil, in Berlin habe ich das Gefühl, dass ganz andere Dinge wichtig sind als Geld und Status. Ich glaube, in anderen Orten in Deutschland ist es vielleicht anders. Aber ich habe trotzdem in anderen Städten und Regionen erlebt, dass Menschen einen sehr ethischen Bezug zu Geld haben, dass sie das Gefühl haben, okay, sie haben Geld, aber damit muss trotzdem ethisch umgegangen werden.
Ich habe das in Amerika ganz anders erlebt, dass es keine Grenzen kennt, dass dieser Konsum und die Haltung, Geld als Hebel zu verwenden, um andere zu unterdrücken oder um die Gelegenheiten und Möglichkeiten anderer zu stehlen, dies wird in Amerika getan ohne Gewissensbisse. Denn da wird wirklich daran geglaubt, mit dem Geld hat man schon alles andere auch verdient. Und die, die arm sind, sind sozusagen an ihrer Armut selbst schuldig und für ihren Mangel an Gelegenheit selbst schuldig. Und hier hat man schon einen anderen Bezug zu diesem Thema.
Aber immerhin, leider ist es so, dass – wenn man wohlhabend auch in dieser Gesellschaft ist – dieses Wohlhabendsein manchmal jemanden wirklich verblenden kann. Wir werden von anderen Realitäten mit unserem Geld wirklich entfremdet und wir verlieren unsere Verbindung zu anderen Menschen. Weil, sobald wir viel, viel mehr als andere Menschen haben, dann erscheinen uns diese anderen Menschen als irgendwelche komischen Tiere, die wir gar nicht mehr begreifen können.
Und diese Distanz, die sich in einer Gesellschaft aufbaut, weil es diese ungleiche Verteilung von Geld gibt, diese Distanz ist am Ende für uns alle schädlich, egal, ob wir viel haben oder wenig, weil wir die Gesellschaft damit instabil gemacht haben.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben ja selber die Situation der Armut sehr existenziell erfahren müssen, nachdem Sie die ultraorthodoxe Gemeinschaft verlassen hatten. Sie haben sogar den Schritt gewagt, sich als Eizellenspenderin zur Verfügung zu stellen – mit allen Konsequenzen für Ihren Körper. Das ist auch erschütternd, das nachzulesen. Dann aber wurde Ihr Buch von einem Tag auf den anderen ein Bestseller in den USA. Und Sie waren auch aller finanziellen Sorgen ledig. War das für Sie eine ganz krasse Erfahrung?
"Man hat mich konsumiert"
Deborah Feldman: Also, ich wurde zu diesem Zeitpunkt eigentlich ein Objekt, das zum Verkauf gestellt wurde. Ich war auf dem Markt. Und man hat mich konsumiert. Also, es war nicht nur, dass mein Buch sich verkauft hat, man hat mich als Produkt konsumiert. Insofern habe ich an meinem Körper wirklich erfahren, erstmal wie ich sozusagen von dem System ausgebeutet wurde als Eizellenspenderin einerseits, aber auch als ich schon Geld von diesen Verkäufen verdient habe, habe ich erlebt, was es ist, wenn eine Gesellschaft so allkonsumierend ist, dass auch Menschen konsumiert werden, dass alles konsumiert wird und alles um Konsum geht. Und dann, wir verlieren dabei eigentlich unsere Menschlichkeit.
Deutschlandfunk Kultur: Haben Sie, dessen ungeachtet, mit dem Geld, das Sie dann verdient haben über Ihre geistige Arbeit, auch etwas gehabt, das Ihnen und Ihrem Kind Freiheit gibt, Freiheit, dahin zu gehen, wo Sie Ihre Identität leben können und wo Sie ihn und sich weiter ausbilden können?
Deborah Feldman: Also, damals wollte ich erstmal ganz weit weg. Und ich bin erst aufs Land gezogen. In Amerika kann man wirklich so in Wildnis leben. Ich bin irgendwo hingezogen, wo es kaum Menschen gab und wo ich mich nicht mit Menschen auseinandersetzen musste. Da hätte ich auf jeden Fall Ruhe und Freiheit finden können. Aber es war am Ende ein Übergangsort. Es war kein Ort, der für mich ein Zuhause werden konnte. Es war nur ein Ort, wo ich mich ausruhen konnte und überlegen konnte: Wo muss ich jetzt hin? Wo kann ich mich ganz zu Hause fühlen?
Und dies war für mich am Ende Berlin, weil, Berlin ist ja die Stadt für die Heimatlosen, da, wo die Unverwurzelten sich wieder verwurzeln können.
Deutschlandfunk Kultur: Und das ist Ihnen gelungen hier in Berlin?
Deborah Feldman: Auf jeden Fall.
Deutschlandfunk Kultur: Leben wir auf einer Insel der Seligen, wo andere Menschen sich wahrscheinlich wünschen würden, die Probleme, die wir verhandeln, die hätten wir gerne?
Privilegien sind auch schnell wieder weg
Deborah Feldman: Absolut. Das Problem ist: Sobald man aufhört, die eigenen Privilegien wertzuschätzen, verliert man die sehr schnell. Und dann leidet man wieder. Man leidet wieder, um zu verstehen, wie privilegiert man mal war, um die Privilegien wieder für sich zu holen. Ich denke nur, wenn das so weitergeht, wenn wir keine Wertschätzung mehr lernen, dann werden wir wieder leiden müssen. Das ist leider Teil der Geschichte. Das ist so.
Deutschlandfunk Kultur: Würden Sie sagen, Sie sprachen eben von verzerrter Wahrnehmung der Wirklichkeit, man könnte auch die deutsche Jammerei und Schlechtmacherei noch mal herbei nehmen, sind das im Grunde Dinge, die die Demokratie im Inneren auch gefährden?
Deborah Feldman: Nein, das denke ich nicht – eher umgekehrt. Ich denke, dass diese Jammerei die anderen Teile der Gesellschaft eher erwecken und stimulieren. Weil, viele Leute fühlen sich zum Beispiel verpflichtet, gerade zu wählen, weil es diesen Rechtsruck gibt, weil die denken: "Ich muss ja Widerstand leisten. Ich muss ja auch meine Stimme zu Gehör bringen." Eigentlich regt das an. Und ich finde, genau das ist ein Beweis, dass dies System eigentlich gut funktioniert, weil man merkt, wie alle Parteien, wie alle Politiker, wie alle Wähler so heftig auf diesen Rechtsruck reagieren.
Deutschlandfunk Kultur: Frau Feldmann, Sie haben versucht, seitdem Sie in Berlin angekommen sind, die Einbürgerung zu erlangen. Das hat jetzt geklappt. Sie sind seit drei Monaten Deutsche. Aber es war nicht ganz einfach. Auch dieses Land hat Sie nicht mit offenen Armen aufgenommen, zumindest, was die Bürokratie angeht. Was ist Ihnen widerfahren?
Andere litten mehr auf der Ausländerbehörde
Deborah Feldman: Ja, der Bürokratie müssen alle Einwanderer begegnen. Bürokratie ist nie angenehm. Ich glaube, ich habe nicht so viel gelitten wie andere, denen ich in der Ausländerbehörde begegnet bin. Aber klar war, als ich angekommen war, dass man mir ständig versucht hat zu vermitteln, ich sollte eigentlich nicht hierher kommen wollen, bleiben wollen. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Also, es liegt ja nicht im Interesse des Landes, wenn man allen sagt, "Ihr seid alle herzlich willkommen und bleibt mal und genießt…"
Deutschlandfunk Kultur: Warum sollten wir kein Interesse daran haben, eine so reflektierte Schriftstellerin wie Sie hier im Land zu haben?
Deborah Feldman: Aber das wissen ja die Leute nicht in der Ausländerbehörde, wer ich bin. Die wissen nur, dass ich eine von ganz vielen bin. Und die Frage ist: Warum bin ich hier? Und ich glaube, die haben sich auch legitim diese Frage selbst gestellt damals. Was sucht sie hier? Sie hat ja einen amerikanischen Pass. Sie kann ja in New York bleiben.
Ich habe damals bei der Ausländerbehörde ganz am Anfang versucht zu erklären, dass ich eigentlich die deutsche Staatsangehörigkeit schon beantragt hätte in New York und dass meine Familie deutsch war und vertrieben worden war. Und dann sagte mir damals der Mann da am Schreibtisch: "Wer, denken Sie, hat überhaupt Interesse an Ihrer Familiengeschichte?" Und dann hat er so ein vulgäres Wort verwendet. "An Ihrer Familiengeschichte, wer soll da Interesse haben?" Das war wirklich sehr abweisend. Das habe ich damals als Beleidigung empfunden. Erst später habe ich drüber nachgedacht, wie viele Leute vor diesen Schreibtischen an dem Tag sitzen. Und klar ist für diesen Mann nicht interessant, dass ich mich emotional mit Deutschland verbunden fühle.
Ich habe nach einem Jahr eine Ablehnung erhalten. Also, mein Staatsbürgerschaftsantrag ist erstmal nicht durchgegangen, weil es unzureichende Beweise für die Nationalität meines Urgroßvaters gab – haben sie gesagt. Die wollten sozusagen Beweise für seine Nationalität. Allerdings, die Nationalität in Deutschland wird mit Blut bewiesen, was eine sehr ironische Sache ist, weil, wenn du einen jüdischen Urgroßvater hast, kannst du ja nicht beweisen, dass der deutsches Blut hat. Aber irgendwie wollten sie doch einen Nationalitätsbeweis.
Und als sie mich abgelehnt haben, war ich erstmal so: Okay, dann ist es halt so. Dann werde ich heiraten oder irgendwas. Aber mein Verleger hat mich dazu ermutigt, einen Anwalt auszusuchen. Und der hat angefangen im Archiv zu forschen, wollte sich so Beweise suchen.
Auf ein Familiengeheimnis gestoßen
Was wir herausgefunden haben, war ein Familiengeheimnis, dass mein Urgroßvater nach dem Krieg seine Vergangenheit eigentlich wieder erfunden hat, um zu verstecken, dass er nur halb jüdisch war, dass er ein uneheliches Kind war eines deutschen Katholiken und dass er eigentlich die Staatsbürgerschaft nicht hatte, obwohl er das immer gesagt hat; dass er versucht hat, die Staatsbürgerschaft entsprechend der seines Vaters zu erwerben und aus – heute gesehen – verfassungswidrigen Gründen abgelehnt wurde. Er wurde abgelehnt, weil er eine jüdische Mutter hatte.
Und dieser Prozess dauerte zehn Jahre. Und die Ablehnung ist ihm 1930 passiert. Danach hat er aufgegeben. Er hat nicht mehr versucht, sich sozusagen als deutsch zu beweisen, er hat sich eigentlich in die jüdische Welt zurückgezogen. Und er hat das als Niederlage empfunden und hat sich eigentlich davon in England später nie erholen können.
Deutschlandfunk Kultur: Aber er hat überlebt und mit seiner Familie, dann in England?
Deborah Feldman: Er hat überlebt. Und er hat seine Vergangenheit getilgt. Also, wir wussten nie in unserer Familie, dass diese Geschichte passiert ist.
Deutschlandfunk Kultur: Aber Sie haben sie wiedergefunden.
Deborah Feldman: Genau. Ich habe sie wiedergefunden und mein Anwalt hatte dann diese Information verwenden können, um einen Fall zu begründen, warum ich eigentlich die Staatsangehörigkeit bekommen soll, die meinem Urgroßvater verwehrt blieb aus verfassungswidrigen Gründen. Und wir haben es fast als einen Wiedergutmachungsfall gestaltet. Obwohl, ich muss sagen, der Grund, warum ich doch so schnell die Staatsbürgerschaft doch erhalten habe, liegt natürlich daran, dass ich in den Zeitungen drüber gesprochen habe.
Deutschlandfunk Kultur: Sie konnten mit der Öffentlichkeit punkten. Sie haben nicht nur über diese Sache in den Zeitungen geschrieben und in Interviews gesprochen. Sie haben außer dem freundlichen Deutschland der vielen Helfer und Freunde, die Sie da hatten, wo Sie die tolerante deutsche, intellektuelle Welt kennengelernt haben, Sie haben natürlich auch die andere Seite kennengelernt. Sie waren im Spaßbad in Oranienburg zufällig mit ihrem Freund mit den drei Kindern, die Sie erziehen. Und wer sitzt im Whirlpool? Ein bekannter Neo-Nazi mit einem Auschwitz-Tattoo auf dem Rücken und zeigt es über mehrere Stunden vor.
Dieser Fall ist in den Medien sehr weit besprochen worden. Der Mann ist auch vor Gericht gekommen. Und Deborah Feldman sitzt zufällt auch da an der Rutsche. Wie kann das passieren?
Neo-Nazi mit Auschwitz-Tattoo im Spaßbad
Deborah Feldman: Ja, das ist schon ein sehr krasser Zufall. Das gebe ich zu. Man fragt sich manchmal. Also, ich gucke manchmal in meinem Leben zurück und frage mich, warum mein Leben eigentlich so eine Serie von krassen Zufällen ist, aber es ist wirklich so. Ja, ich war an diesem Tag da und habe beobachtet, wie das Publikum eigentlich gar nicht drauf reagiert hat. Und das hat mich sehr tief getroffen. Es war ein sehr schlechter Tag für mich, aber ich habe mit mir selbst auch sehr gehadert damals, weil ich dachte, ich bin die, die in der Vergangenheit steckengeblieben ist.
Eigentlich liegt es an mir. Das Problem ist mein Problem. Alle anderen sind damit einverstanden. Alle können damit leben. Nur ich kann nicht damit leben, weil ich mich so gebunden an meine Großmutter gefühlt habe, die mich erzogen hat, die war Holocaust-Überlebende, dass ich an diesem Tag das Gefühl hatte, ich betrüge sie. Dadurch, dass ich hier bin, betrüge ich sie. Weil, guck mal, was für ein Land das ist, dass ein Mann mit einem Auschwitz-Tattoo sich frei im Bad bewegen kann.
Diese Meinung hat sich dann mit der Zeit ändern können. Ich bin zum ersten Prozess gefahren, habe den Prozess beobachtet. Die Strafe war sehr mild. Damit wurden meine Erwartungen und meine Befürchtungen auch bestätigt. Aber es ging weiter. Es wurde drüber geschrieben. Ich habe darüber geschrieben. Es ging von beiden Seiten in Berufung. Und beim zweiten Prozess im Landgericht Neuruppin kam eine Haftstrafe.
Und Teil des Arguments da war, der Staatsanwalt hat an den Richter appelliert und gesagt: "Guck mal, was die internationale Presse drüber schreibt. Guck mal, was für ein Eindruck hier vermittelt wird. Wollen wir wirklich zeigen, dass wir ein Staat sind, der vor rechtsextremen Taten zurückweicht?" Da hat der Richter auch sehr streng reagiert. Das hat mir auch gezeigt, wie das System funktioniert und wie man manchmal auch Geduld haben muss, dass der Prozess sich in seiner Reife entwickeln kann.
Und beim dritten Prozess bin ich gar nicht da hingefahren, aber ich habe trotzdem einen Bescheid bekommen, dass die Strafe dann bestätigt wurde am gleichen, also am selben Tag, als ich den Brief bekommen habe, dass meine deutsche Staatsangehörigkeit doch verfügbar gemacht wird.
Deutschlandfunk Kultur: Schon wieder eine fast mystische Koinzidenz. Sie haben diesen Fall von Marcel Zech, dem Neo-Nazi, der nun dafür auch ins Gefängnis musste, ja paradigmatisch auch gesehen für Ihren Blick auf den deutschen Staat und auf seine Stärke oder Labilität.
Sie haben ihn verglichen mit einem Muskel, einem Muskel, der trainiert werden muss, um gut funktionieren zu können, und ein Muskel, dessen Faser Sie vielleicht auch in Zukunft sein möchten. Werden Sie politische Aktivistin?
"Wir alle müssen politisch aktiv sein"
Deborah Feldman: Ich glaube, jeder Mensch, der in einem demokratischen Land lebt, muss politischer Aktivist sein. Also, wir müssen alle politisch aktiv sein. Das bedeutet, Bürger zu sein. Dass wir denken, dass Bürger zu sein bedeutet, einfach zu Hause zu sitzen und zu warten, dass man von der Gesellschaft profitiert, das ist auch leider ein Symptom unserer sehr privilegierten Gesellschaft, dass wir denken, wir haben alles verdient, ohne dafür arbeiten zu müssen.
Vielleicht stimmt das, dass ich politische Aktivistin werde, weil, vorher habe ich kein Gespür dafür entwickeln können. Ich habe mich so weit entfernt gefühlt von dem amerikanischen System. Ich wurde auch teilweise davon betrogen. Insofern bin ich zum ersten Mal vielleicht mit blanker Tafel wieder da und kann sagen, ich investiere in dieses System, weil ich schon weiß, dass ich davon profitiert habe, weil ich weiß, dass ich theoretisch davon zu jeder Zeit profitieren kann.
Deutschlandfunk Kultur: Sie profitieren inwiefern?
Deborah Feldman: Erstmal, dass meine Freiheit gewährt ist auf einer ganz hohen Ebene, dass ich Anspruch auf gewisse Rechte habe, aber dass meine Sicherheit, meine körperliche Sicherheit, meine soziale Sicherheit, meine Zukunft geschützt ist. Das heißt, ich kann eigentlich hier nicht scheitern, ich denke nicht, dass ich scheitern werde, aber ich bin schon mal ganz nah dran gekommen. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Und hier habe ich zum ersten Mal diese Ruhe, die aus dieser Kenntnis entsteht, weil ich weiß, hier können mir eigentlich gewisse Dinge nicht passieren.
Insofern profitiere ich eigentlich schon im Voraus, weil ich diese Angst nicht mehr habe.
Deutschlandfunk Kultur: Sie sind 31 Jahre, ich sagte es eingangs. Und Sie haben mit Ihrem zweiten Buch "Überbitten" jetzt im Grunde eine Reflexion über Ihren ganzen Werdegang bis jetzt dargelegt. "Sieben Jahre der Flucht" haben Sie es mal genannt.
Wenn Sie einen Satz vervollständigen würden?
Denk ich an Deutschland…
Deborah Feldman: Denk ich an Deutschland, denke ich an spontane Wundheilung.
Deutschlandfunk Kultur: Warum?
Deborah Feldman: Weil ich merke, wie in dieser Gesellschaft eine Immunfunktion wirkt, die den ständigen sozusagen Heilungsprozess unterstützt insofern, dass Deutschland immer noch in diesem Modus ist: Wir müssen uns heil machen. Wir müssen uns erholen. Wir müssen gesund werden. Es gibt diesen Fokus, diese Konzentration, immer die Gesellschaft zu beobachten. Was fehlt uns noch? Wie müssen wir uns verbessern? Wie wirkt die Vergangenheit noch über uns? Wie weit sind wir von unserer erwünschten Zukunft? Das ist wirklich so, als gäbe es ein Immunsystem.
Deutschlandfunk Kultur: Auch gegen Rassismus?
Deborah Feldman: Teilweise schon. Ein Immunsystem kann ja nur gegen irgendwas wirken, wenn die Bedrohung da ist. Wir lernen natürlich von der Bedrohung, wie uns davor zu schützen. Insofern ist die Bedrohung eigentlich wichtig. Das ist ja das Konzept auch einer Impfung. Wir brauchen eigentlich diese Rechtsextreme, um einen Widerstand dagegen entwickeln zu können.
Die Frage ist: Wie groß dürfen wir diese Wirkung werden lassen? Da habe ich immer noch das Gefühl, dass in Deutschland das Immunsystem sehr kräftig funktioniert.
Deutschlandfunk Kultur: Werden Sie in einer Woche wählen?
Deborah Feldman: Absolut.
Deutschlandfunk Kultur: Mit Begeisterung?
Deborah Feldman: Mit großer Begeisterung, absolut.
Deutschlandfunk Kultur: In Deutschland fragt man nicht, was wählst du. Was wählen Sie?
Deborah Feldman: Ich wähle ja nicht eine Partei, weil ich mit dem Programm hundert Prozent einverstanden bin, aber ich wähle erstmal, um Widerstand gegen den Rechtsruck zu leisten, klar. Und ich wähle eine Partei, die in dem Bundestag immer die anderen daran erinnern wird, dass die soziale Gerechtigkeit uns nicht aus dem Blick fallen darf.
Deutschlandfunk Kultur: Dankeschön, Deborah Feldman, für dieses Gespräch hier in Tacheles.
Wir haben nicht über Ihre literarischen Werke gesprochen. Das ist in diesem Programm schon passiert. Und ich darf unsere Hörerinnen und Hörer darauf verweisen, dass natürlich im Internet unsere Rezensionen noch verfügbar sind, auch die Gespräche, die mit Ihnen schon gelaufen sind. Ich freue mich auf weitere. Und ich freue mich auf weitere Bücher von Ihnen, Deborah Feldman. Ganz herzlichen Dank!
Deborah Feldman: Danke sehr!