Autorin und Sprecherin: Vera Linß
Ton: Thomas Monnerjahn
Regie: Stefanie Lazai
Redaktion: Lydia Heller
Dekolonisierung und Technologie
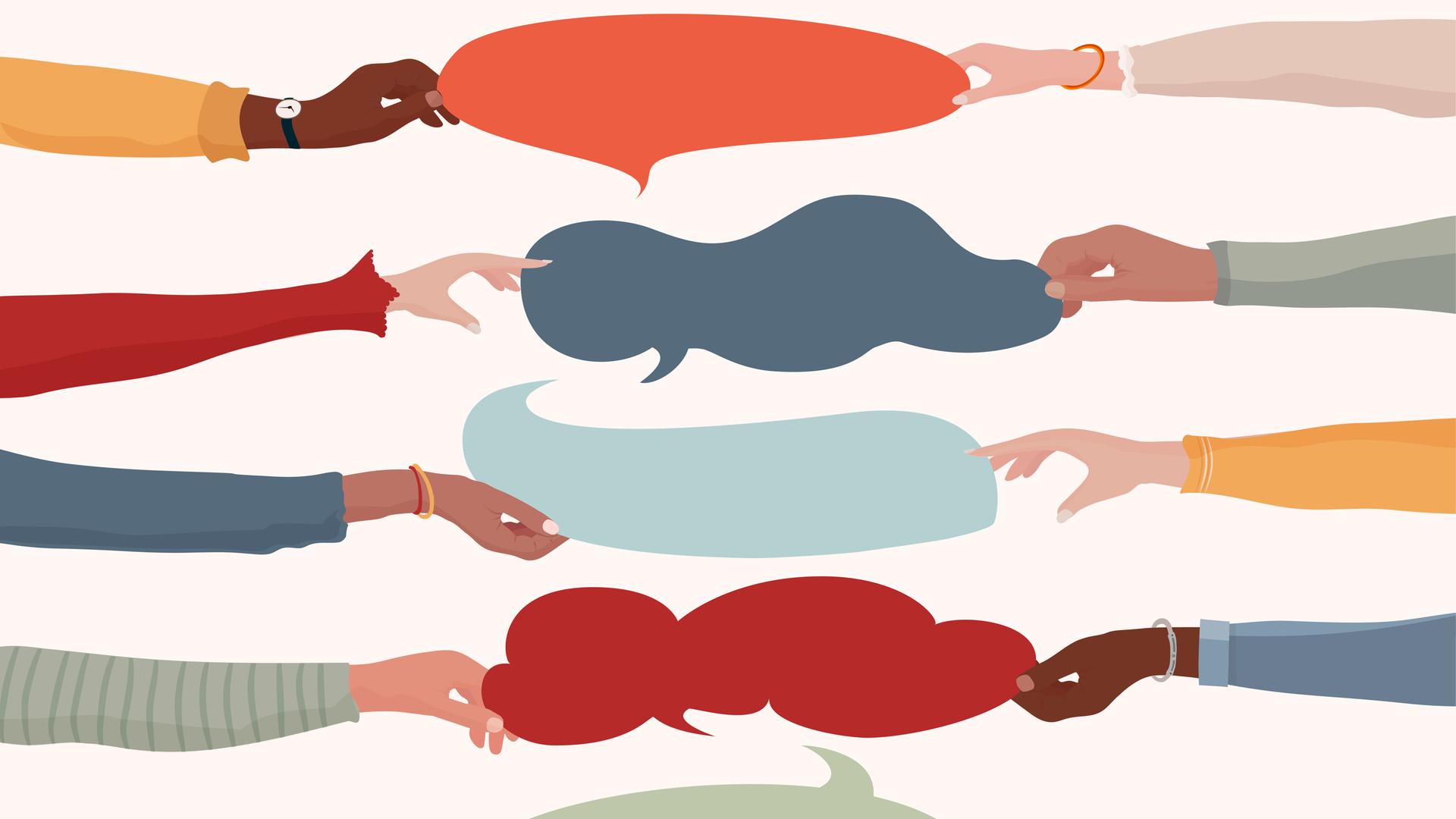
Seit ihrer Entstehung gehört Sprache zu den zentralen menschlichen Ausdrucksmitteln. Wessen Sprache der Computer nicht kennt, der oder die hat ein Problem. © Getty Images / iStock / Melitas
Eine digitale Stimme für den Globalen Süden
30:08 Minuten
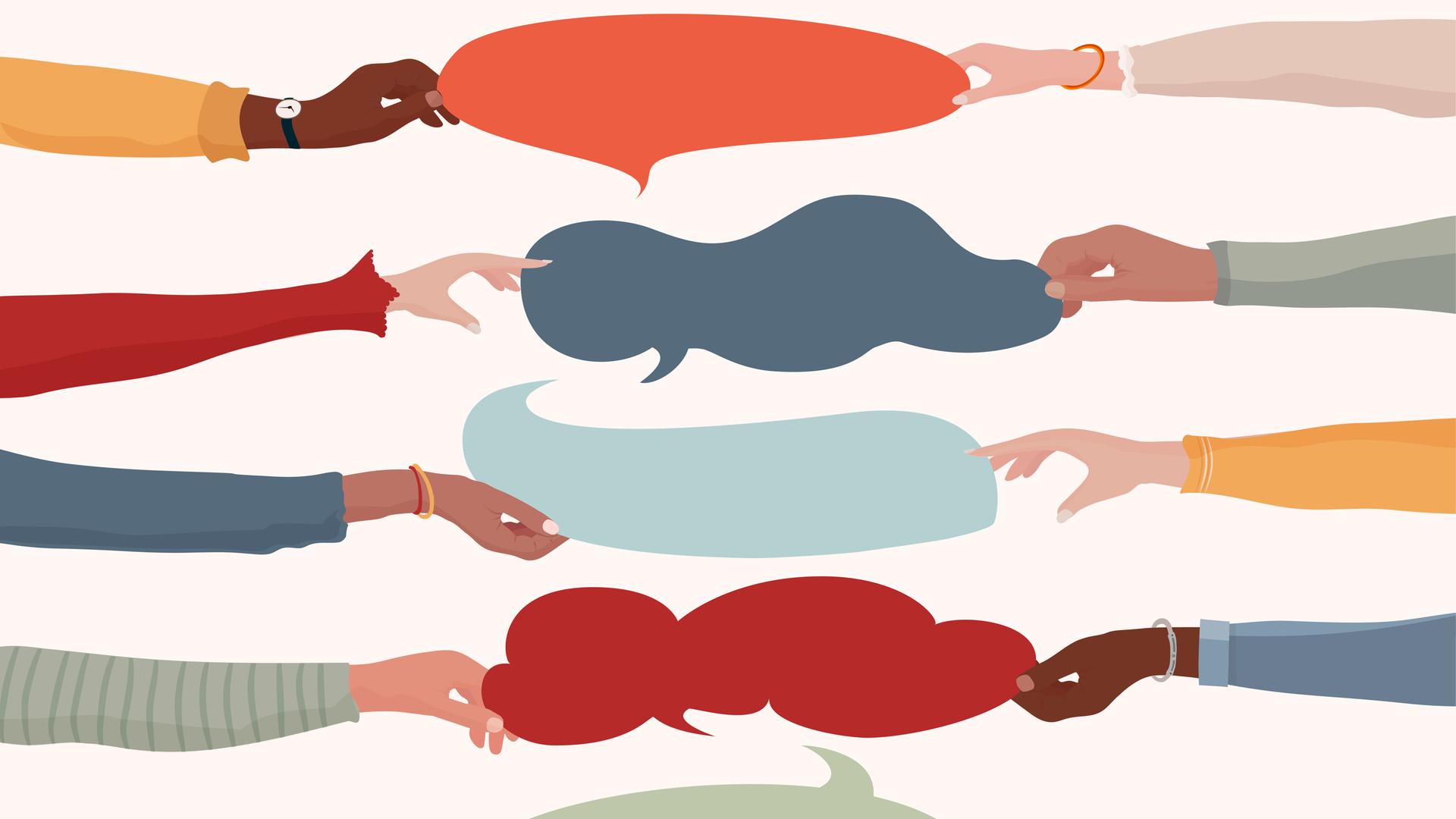
Im Internet, in Apps und Sprachassistenten kommen sie nicht vor: die Sprachen von etwa 3,5 Milliarden Menschen, vor allem aus dem Globalen Süden. Forscher arbeiten jetzt daran, ihnen digital eine Stimme zu geben.
Etwa 7000 Sprachen sind auf der Welt zu Hause. Wann die ersten Wörter entstanden sind, ist umstritten. Wissenschaftler vermuten, dass die Vorfahren des Menschen schon vor 500.000 Jahren die ersten Wörter ausgetauscht haben. Andere schätzen, dass es erst vor etwa 100.000 Jahren losging.
Seit ihrer Entstehung gehört Sprache zu den zentralen menschlichen Ausdrucksmitteln. Und inzwischen ist sie auch das wichtigste Werkzeug, um digital zu interagieren. Wessen Sprache der Computer nicht kennt, der oder die hat ein Problem.
„Sprache bestimmt sehr stark, welche Möglichkeiten du online hast. Und Sprache hat auch einen starken Einfluss darauf, wie willkommen und zugehörig du dich fühlen kannst, wenn du online bist“, sagt Nakeema Stefflbauer, Gründerin von Techincolor.eu, einem Netzwerk von Tech-Führungskräften in Europa.
Keine Sprache, keine Möglichkeiten
Ihr Fazit fällt kritisch aus, wenn es um Sprachenvielfalt im Internet geht. „Wenn du auf die großen sozialen Plattformen schaust – egal ob Wikipedia, YouTube, Facebook oder Twitter: Sie alle haben Probleme damit, Sprachen und kulturelle Feinheiten durch Sprachen zu unterstützen, die außerhalb Nordamerikas, Europas und teilweise Asiens gesprochen werden“, sagt sie.
Verantwortlich dafür ist das Design Künstlicher Intelligenzen, die schlicht nur auf eine begrenzte Anzahl an Sprachen programmiert sind. Google etwa unterstützt rund 100, Wikipedia hält 315 Sprachversionen bereit. Das sind bei Google weniger als zwei, bei Wikipedia weniger als fünf Prozent aller Sprachen weltweit.
Wenig Sprachenvielfalt im Internet
In den nächsten Jahren könnte diese geringe Sprachenvielfalt zunehmend zu einem Problem werden. Denn die Bedeutung von Sprache in der digitalen Kommunikation wächst stetig. Genauer: die Bedeutung gesprochener Sprache. Dass Menschen mit ihren Geräten reden, wird bald so normal sein, wie früher die Tastatureingabe.

Wirbt für mehr Sprachenvielfalt im Netz: die Gründerin von Techincolor.eu Nakeema Stefflbauer. © picture alliance / Britta Pedersen / dpa-Zentralbild / dpa
Digitale Sprachassistenten wie Alexa oder Google Home sind seit Jahren auf dem Vormarsch. Die Zahl der verkauften Geräte soll bis 2025 auf rund 200 Millionen im Jahr steigen.
Doch Sprachsoftware verschiedenster Anbieter ist schon jetzt fast überall zu finden: in Apps, auf dem Smartphone, im Auto, quasi in jedem Computer.
„Immer mehr Technologien sind auf Sprachassistenten angewiesen“, sagt Rebecca Ryakitimbo Mwambi von der Mozilla Foundation. „Wenn es um Spracherkennung geht oder um Text-zu-Sprache-Übersetzungen. Das wird in Zukunft auch noch zunehmen, weil es zudem eine integrative Funktion hat. Menschen mit Hörbehinderungen können einige dieser Text-zu-Sprache-Übersetzungen benutzen. Auch blinde Menschen profitieren sehr von Sprachassistenten.“
Afrikanische Sprachen werden kaum unterstützt
Doch für Sprachassistenten gilt viel mehr noch als für das Internet ohnehin: Bisher sind sie vor allem auf Nutzerinnen und Nutzer in Industrieländern zugeschnitten. Die beliebteste Anwendung – Alexa von Amazon – unterstützt gerade mal neun Sprachen. Darunter Englisch, Spanisch, Deutsch, Mandarin und Hindi.
Siri, der Assistent von Apple, bietet immerhin rund 30 Sprachen an. Afrikanische zum Beispiel aber sind nicht darunter, obwohl auf dem Kontinent Schätzungen zufolge rund 2000 Sprachen gesprochen werden. Auch der Google Assistant unterstützt diese nicht.
Von den derzeit gängigen Sprachassistenten profitieren insgesamt etwa vier Milliarden Menschen. Das heißt: Die Hälfte der Weltbevölkerung – rund 3,5 Milliarden – bleibt aus diesem Teil der digitalen Welt ausgeschlossen.
Um auch für diese Menschen Sprachsoftware zu schaffen, hat die Mozilla Foundation 2017 das Crowdsourcing-Projekt Common Voice gestartet. Die Idee dahinter: Jeder kann gesprochene Sätze spenden, aus denen dann Spracherkennungssoftware programmiert wird.
Mehr als 9000 Stunden in 90 Sprachen wurden bislang aufgenommen, darunter auch afrikanische wie: Luganda, Kabyle und Kinyarwanda, die in Uganda, Algerien und Ruanda gesprochen werden. Auch ein Projekt für Swahili wurde inzwischen aufgesetzt – Muttersprache für rund 100 Millionen Menschen in Ost- und Zentralafrika.
Crowdsourcing für digitale Sprachenvielfalt
„Wir crowdsourcen Textdaten in dieser Sprache. Und dann werden diese offenen Textdaten auf die gemeinsame Sprachplattform hochgeladen, die wir zum Sammeln der Daten verwenden“, sagt Rebecca Ryakitimbo Mwambi. Sie arbeitet bei der Mozilla Foundation daran mit, den Datensatz in Swahili zu erstellen und prüft, ob Kriterien wie Geschlecht, Alter, regionale Herkunft, Akzent und Umgangssprache angemessen berücksichtigt sind.
Ein Verfahren besteht darin, dass Nutzern Sätze vorgegeben werden. „Wenn der Benutzer die Common-Voice-Plattform besucht, werden die Sätze einzeln angezeigt. Eine Schnittstelle ermöglicht es der Person, die Sätze laut vorzulesen und sich dabei selbst aufzunehmen. Mozilla hat Zugriff auf das Backend dieser Plattform. Dort sammeln wir die aufgenommenen Clips und veröffentlichen den Datensatz regelmäßig. Wir machen die Daten auf der Plattform verfügbar.“

Für Sprachassistenten wie Siri gilt: Bisher sind sie vor allem auf Nutzerinnen und Nutzer in Industrieländern zugeschnitten.© imago / photothek / Thomas Trutschel
Eine zweite Möglichkeit: Benutzerinnen und Benutzer hören sich auf der Sprachplattform Wörter an und müssen bewerten, ob diese richtig oder falsch ausgesprochen wurden. Aus den frei nutzbaren Daten können Entwicklerinnen und Entwickler dann Dienstleistungen programmieren. Je nachdem, wie komplex eine Sprachsoftware sein soll, werden mehr oder weniger Daten benötigt.
Chatbots in Kinyarwanda
„Das Minimum ist ein Gigabyte an Textdaten in der entsprechenden Sprache. Aber das variiert stark. Empfohlen werden mindestens 1000 bis 2000 Stunden transkribiertes Audio. Je nach Umfang der Anwendung können aber auch weniger Daten erforderlich sein. Es kann sein, dass nur circa 1000 bis 1500 Stunden transkribierte Audiodaten nötig sind, um eine Chatbot-Anwendung zu schaffen, die sich um Covid-19 oder ein anderes Thema dreht, auf das Sie sich fokussieren möchten.“
Ein sprachgesteuerter Chatbot, der Informationen zu Covid-19 in Kinyarwanda liefert, wurde auf diese Weise bereits geschaffen. Und Open Voice ist nicht die einzige Initiative, die Sprachbarrieren im Internet abbauen möchte. Das Open-Source-Projekt Masakhane etwa – gegründet von südafrikanischen KI-Forschern – arbeitet an Übersetzungstools ausschließlich für afrikanische Sprachen. Dahinter steht ein Netzwerk aus Linguisten, Datenwissenschaftlern, Übersetzern und Studierenden aus ganz Afrika.
IT-Firmen interessiert Sprachenvielfalt wenig
Doch ist das nicht viel zu wenig, um Milliarden bislang ausgeschlossener Menschen die Nutzung digitaler Dienste zu erleichtern? Was können Projekte wie Open Voice oder Masakhane ausrichten, wenn die großen Tech-Unternehmen nicht mitziehen?
Es sei ziemlich klar, warnt Nakeema Stefflbauer, dass es online dann keinen Platz geben wird für Menschen, deren Sprachen nicht repräsentiert werden.
„Das ist eine sehr beängstigende Position. Denn wir stehen kurz vor dem Metaversum, und uns wird gesagt, dass diese neue digitale Umgebung der Ort ist, an dem man sein muss und an dem alles passieren wird.“
Was aber sei, wenn Menschen überhaupt nicht auf das Metaversum zugreifen können, ohne zu einer zweiten oder dritten Sprache zu wechseln, wie es bereits bei vielen Onlineplattformen der Fall ist? Weil ihre Sprachen einfach nicht mit einbezogen werden?
Aus ökonomischer Sicht scheint es logisch, dass sich die Tech-Unternehmen aus dem globalen Norden auf wenige Sprachen konzentrieren. Alles andere lohnt sich für sie kaum. Nakeema Stefflbauer überzeugt das Argument der mangelnden Profitabilität jedoch nicht. Es stecke genug Wachstumspotenzial in Anwendungen für die meisten dieser unterrepräsentierten Sprachen, sodass das Profit-Argument nicht wirklich zähle.
„Wenn du nur deine Einnahmen steigern willst, solltest du auf jeden Fall daran interessiert sein, möglichst vielen Benutzern möglichst viele Zugangsmöglichkeiten bereitzustellen, um online zu interagieren“, meint Stefflbauer.
„Ich denke eher, es gibt da viel selbstreferenzielles Verhalten, das in die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen in der Tech-Welt fließt.“ Und das verweist auf mehr als Sprachbarrieren und Übersetzungsschwierigkeiten.
Es geht um mehr als Sprachbarrieren
13. November 2015. Hunderte Besucher werden in der Pariser Konzerthalle Bataclan während eines Terroranschlags als Geiseln genommen. Es gibt 89 Tote. Weitere Menschen werden bei Angriffen auf nahegelegene Cafés und Restaurants ermordet. Das Land steht unter Schock, viele sorgen sich um ihre Angehörigen. In der Folge führt Facebook eine neue Funktion ein.
Aus Solidarität zu Frankreich kann jeder Nutzer sein Profilbild mit der französischen Nationalfahne unterlegen. Aber: „Zur selben Zeit, im November 2015, gab es einen Anschlag in Bourdsch al Baradschneh im Libanon, bei dem 43 Menschen ums Leben kamen. Keine Solidaritätsfahne für den Libanon. Am 12. Dezember, in Nigeria: Großangriff von Boko Haram. Die gleiche Situation. Wo ist die Solidaritätsfahne für Nigeria? Und ich denke, dass in vielen Fällen die gleiche Art von Prozess abläuft, nicht nur, wenn es um Dinge wie Flaggen auf deinem Profil geht, sondern auch bei wichtigeren Dingen wie der Sicherheitsüberprüfungsfunktion, die auch nach den Bataclan-Angriffen eingeführt wurde.“
Im Zuge des Bataclan-Anschlags hatte Facebook auch die Funktion „Safety Check“ aktiviert, über die Nutzer ihren Status als „sicher“ markieren konnten. Ein technisch unaufwendiger Vorgang, den es für Nigeria und den Libanon nicht gab.
„Wenn du nicht die Möglichkeit hast zu überprüfen, ob deine Lieben sicher und geschützt sind, wenn etwas Schreckliches passiert, dann sendet das ein klares Signal: Dass es nicht ums Geldverdienen geht, nicht um Einnahmen und Wachstum. Es geht um eine Weltanschauung, die direkt mit bestimmten Menschen zu tun hat. Und andere Menschen kommen darin nicht vor. Sie sind aus dieser Weltanschauung ausgeschlossen.“

Ausgrenzung und Rassismus in der digitalen Welt: Manche Gesichtserkennungssoftware erkennt schwarze Gesichter nicht.© imago images / Kirchner-Media / Wedel
Digitale Technologie grenzt aus. Über Sprache, über Social-Media-Features – oder digitale Dienste, die so gestaltet sind, dass sie diskriminieren. Gesichtserkennungsalgorithmen etwa, die schwarze Gesichter nicht erkennen oder diese – wie 2015 in einer Google-App geschehen – mit „Gorilla“ betiteln.
Aber auch Produkte, die extra für den afrikanischen Kontinent gedacht sind, können eher schaden als nutzen. Und zwar dann, wenn sie nicht auf die Probleme vor Ort zugeschnitten sind. Beispiele sind Fintech-Startups wie Safaricom oder Tala, die in Kenia Menschen ohne Bankkonto über Mikrokredite Zugang zum Finanzsystem ermöglichen.
Doch arme Leute können die Kredite kaum bedienen, sie nutzen eher der Mittelschicht – und vor allem: den Unternehmen selbst, deren Geschäftsmodelle wiederum aus dem Silicon Valley stammen.
Tala etwa hat seinen Sitz in Kalifornien. Zu den Kapitalgebern gehört auch der Online-Bezahldienst PayPal. Hinter Safaricom stehen die kenianische Regierung und das britische Telekommunikationsunternehmen Vodafone, die nach dem Vorbild des Silicon Valley die Digitalisierung nach Kenia bringen.
Digitaler Kolonialismus
„Digitalen Kolonialismus“ nennt die Kulturwissenschaftlerin Katrin Köppert dieses Prinzip. Ähnlich wie zur Zeit der Kolonialisierung wird hier Wertschöpfung betrieben. Dabei geht es nicht nur um gewinnbringende digitale Services oder den Profit aus Daten, sondern auch um die materiellen Grundlagen der Digitalisierung, die nach kolonialem Muster angeeignet werden, Rohstoffe zum Beispiel.
„Was soviel bedeutet, dass die Ressourcen, die jetzt – wie seltene Erden und so weiter – abgebaut werden für digitale Technologien, dass die im Grunde genommen auch wieder rassialisiert sind“, so Köppert. „Dass es die Vorstellungen gibt, dass man die auch einfach abschöpfen kann, dass sie uns sozusagen zur Verfügung stehen.“
Ohne Rohstoffe aus Afrika würde kein Smartphone funktionieren. Abgebaut werden sie in Entwicklungsländern in Süd- und Ost-Afrika, von meist schlecht bezahlten Arbeitern, unter schlechtesten Arbeitsbedingungen und auf Kosten der Umwelt. Die Profiteure: europäische, US-amerikanische und chinesische Konzerne sowie korrupte Regierungen.
Materielle Basis der digitalen Welt ausgeblendet
Katrin Köppert, Professorin am Institut für Medienwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum, hat untersucht, mit welchen Bildern solche kolonialen Ausbeutungsverhältnisse verharmlost werden. Ihr Beispiel: die Vergenoeg-Fluorit-Mine – eine ehemalige Goldmine in Südafrika, in der heute das Mineral Fayalit abgebaut wird. Es enthält schwere Seltenerdmetalle, die für Windkraftanlagen, Elektromotoren und Smartphones gebraucht werden.
Aktiv ist vor Ort – neben chinesischen Investoren – die spanische Grupo Minersa, die im Internet romantische Bilder von der Mine inmitten einer Berglandschaft verbreitet.
„Und das führt zu keinen Irritationen mehr, weil das sind natürlich tradierte Formen, die bei uns jetzt aus einer westlichen Perspektive zu keiner Verwunderung führen“, sagt Köppert. „Das ist auch ein Bildmuster. Dass diese Minen mehr oder weniger in einen Topos der Landschaftsmalerei überführt werden.“

Kupfermine in Sambia: Das Metall und Seltene Erden werden für elektronische Geräte benötigt.© imago / photothek / Thomas Trutschel
Welche ökologischen Folgen hat der Abbau der Rohstoffe? Wer macht das Geschäft mit den Seltenerdmetallen? Solche Fragen stellen sich nicht angesichts der Bilder, die den Eindruck erwecken, alles sei in bester – aus westlicher Sicht: gewohnter – Ordnung.
Datenströme auf alten Sklavenschiff-Routen
Auch auf einem Teil der Wege, auf denen sich die Datenströme des Internet bewegen, finden sich nach wie vor Spuren kolonialer Ausbeutung: Die Kontinente werden verbunden durch ein globales Netzwerk von Unterseekabeln – für die Allgemeinheit unsichtbar. Das verstärke zum einen den Eindruck, das Internet sei „immateriell“ und schwerelos. Zum anderen, so Katrin Köppert, verschwindet so zudem die Erinnerung an die Geschichte dieser „Übertragungswege“.
Gebe man bei einer Google-Suche „Internet‘“ ein, würden Bilder auftauchen, die das Internet mit dem Universum, dem Weltraum assoziieren, so Köppert. „Aufgrund der Vorstellung, dass der Datentransport irgendwas mit den Satelliten zu tun hat.“ De facto finde der Datentransport aber unterseeisch über Kabel statt.
„Die dann wiederum auf eine koloniale Kontinuität verweisen, weil diese Kabelrouten den früheren Schiffsrouten während des transatlantischen Versklavungsmarktes und dann den Telegrafen-Kabelrouten folgen. Das sind wirklich regelrechte Manifestationen, die aber auf einer visuellen Ebene uns so überhaupt gar nicht präsent sind.“
Digitale Welt erinnert sich „weiß“
Das Prinzip des Kolonialismus setzt sich im Digitalen fort – symbolisch und praktisch. Die digitale Welt erinnert sich „weiß“, sie spricht vor allem die Sprachen der reichen Industrieländer – und die Länder des Globalen Südens werden als Ressource betrachtet, die im Namen des technischen Fortschritts, sprich der Digitalisierung, genutzt werden können.
Nur: Wie kann man das stoppen? Lässt sich das Denkenüber digitale Technologien dekolonialisieren? Und wenn ja, dann wie?
Die Medienkünstlerin Tabita Rezaire beschäftigt sich mit dem Meer als Ort, der zur technischen Infrastruktur digitaler Kommunikation gehört. In Ihrer Arbeit "Deep Down Tidal" beschreibt sie es aber auch als Speicher verlorener Erinnerungen und Geschichten schwarzer Menschen.
Ein anderer Erfahrungshorizont, der zu einem anderen Verständnis von Technologie führt: Hier ist Technologie nicht vermeintlich neutral an einem bestimmten Ort vorhanden, um dann auf dieser Grundlage genutzt zu werden. Sondern: Technologien und der Ort, an dem sie zu finden sind, sind untrennbar mit menschlichen Bedürfnissen verbunden, wie frühe angolanische und sambische Kulturen zeigen.
„Zum Beispiel gibt es in der Arbeit Verweise auf Sonasand-Zeichnungen. Das sind frühe Algorithmen, die aber kontextuell ganz anders eingebettet sind und uns damit auch noch mal an die Hand geben, anders über Algorithmen und künstliche Intelligenz nachzudenken“, sagt Katrin Köppert.
„Insofern, als dass diese Zeichnungen immer im Zusammenhang mit Community Building entstanden sind. Das sind Muster, die in den Sand gezeichnet werden, um das Geheimwissen der Ältesten der Communities zu coden in gewisser Weise, also in Code zu überführen und das aber eingebunden in ein soziales Setting.“ Es gehe also darum, Sozialität mit zu gestalten.
Anderer Erfahrungshorizont, andere Inhalte
„Das geht über das hinaus, was wir in diesem Technik-Determinismus aktueller Diskurse ja permanent wiederfinden. Dieses Modellieren, was nur auf Berechenbarkeiten von Zukünften und so weiter hinausläuft, wird komplexer, angereichert. Und ich finde, in künstlerischen Arbeiten tauchen solche Bezüge auf und können uns damit sozusagen noch einmal so eine ganz andere Imaginationswelt eröffnen.“

Der pinke Stuhl, ein Werk von Tabita Rezaire, verweist auf medizinische Experimente an versklavten Frauen, soll aber auch einen Weg der Heilung aufzeigen.© imago / Pacific Press Agency
Kommunikationstechnik erhält so den Kontext zurück, der durch den kolonialen Blick verlorengegangen ist. Das eröffnet eine andere Vorstellungswelt – andere Inhalte werden möglich. Nicht zufällig gehört die Kunst von Tabita Rezaire zum Afrofuturismus.
„Afrofuturismus erlaubt, jenseits der Doktrin des Daseins zu denken, so dass es auch okay ist, in der Zukunft schwarz zu sein, ohne das ständig mit zu thematisieren“, sagt die Kommunikationswissenschaftlerin Natasha Kelly. „Afrofuturismus verfolgt die Frage, wie eine rassismusfreie Gesellschaft aussieht, und stellt sie visuell dar.“
Parallelen zum Afrofuturismus
Während viele bekannte weiße Science-Fiction-Erzählungen von einer bevorstehenden Apokalypse handelten, so Natasha Kelly, sei Afrofuturismus post-apokalyptisch. Der Kolonialismus habe die Geschichte der Schwarzen in ein Davor und ein Danach unterteilt.
„Die Apokalypse ist schon passiert. Das ist das Maafa gewesen, der Holocaust gegen Schwarze Menschen. Die Versklavung, Kolonialisierung ist schon die Apokalypse gewesen“, sagt sie.
„Wir sind schon im Danach angekommen, wir sind schon postapokalyptisch. Wir warten nicht noch drauf, dass noch was Größeres kommt, was unser Leben beeinflussen wird.“
Afrofuturismus sei ein Tool, um sich von der kognitiven Versklavung zu befreien und eine Welt zu kreieren, die im Grunde nichts mehr mit der zu tun hat, die wir kennen. „Black Lives Matter beispielsweise ist auch eine afrofuturistische Bewegung.“
Mai 2020. Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota. Der Afroamerikaner George Floyd wird Opfer tödlicher Polizeigewalt, nachdem er angeblich eine Schachtel Zigaretten mit einem falschen Geldschein bezahlt hat und sich weigert, in einen Polizeiwagen zu steigen.
Neun Minuten und 29 Sekunden lang kniet ein Polizist auf Floyds Hals, bis dieser stirbt. Es ist einer der jüngsten und aufsehenerregendsten Fälle von Gewalt gegen Schwarze. Er führt zu einem Aufschwung der Black-Lives-Matter-Bewegung. Millionen Menschen gehen auf die Straße. Es wird der größte Protest gegen Rassismus in den USA seit der Bürgerrechtsbewegung der 50er- und 60er-Jahre.
„Wenn sie fordern, dass die Polizei abgeschafft wird, dass sie nicht mehr finanziert wird, ist das ja eine Forderung, die dahingeht, sich vorzustellen, wie eine Gesellschaft ohne die Institution Polizei aussieht. Wie kann eine Gesellschaft ohne Polizei gestaltet werden? Wohin investieren wir dann das Geld, das normalerweise die Polizei bekommen würde, um eine andere Gesellschaftsstruktur zu schaffen? Das ist eine afrofuturistische Idee.“
Digitaler Raum als Chance
In der Digitalisierung sieht Natasha Kelly eine große Chance. Mehr noch: Ohne Digitalität gehe es nicht, sagt sie. Denn hier sei es leichter, neuen Ideen ein Gesicht zu geben. Auch wenn die digitalen Infrastrukturen nach kolonialem Muster gestaltet sind: In einer bestimmten Art und Weise der Nutzung liege dennoch die Chance, diese Strukturen zu überwinden – zumindest schon mal gedanklich.
„Der digitale Raum ist ja etwas, was genau diesen Freiraum schafft, wo Schwarze Menschen sich jenseits von Strukturen ihre eigenen Parameter auch schaffen können“, betont Kelly.
„Das ist genau das, worum es geht: Dass der digitale Raum diese Grenzenlosigkeit hat und digitale Kunst oder grafische Kunst und Grafikdesign – kannst du ja alles machen.“
Der preisgekrönte kanadische Künstler Quenton VerCetty etwa hat in einer digitalen Installation das Brandenburger Tor neu interpretiert. „Quenton VerCetty hat im Digitalen das Brandenburger Tor so umgestaltet, dass plötzlich oben auf dem Tor nicht ein Reiter von seinen Pferden, sondern eine afrikanische Königin von Löwinnen angeführt wird. Und unter dem Tor kommt dann der afrikanische König daher, und das Tor ist dann plötzlich eine Brücke über Wasser. Deswegen digital. Dass du diese Dinge im digitalen Raum findest, die sich eben mit realen Monumenten beschäftigen.“
"Integration war gestern"
„Integration war gestern", sagt Natasha Kelly. "Es geht nicht mehr darum, schwarze Menschen und People of Color in ein weißes Weltbild zu integrieren. Sondern es geht darum, eine Eigenständigkeit schwarzer Kunst, Kultur und damit auch Fragen der Ästhetik neu zu formulieren.“
Führen also Forderungen mit dem Ziel, allen Menschen Teilhabe an digitalen Diensten zu ermöglichen, überhaupt weit genug? Ist es nicht naiv anzunehmen, dass Gleichberechtigung erreicht würde, wenn die großen Tech-Unternehmen und Initiativen aus der Zivilgesellschaft nur dafür sorgten, dass so viele Menschen wie möglich ihre Sprachassistenten nutzen können? Muss Digitalität nicht viel mehr ganz neu gedacht werden? Als Chance, letztlich auch Gesellschaft neu zu denken?
Die Forderung nach Inklusion sei nicht falsch, sagt Buse Cetin, die zu den sozialen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz forscht. Aber auch ihr geht sie nicht weit genug.
„Ich betrachte Technologie und insbesondere Künstliche Intelligenz als Ausgangspunkt, die sozialen Strukturen und den Kontext, in dem wir leben, zu diskutieren und zu hinterfragen – und auch als Gelegenheit, ihn gemeinsam zu verändern.“
Rolle von Technologie neu denken
Derzeit funktioniere Technologie so, dass es ein Zentrum und eine Peripherie gebe. Das Zentrum, die großen Tech-Firmen des globalen Nordens, bestimmten das Design der Technologie. Die Empfänger an der Peripherie hätten dabei nicht viel Mitspracherecht.
Man müsse die Auswirkungen von KI-Technologien entmystifizieren, sagt Buse Cetin. Das heißt: genau zeigen, wie die Technologie funktioniert und was sie bewirkt.
„Was wir sehen können, ist, dass wir Probleme mit Technologie haben, wie sie entworfen und produziert wird“, sagt sie. „Aber was machen wir dann damit? Worin besteht die Lösung und welche verschiedenen Visionen können wir entwickeln? Diesen Raum wollten wir kultivieren. Wir haben nicht die Antwort darauf, wie es sein sollte, sondern eine Vielzahl von Antworten, die vielleicht miteinander in Beziehung stehen.“
Auf der von Buse Cetin mitgegründeten Website „Dreaming Beyond AI“ sind die ersten dieser Antworten versammelt – mehr als 20 Forscher, Künstler, Designer, Aktivisten und politische Entscheidungsträger laden zur Debatte darüber ein.
Wie also können wir Technologie neu denken? Welche Aufgaben soll sie für uns lösen? Ist sie immer schon in erster Linie eine Waffe gewesen, wie etwa Stanley Kubrick in „2001 – Odyssee im Weltraum“ nahelegt?
Weniger Waffe, mehr Geschenkebox
„Vielleicht war die erste und wichtigste Technologie keine Waffe, sondern ein Empfänger. Menschen müssen etwas zu essen sammeln. Sie haben Sachen, die sie gern herumtragen möchten. Was tun Sie also, wenn Sie kein Gefäß haben, keinen Raum, der Dinge aufbewahren kann? Das ist für mich eine Technologie. Wir versuchen, dieses Konzept der Tragetasche zu kreieren, bei dem ich mir vorstelle, ich würde eine Geschenkbox für Sie erstellen.“
Und bis es soweit ist? Bis Technologie mehr Geschenkbox ist und weniger Waffe und Machtinstrument? Bis sich die digitalen Strukturen so verändert haben, dass sie nicht mehr ausgrenzen? Bis die Dominanz der großen Tech-Unternehmen gebrochen ist? Bis dahin braucht es die Aktivitäten der Zivilgesellschaft, einen gleichberechtigten Zugang zu digitalen Diensten wie etwa Sprachassistenten zu schaffen.
„Ich denke, das ist genau die Richtung, in die wir uns in Zukunft bewegen sollten“, meint Nakeema Stefflbauer vom Tech-Netzwerk Techincolor.eu. „Sicherlich tun diejenigen von uns, die im westlichen Technologiesektor tätig sind, alles, was sie können, um Inklusion und Vielfalt voranzutreiben.“ Aber das sei ein langsamer Prozess.
„Und es ist ebenso hilfreich, wenn nicht sogar noch hilfreicher, auf Programme verweisen zu können, die diese Arbeit ebenfalls erledigen, und die das Internet de facto zu einem integrativeren und vielfältigeren Ort machen, sodass verschiedene Arten von Menschen Räume finden, die einladend sind und leichter auf Informationen in ihrer Muttersprache zugreifen können.“






