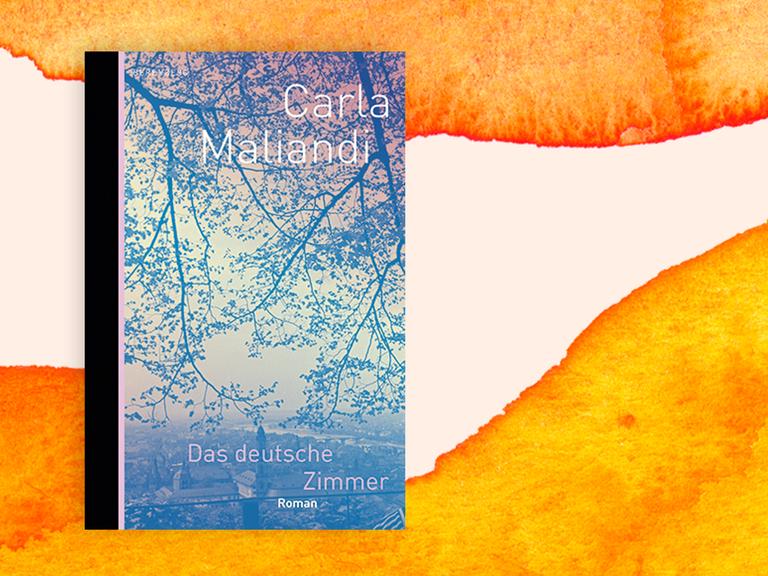Deniz Ohde: "Streulicht"
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020
288 Seiten, 22 Euro
Mich bekommt ihr nicht klein
05:28 Minuten

Der Vater trinkt, das Rebellische der Mutter ist verschwunden und in der Schule wird „ausgesiebt“. Die Ich-Erzählerin in Deniz Ohdes Roman „Streulicht“ wird in den 90er-Jahren in Frankfurt am Main groß und trotzt der Abwertung und dem Rassismus.
Es sickert in das Mädchen ein, wie die Luft, die es umgibt: Mit seinem ungewöhnlichen Vornamen, der türkischen Mutter und dem deutschen Arbeitervater ist es weniger wert als andere. Es wird geschurigelt, ermahnt, abgestempelt und schließlich verdrängt. Der Vater, der nichts wegwerfen kann und alle Ängste im Suff erstickt, empfiehlt seiner Tochter äußerste Anpassung. Er selbst macht sich unsichtbar in dem Ort am Industriepark, wo er seit 30 Jahren Aluminiumbleche in eine Beize taucht.
"Das ist nix für mich" und "Das brauchen wir nicht" sind Standardsätze, mit denen er seine Familie in Schach hält. Das Aufmüpfige der Mutter, die als Jugendliche immerhin aus ihrem Dorf an der Schwarzmeerküste weggelaufen war, scheint erschöpft. Den Gewaltattacken ihres Mannes kann sie kaum etwas entgegensetzen. Das Gleichgewicht des Haushalts, in dem es nicht einmal gemeinsame Mahlzeiten gibt und das Fernsehen den Tagesrhythmus skandiert, ist prekär. Und über alles wird geschwiegen.
Die Heldin beißt sich durch
Es sind diese Prozesse, die Deniz Ohde in ihrem Debüt so eindrucksvoll vermittelt. "Streulicht" lautet der Titel, inspiriert von den Abstrahlungen der Industrieanlagen, in deren Nachbarschaft sich das Heranwachsen ihrer Ich-Erzählerin abspielt. Und genauso feinstofflich, wie sich das diffuse Licht und die schwere, saure Luft der Umgebung verbreiten, verlaufen auch die Mechanismen der Ausgrenzung. Den Rahmen des Romans bildet ein Besuch der inzwischen erwachsenen Heldin bei ihrem verwitweten Vater aus Anlass einer Hochzeit.
Kaum kommt sie in ihrem Heimatort an, umfängt sie der markante Geruch der Fabriken. In dichten Rückblenden fächert sich dann die Geschichte ihrer Kindheit auf. Zwar bildet sie mit ihren Freunden Pikka und Sophia eine Gemeinschaft, aber den Anforderungen der Lehrer kann das verschüchterte Mädchen nie genügen. Es werde jetzt "ausgesiebt", heißt es im Gymnasium, und prompt trifft es die wehrlose Heldin. Auch ihre Eltern, die alle rassistischen Übergriffe verleugnen, sind hilflos. Doch irgendetwas lässt sie Festhalten am Bildungsgedanken. Sie beißt sich durch.
Kaum kommt sie in ihrem Heimatort an, umfängt sie der markante Geruch der Fabriken. In dichten Rückblenden fächert sich dann die Geschichte ihrer Kindheit auf. Zwar bildet sie mit ihren Freunden Pikka und Sophia eine Gemeinschaft, aber den Anforderungen der Lehrer kann das verschüchterte Mädchen nie genügen. Es werde jetzt "ausgesiebt", heißt es im Gymnasium, und prompt trifft es die wehrlose Heldin. Auch ihre Eltern, die alle rassistischen Übergriffe verleugnen, sind hilflos. Doch irgendetwas lässt sie Festhalten am Bildungsgedanken. Sie beißt sich durch.
Wie ein Menetekel flackert die Selbstverbrennung
In einer präzisen, zupackenden Sprache nimmt Ohde ihren Schauplatz in den Blick: die rauchenden Fabrikschlote, die schmutzigen Straßen mit ihren Eckkneipen und Billigläden, die aufgeräumten Vorgärten und Hobbykeller der kleinbürgerlichen Freunde und die klebrige, zugestellte Wohnung ihrer Eltern. Immer wieder umkreist sie diese beiden Figuren und leuchtet ihre Gebrochenheit aus, ohne sie zu denunzieren.
Und schließlich gelingt der 1988 in Frankfurt geborenen Autorin ein Roman über ein Sujet, das in der deutschen Literatur nur selten zur Sprache kommt: die Klassengesellschaft. Sie erzählt keine emanzipatorische Entwicklungsgeschichte, keine Spur von einem triumphalen Gestus. Wie ein Menetekel flackert die Selbstverbrennung einer Frau Mitte der 1990er-Jahre durch die Handlung – das Foto mit dem verzerrten Gesicht der Toten hat sich in das Bewusstsein der Heldin eingebrannt. Ob ihr die Befreiung gelingt? Zumindest hat sie jetzt eine Stimme.