Der Freiheitsbewegung von 1989 ein Denkmal
532 Mal scheiterte im ersten Anlauf der Versuch, Freiheit und Einheit, die deutschen Revolutionsjahre 1848 und 1989/90 auf einen künstlerischen Nenner zu bringen. Das Vorhaben eines nationalen Denkmals war "völlig überladen", wie der Staatsminister für Kultur, Neumann, dieser Tage zu Recht einräumte. Deshalb will man sich nun bei der zweiten Ausschreibung mit der Würdigung der Jahre 1989/90 bescheiden.
Diese Bescheidenheit ist zwar nicht fehl am Platze, wird aber am falschen Ort geübt, soll doch das Denkmal auf dem Berliner Schlossplatz errichtet werden. Dort revoltierte das Volk zwar 1848, nicht jedoch 1989.
Diese Widersprüchlichkeit der Konsequenz wirft die Frage auf, ob die Diagnose des Staatsministers die richtige ist. Wenn man die gescheiterten Entwürfe des ersten Durchgangs Revue passieren lässt, so sprach aus ihnen nicht ein Zuviel an Geschichte, wie Herr Neumann mutmaßt, sondern ein Zuwenig an Geschichtsbewusstsein. Sie waren das Stahl und Stein gewordene Bekenntnis des ehemaligen Bundeskanzlers Schröder, kein Pathos zu können. Sie widmeten sich ihrer Aufgabe mit der Distanz einer Abstraktion, die keine Botschaft hat, oder einer Ironie, die über den ostdeutschen Umbruch lediglich das Fluidum westdeutscher Postmoderne verströmte. Eine goldene Banane als "selbstbewussten Ausdruck des individuellen Freiheitsdrangs" zu nehmen oder die Schlümpfe als Freiheitshelden zu feiern, das ist abgestandener Sponti-Humor, der heute genauso deplatziert wirkt, wie seinerzeit die Abfälligkeit, mit der westdeutsche Linke auf die Revolutionäre des Herbstes und den Einheitswillen des Volkes reagierten.
Doch woher rührt diese Unfähigkeit zum pathetischen Bekenntnis? Der britische Historiker Timothy Garton Ash hat einmal angemerkt, dass
"die Unternehmung, bei der die Deutschen wahrhaftig Weltmeister sind, die kulturelle Reproduktion der Terrorvarianten ihres Landes ist. Keine Nation ist brillanter, beharrlicher und erfinderischer im Erforschen, Kommunizieren und Repräsentieren ( ... ) ihrer eigenen vergangenen Verbrechen."
Mit seinen Helden hingegen tut sich dieses Land ungleich schwerer, wahrscheinlich, weil es so wenige davon hat und der eingeübte Reflex hinter jeder nationalen Heldengeschichte ein Verderben vermutet. So war denn auch von der Schwunghaftigkeit, mit der 1989 das Aufbegehren der Wenigen in die friedliche Revolution der Vielen mündete, in den Entwürfen nichts zu spüren.
Wenn sich die Ausschreibung nun auf das Ende der DDR konzentriert, so sollte nicht der politische Fehler, der seinerzeit gemacht wurde, künstlerisch reproduziert werden. "Wir sind das Volk" und "Wir sind ein Volk" waren zwei verschiedene Botschaften. Ersteres war die Parole von Bürgern, die ihre Geschicke selbst in die Hand nahmen, letzteres der Wunsch eines Volkes nach Wiedervereinigung. Will man nicht das eine durch das andere im Gedenken dominieren, wie es durch den Feiertag am 3. Oktober geschehen ist, so spricht vieles dafür, beidem in jeweils gesonderter Form Ausdruck zu verleihen. Diese Klarheit der Vorgabe würde das Verfahren vor einer weiteren Peinlichkeit bewahren, zumal, wenn es sich in der tatsächlich angebrachten Bescheidenheit übt, nur ein Freiheitsdenkmal auszuloben.
Ein Denkmal für die deutsche Einheit hingegen muss nicht neu entworfen werden. Die Skulptur "Berlin", die das Künstlerpaar Matschinsky-Denninghoff zur 750-Jahrfeier 1987 auf dem Westberliner Tauentzien errichtet hat, sollte die Teilung der Stadt symbolisieren. Zwei Jahre später war die Teilung überwunden. Die ineinander verschlungenen Kettenglieder aus Chromnickelstahl, die zuvor die Verbundenheit trotz Mauer versinnbildlichten, stehen seitdem für eine Vereinigung, mit der nicht alles eins geworden ist, die aber gleichwohl Stabilität ausstrahlt. Die Skulptur ist, was für ein nationales Denkmal nicht unwesentlich ist, eine Attraktion. Sie wurde zu einer Zeit installiert, als die Einheit im Westen kein bewegendes Thema mehr war. Nach 20 Jahren wäre es an der Zeit, sie an den Ort zu bringen, von dem die Einheitsbestrebung ausging – in den Ostteil der Stadt, ins Zentrum.
Dieter Rulff, Journalist, Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Von 2002 bis 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die "Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte". Seit 2006 ist er Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
Diese Widersprüchlichkeit der Konsequenz wirft die Frage auf, ob die Diagnose des Staatsministers die richtige ist. Wenn man die gescheiterten Entwürfe des ersten Durchgangs Revue passieren lässt, so sprach aus ihnen nicht ein Zuviel an Geschichte, wie Herr Neumann mutmaßt, sondern ein Zuwenig an Geschichtsbewusstsein. Sie waren das Stahl und Stein gewordene Bekenntnis des ehemaligen Bundeskanzlers Schröder, kein Pathos zu können. Sie widmeten sich ihrer Aufgabe mit der Distanz einer Abstraktion, die keine Botschaft hat, oder einer Ironie, die über den ostdeutschen Umbruch lediglich das Fluidum westdeutscher Postmoderne verströmte. Eine goldene Banane als "selbstbewussten Ausdruck des individuellen Freiheitsdrangs" zu nehmen oder die Schlümpfe als Freiheitshelden zu feiern, das ist abgestandener Sponti-Humor, der heute genauso deplatziert wirkt, wie seinerzeit die Abfälligkeit, mit der westdeutsche Linke auf die Revolutionäre des Herbstes und den Einheitswillen des Volkes reagierten.
Doch woher rührt diese Unfähigkeit zum pathetischen Bekenntnis? Der britische Historiker Timothy Garton Ash hat einmal angemerkt, dass
"die Unternehmung, bei der die Deutschen wahrhaftig Weltmeister sind, die kulturelle Reproduktion der Terrorvarianten ihres Landes ist. Keine Nation ist brillanter, beharrlicher und erfinderischer im Erforschen, Kommunizieren und Repräsentieren ( ... ) ihrer eigenen vergangenen Verbrechen."
Mit seinen Helden hingegen tut sich dieses Land ungleich schwerer, wahrscheinlich, weil es so wenige davon hat und der eingeübte Reflex hinter jeder nationalen Heldengeschichte ein Verderben vermutet. So war denn auch von der Schwunghaftigkeit, mit der 1989 das Aufbegehren der Wenigen in die friedliche Revolution der Vielen mündete, in den Entwürfen nichts zu spüren.
Wenn sich die Ausschreibung nun auf das Ende der DDR konzentriert, so sollte nicht der politische Fehler, der seinerzeit gemacht wurde, künstlerisch reproduziert werden. "Wir sind das Volk" und "Wir sind ein Volk" waren zwei verschiedene Botschaften. Ersteres war die Parole von Bürgern, die ihre Geschicke selbst in die Hand nahmen, letzteres der Wunsch eines Volkes nach Wiedervereinigung. Will man nicht das eine durch das andere im Gedenken dominieren, wie es durch den Feiertag am 3. Oktober geschehen ist, so spricht vieles dafür, beidem in jeweils gesonderter Form Ausdruck zu verleihen. Diese Klarheit der Vorgabe würde das Verfahren vor einer weiteren Peinlichkeit bewahren, zumal, wenn es sich in der tatsächlich angebrachten Bescheidenheit übt, nur ein Freiheitsdenkmal auszuloben.
Ein Denkmal für die deutsche Einheit hingegen muss nicht neu entworfen werden. Die Skulptur "Berlin", die das Künstlerpaar Matschinsky-Denninghoff zur 750-Jahrfeier 1987 auf dem Westberliner Tauentzien errichtet hat, sollte die Teilung der Stadt symbolisieren. Zwei Jahre später war die Teilung überwunden. Die ineinander verschlungenen Kettenglieder aus Chromnickelstahl, die zuvor die Verbundenheit trotz Mauer versinnbildlichten, stehen seitdem für eine Vereinigung, mit der nicht alles eins geworden ist, die aber gleichwohl Stabilität ausstrahlt. Die Skulptur ist, was für ein nationales Denkmal nicht unwesentlich ist, eine Attraktion. Sie wurde zu einer Zeit installiert, als die Einheit im Westen kein bewegendes Thema mehr war. Nach 20 Jahren wäre es an der Zeit, sie an den Ort zu bringen, von dem die Einheitsbestrebung ausging – in den Ostteil der Stadt, ins Zentrum.
Dieter Rulff, Journalist, Jahrgang 1953, studierte Politikwissenschaft in Berlin und arbeitete zunächst in der Heroinberatung in Berlin. Danach wurde er freier Journalist und arbeitete im Hörfunk. Weitere Stationen waren die "taz" und die Ressortleitung Innenpolitik bei der Hamburger "Woche". Von 2002 bis 2005 arbeitete Rulff als freier Journalist in Berlin. Er schreibt für überregionale Zeitungen und die "Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte". Seit 2006 ist er Redakteur der Zeitschrift "Vorgänge".
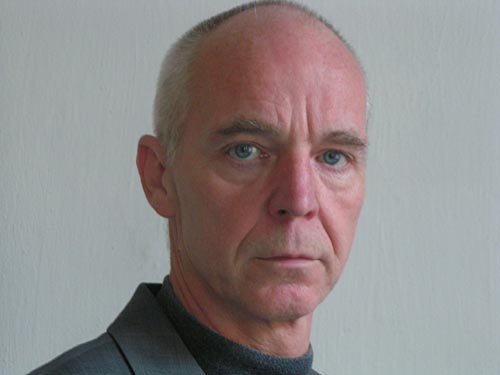
Dieter Rulff© privat