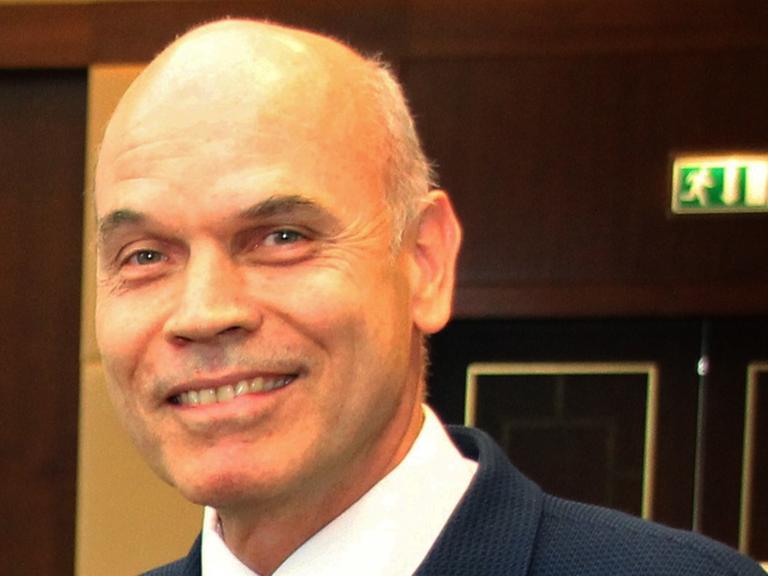Worte und Politik

Diese Woche hat Bundespräsident Gauck die Massaker an Armeniern vor 100 Jahren erstmals beim Namen genannt: Völkermord. Diese sprachliche Handlung sei zugleich ein moralischer Akt der Anerkennung, kommentiert Thorsten Jantschek. Man könne Benennen und Anerkennen nicht auseinanderdividieren.
Dass mit Worten Politik gemacht wird, ist ebenso trivial wie die Tatsache, dass mit Sprache Handlungen vollzogen werden. Wenn jetzt, einhundert Jahre nach den Massenverbrechen an den Armeniern, das Wort „Völkermord" benutzt wird, offiziell benutzt wird, von der Regierungskoalition – nach langem schweren Ringen, wie es heißt –, vom Bundespräsidenten und auch in der Debatte am Freitag im Deutschen Bundestag, dann ändert das an den historischen Fakten vor der Hand denkbar wenig.
Das macht keinen Menschen wieder lebendig. Und doch ist das unter der Hand geschichts- und damit auch sprachpolitisch ein Unterschied ums Ganze. Die Verwendung des Genozidbegriffs verändert nämlich unsere Sichtweise auf ein historisches Geschehen, und das ist eben weit mehr als die Interpretation einer historischen Tatsache. Vielmehr stellt sie – wissenschaftstheoretisch gesprochen – eine historische Tatsache allererst her. Denn der Begriff „Völkermord" funktioniert wie ein Raster. Und die „Erfassung durch ein Raster", so schreibt die amerikanische Philosophin Judith Butler „bedeutet, dass um eine Handlung herum ein Rahmen konstruiert wird, sodass der Betrachter unvermeidlich in diesem Rahmen schon einen Schuldigen sieht." Wessen Schuld wird also benennbar?
Klar, die der Täter. In diesem geschichtspolitischen Sprechakt geht es natürlich einerseits darum, die Türkei dazu zu bewegen, sich der historischen Schuld zu stellen, um Versöhnungsprozesse von Türken und Armeniern zu unterstützen. Das ist die eine Dimension. Die andere richtet sich nach Innen: Schließlich hat Deutschland vor einhundert Jahren weggeschaut, als das Osmanische Reich als Bündnispartner Hunderttausende Menschen in die syrische Wüste deportierte.
Ein moralischer Akt der Anerkennung
Ein historisches Geschehen als „Völkermord" zu benennen, eine sprachliche Handlung also, ist zugleich ein moralischer Akt der Anerkennung. Man kann hier Benennen und Anerkennen nicht auseinanderdividieren. Diesen Zusammenhang hat Bundespräsident Gauck am Donnerstag explizit gemacht. "Achten wir aber darauf", sagte er, „dass sich diese Debatte nicht auf Differenzen über einen Begriff reduziert. Es geht vor allem darum - und sei es nach 100 Jahren - die planvolle Vernichtung eines Volkes in ihrer ganzen schrecklichen Wirklichkeit zu erkennen, zu beklagen und zu betrauern. Sonst verlieren wir den Kompass für unsere Orientierung und die Achtung vor uns selbst."
Die Dimensionen der Anerkennung sind in diesem Falle weitreichend, und sie wirken weit über den Anspruch der Opfer und ihrer Nachkommen auf materielle Wiedergutmachung hinaus. Aber – und das macht diese Anerkennung politisch brisant – sie beinhalten eben auch genau diesen – ökonomischen – Anspruch. Anerkennung in diesem Sinne ist aber nicht nur eine Sprachhandlung, in der sich etwas „für" die Opfer und ihre Nachfahren artikuliert, sondern auch ihren – wieder wissenschaftstheoretisch gesprochen – ontologischen Status betrifft, es betrifft auch die Rede „über" die Opfer und ihre Nachkommen.
Man konstituiert sie, wie Judith Butler gezeigt hat, als „Volk" im Sinne eines Rechte tragenden Subjekts, an dessen kollektives Leiden fortan erinnert wird. Das bedeutet mehr, als eine Vielzahl von Menschen als Opfer von Gewaltverbrechen wahrzunehmen. Die Toten werden in besonderer Weise betrauerungswürdig. Eine historische Wahrheit wird hier nicht nur erkannt, sondern erinnerungspolitisch hergestellt.