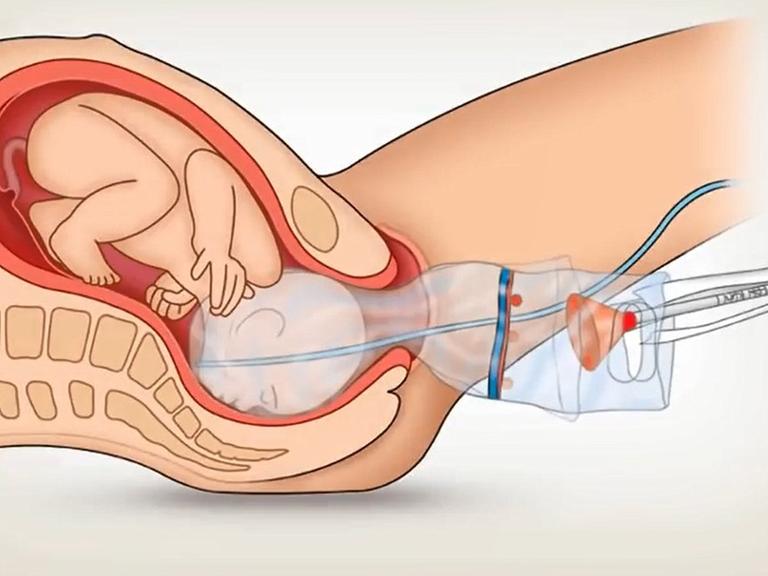Wie es weitergeht mit den Brunnenbauern in Bangladesch, hören Sie im zweiten Teil von "Die Weltverbesserer" im Podcast der Weltzeit.
Die Mutter der Lepra-Kranken
21:19 Minuten

Am 25. September 2019 wird der „Alternative Nobelpreis“ verliehen. Wir wollten nicht auf die Right-Livelihood-Stiftung warten und haben selbst nach Menschen gesucht, die sich für die „Gestaltung einer besseren Welt“ einsetzen. Einige hatten Erfolg, wie Ruth Pfau.
Es ist der 7. Dezember 2002. Ich bin in Karatschi – der größten Stadt Pakistans. In einer Krankenhauskapelle. Neben mir sitzt eine weißhaarige Frau, gekleidet in einen lachsroten Shalmar Khamiz, das traditionelle Kleid Pakistans.
Kapitel 1 - Ärztin, Nonne, Nationalheldin
Sie heißt Ruth Pfau, ist Ärztin und Nonne. Nach der Andacht führt sie mich in ihre kleine Kammer: Bett, Tisch, zwei Stühle, ein Bücherregal. Wir frühstücken Chapati – Fladenbrot – und Tee.
Ruth Pfau erzählt, wie sie 1960 nach Pakistan kam. Als 30-Jährige wollte sie unbedingt dorthin, wo es Menschen besonders schlecht ging: nach Karatschi. Hier strandeten damals hunderttausende Flüchtlinge aus Indien, Menschen verhungerten auf offener Straße. Und draußen in der Wüste vegetierten in elenden Camps all die dahin, vor denen jeder Angst hatte: die Leprakranken mit ihren verstümmelten Händen, Füßen und Gesichtern.
"Die waren wirklich Aussätzige, lebten vom Betteln, und wenn sie geschnappt wurden, lud sie die Stadtverwaltung in Lastwagen, fuhr sie in die Wüste und kippte sie aus. Und dann kämpften sie sich zu Fuß bis nach Karatschi zurück."
Der Schriftsteller Josef Reding besuchte in den 60er-Jahren die Lepra-Gettos Karatschis und berichtete im Radio darüber.
"Wir haben eine einzige Ärztin gesehen, die sich dieser Phalanx von 24.000 Leprakranken entgegenstemmte: Ruth Pfau. Sie hatte eine Handvoll Injektionsampullen und eine Schürzentasche voll Medikamente. Sie war auch am Ende ihrer Kraft. Nachts kamen die Ratten und fraßen die alten Leprabefallenen an und liefen dann zu Säuglingen, die gesund von kranken Eltern mit in die Kolonie gebracht worden waren."
Als Ruth Pfau selbst über die Zeit erzählt, schwingt immer noch ihre Entschlossenheit und Ungeduld mit. Sie ist damals, als ich sie treffe, 73 und strahlt eine natürliche Autorität aus, Sanftmut und zugleich Härte. Als Einzelkämpferin schreibt sie in Pakistan die weltweit größte Erfolgsgeschichte im Kampf gegen die Lepra.
Nach dem Medizin-Studium ins Lepra-Getto
Alte Bilder zeigen ein Mädchen aus bürgerlichem Elternhaus, das sich seines guten Aussehens und seiner Intelligenz bewusst war. Sie studierte Medizin – in Mainz und Marburg. Fand den christlichen Glauben und ließ sich 1951 taufen – evangelisch. Später wechselte sie zur katholischen Kirche. Mit Folgen: Als ihr Freund sie heiraten wollte, sei da schon diese Berufung gewesen, die gläserne Wand zwischen ihr und dem geliebten Mann. Am liebsten wäre sie Jesuitin geworden, sagt Ruth Pfau. Weil die Jesuiten keine Frauen nehmen, wurden es die "Töchter des Herzens Mariä". Ein katholischer Frauenorden, in dem sie zwei Mitstreiterinnen fand, um ihren Kampf gegen die Lepra in einem Getto von Karatschi zu beginnen.
"Dieses ganze Lepra-Getto war ja die Inkorporation des Stigmas. Da traute sich kein Mensch rein, kein Mensch, kein Arzt. Niemand. Auch im ganzen Lande. Als wir zum ersten Mal in eine Provinz kamen, fanden wir immer wieder das Gleiche: In Beluchistan ein sechsjähriger Junge, der in der Wüste ausgesetzt worden ist, auf dass ihm die wilden Tiere das täten, was das Dorf sich nicht traute. Im Himalaya ein 14-jähriges Mädchen, das zwei Jahre in der Höhle eingemauert war. Also, das war gang und gäbe um diese Zeit. In Ranikot durfte die Leprafamilie nicht an den Brunnen, und das ist dann natürlich das Todesurteil für die ganze Familie, wenn nicht irgendein Wunder geschieht."
Mildtätige Pflege würde hier wenig helfen, erkannte die Ärztin und fing an, systematisches Management öffentlicher Gesundheit zu betreiben. Von Karatschi aus wollte sie die Lepra in Pakistan mit Stumpf und Stiel ausrotten.
"Dann haben wir zunächst einmal uns eine Landkarte gekauft, haben die auf einem Softboard aufgezogen und haben für jeden Patienten eine bunte Stecknadel gesteckt, wo er herkam. Und da ergaben sich schon klare Herde."

Ruth Pfau untersucht 1960 die Augen eines Lepra-Patienten in Pakistan.© DAHW
Bei den Infektionsherden sollte die Ausrottung der Krankheit ansetzen – mit Aufklärung, Suche nach Erkrankten und deren Behandlung mit den damals neuen Medikamenten, die die Nervenkrankheit Lepra heilbar gemacht hatten. Voraussetzung war allerdings ein auf ganz Pakistan zielendes, ein nationales Lepraprogramm.
"Und dazu brauchten wir ein landesweites Netz, und das kann eine freiwillige Hilfsorganisation wie unsere ja nicht aufbauen. Also das Nächste war dann, die Regierung zu überreden, dass sie in ihrem Gesundheitsdienst eine Lepra-Abteilung anschließen. Und das haben wir in den nächsten Jahren dann auch gemacht, haben ihnen die Leute ausgebildet. Unsere Lepra-Assistenten sind zu 80 Prozent Regierungsangestellte. Wir haben ihnen dann die diagnostischen Kriterien beigebracht, wie man mit den Dorfgemeinschaften umgeht, wenn man so ein Thema angeht wie die Lepra, wie man dieses Ausgestoßen-Sein, wie man dem entgegenarbeitet, welche aggressiven Reaktionen vonseiten der Gemeinschaft, worauf man vorbereitet sein muss."
Ruth Pfau putzte keine Klinken bei Bürokraten in Islamabad, um Pakistans Staatsapparat zu mobilisieren für den Kampf gegen die Lepra. Sie ging zum Chef persönlich – zu Zia-ul-Haq, islamistischer Diktator Pakistans von 1977 bis 1988. Eine ungewöhnliche Freundschaft begann.
"Also, Zia und ich haben uns wirklich gemocht. Ich habe ihn wirklich sehr gemocht. Er war jemand, den man immer ansprechen konnte für Randgruppen, für Menschen, die sonst keine Chancen hatten. Er wird auch heute noch in den Berggebieten, die sonst nie an die Entwicklung angeschlossen sind, zärtlich geliebt. – Ich meine, wir haben uns durchaus nicht unkritisch gemocht. Er war sehr zweigleisig wahrscheinlich. Also sein allerbester Freund, mit dem ich sehr gut befreundet war, der hat immer gesagt: Es gibt zwei Zia, du kennst nur einen. Das ist, was ich glaube. Aber diesen einen Zia, den gab es eben auch. Der hatte eine geistesbehinderte Tochter, die er ganz unkompliziert, ganz unkompliziert auch bei Empfängen und so ... Wenn die da reinkam, in keiner Weise, dass er dazu nicht gestanden hätte, und hat enorm viel getan für die Behindertenfürsorge im Lande."
Zia-ul-Haq gliederte seinem Gesundheitsministerium eine Lepraabteilung an, deren Leitung Ruth Pfau übernahm. Somit wurde die deutsche Nonne 1979 pakistanische Staatssekretärin. In Karatschi baute sie das "Marie Adelaide Lepra-Zentrum" auf. Hier wurden Tausende Lepra-Assistenten ausgebildet, die bis heute in Himalaja-Tälern oder der Wüste Belutschistans die Bevölkerung aufklären, Kranke identifizieren und behandeln. 1996 hatte Pakistan als eines der ersten Länder Asiens die Lepra unter Kontrolle. Vor allem dank Ruth Pfau.
Ruth Pfau hilft ab 80er-Jahren auch in Afghanistan
Die deutsche Ärztin arbeitete aber längst am nächsten Ziel: Seit den 80er-Jahren hilft sie auch Patienten im Nachbarland Afghanistan. Immer wieder bereiste sie das damals von der Sowjetunion besetzte Land, geschützt von den islamistischen Mudschahedin-Kämpfern.
"Man musste ein Gebiet durchfahren, in das die Russen Einsicht hatten, und die waren ja damals mit diesen Hubschraubern unterwegs. Und da konnte man nur hoffen, wenn man da über dieses Gebiet eben im möglichsten Hochtempo raste, dass um die Zeit kein Hubschrauber in der Luft war. Aber wenn man dann einmal da durch ist, dann ist man ja im Hochgebirge, und da können Hubschrauber nicht mal landen. Die sind so eng, die Schluchten oft, und da waren auch die Mudschahedin voll in Kontrolle."
Natürlich besuchte die rastlose Ärztin immer wieder auch Deutschland und sammelte Geld. Die "Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe" hat Ruth Pfaus Arbeit schon in den 60er-Jahren unterstützt. Das katholische Hilfswerk Misereor fördert das von ihr mitbegründete Lepraprogramm Afghanistans.
Der Muezzin draußen ruft zum zweiten Gebet. Bei unserem Frühstück am 7. Dezember 2002 habe ich Ruth Pfau als eine Frau erlebt, die so gar nichts von jenem leicht blauäugigen Optimismus an sich hat, der viele Machergestalten kennzeichnet. Auch fröhliches Gottvertrauen sei ihr immer fremd gewesen. Nein, angesichts von Elend und Unterdrückung habe sie oft mit Depressionen gekämpft und sogar an Selbstmord gedacht. Aber das wäre ja blöd gewesen, sagt sie und lächelt ein letztes Mal an diesem Morgen.
Am 10. August 2017 stirbt Ruth Pfau mit 87 Jahren in Karatschi. Sie erhält ein Staatsbegräbnis. Die pakistanische Regierung spricht von einer "Nationalheldin", im Volksmund gilt sie als "Pakistans Mutter Teresa". Ihre Wohnräume sind heute ein Museum. Ruth Pfaus Vermächtnis: Nur noch rund 300 neue Leprakranke pro Jahr werden in Pakistan gefunden, fast alle im Frühstadium. Im Nachbarland Indien dagegen werden jährlich noch 140.000 Leprakranke entdeckt – viele bereits schwer verstümmelt.
Kapitel 2 - Ein Wasseringenieur in Bolivien
Es geht steil nach oben. Vielleicht tausend Treppenstufen – in ziemlich dünner Luft. Guillermo Caliza und ich keuchen. Wir sind unterwegs in Boliviens Hauptstadt La Paz – dem höchstgelegenen Regierungssitz der Welt. Hier – in fast 4000 Metern Höhe – spüren die Menschen die globale Erwärmung immer stärker: Die Andengletscher schmelzen, der Wasserspiegel der Flüsse schwankt gewaltig, die Regenzeiten werden kürzer und heftiger, die Trockenperioden länger – wie 2016, als die Region eine dramatische Dürre erlebte und rund zwei Millionen Einwohner kaum noch Trinkwasser hatten.
Guillermo Caliza will hier Abhilfe schaffen. Der junge, schüchterne Mann arbeitet als Wasserbauingenieur für die kleine Hilfsorganisation Red Habitat. Immer wieder beschlägt seine Brille, als wir hinauf klettern zu einem seiner Vorzeigeprojekte. Ob ich die rot-grauen Ziegelhäuser sähe, fragt er – dort oben, wo der Hang noch steiler werde, das sei das Barrio Chulluma, eins der vielen Armenviertel, die an den Hängen von La Paz kleben. In solchen Vierteln helfe Red Habitat und schaffe Bewusstsein für verantwortungsbewussten Umgang mit der knappen Ressource Wasser.
Am Eingang des Barrios wartet bereits Tomasa Gutierrez Choque, die Präsidentin Chullumas, eine Art Ortsvorsteherin. Freudig umarmt sie den schmalen Ingenieur und deutet auf eine solide Betontreppe, auf die befestigten Wege und stabilen Hausfundamente. Ohne Guillermo hätten sie das alles nicht, sagt Tomasa Gutierrez Choque.

Tomasa Gutierrez Choque und andere Bürger des Barrios Chulluma in La Paz leben am Steilhang und versorgen sich selbst mit Wasser.© Thomas Kruchem
"Dank seiner Hilfe ist Chulluma viel besser geschützt als die meisten Siedlungen hier. Oberhalb von uns haben sich Leute angesiedelt, die sonst nirgendwo Platz fanden. Sie leben dort völlig ungesichert, haben ihre Häuser in den Lehm am Abhang hineingegraben. Ich habe schon so viele Häuser abrutschen sehen – samt allen Möbeln und Kleidern. Und ich weiß noch, wie ein schwerer Wolkenbruch einem Haus unterhalb von meinem das Dach wegriss. Die Bewohner konnten fliehen. Sie verloren aber ihre ganze Einrichtung und mussten sich weiter weg ein neues Haus bauen."
Die Region hier sei geologisch noch jung, erklärt Ingenieur Guillermo Caliza.

Ingenieur Guillermo Caliza und eine Kollegin von der Hilfsorganisation „Red Habitat“.© Thomas Kruchem
Geröll und Sand seien immer in Bewegung. Bei Starkregen komme es deshalb immer wieder zu fatalen Erdrutschen an den Hängen von La Paz. Ein Phänomen, das durch den Klimawandel verstärkt wird. Gleichzeitig weiten sich die Trockenperioden aus, das Trinkwasser wird knapp. Dagegen entwickeln Guillermo Caliza und seine Hilfsorganisation Red Habitat Lösungen. Hier im Armenviertel Chulluma, zum Beispiel, gibt es eine ergiebige Quelle, die bis vor einiger Zeit jedoch ständig verschmutzt war. Red Habitat hat die Quelle professionell eingefasst. Ich sehe eine Filteranlage, einen großen Tank und Leitungen, die in jedes Haus der Siedlung führen.
"Wir von Red Habitat und die Bewohner Chullumas haben die Quelle gemeinsam so erschlossen, dass die Menschen sie gefahrlos nutzen können. Das Wasser durchläuft mehrere Filterstufen. Dann wird es in dem Tank dort so desinfiziert, dass wir es als Trinkwasser in alle Häuser der Siedlung leiten können."
Heute besäßen die 300 Familien des Viertels Chulluma eine nachhaltige und zuverlässige Wasserversorgung, sagt die Präsidentin und umarmt noch einmal den jungen Ingenieur.
In den Höhenlagen Boliviens müssen sich immer mehr Menschen selbst um ihre Wasserversorgung kümmern, die Regierung tue wenig, erklärt mir Guillermo Caliza als wir am nächsten Morgen noch weiter nach oben klettern – nach El Alto. Das ist die ärmere, schäbigere Schwester von La Paz. Um 1960 entstanden die ersten Häuser, inzwischen leben hier fast eine Million Menschen – immer neue Ziegelbauten wuchern haltlos ins Umland. Heute ist es kalt und feucht. Männer haben sich in Anoraks vermummt. Frauen in wollene Schals. Selbst die Kinder haben die Mundwinkel heruntergezogen.
"Wasser für alle Zwecke" vom Dach
Im Viertel Atalaya besuchen wir die Schneiderin Estefa Ramos. Auch sie begrüßt Ingenieur Guillermo Caliza überschwänglich und zeigt auf das Dach ihres gelb getünchten Häuschens. Dort wird das Regenwasser aufgefangen und mit einem grauen Kunststoffrohr zum Boden geleitet. Hier stehen auf einem Betonsockel drei miteinander verbundene Zylinder und ein schwarzer Tank. Darunter ein Becken zum Wäschewaschen.
"Regenwasser zu sammeln hat eine lange Tradition bei den Ureinwohnern Boliviens, die aus dem ländlichen Altiplano hierhergezogen sind. Wir von Red Habitat haben nur die Technik des Regensammelns verbessert, sodass Stadtbewohner Regenwasser jetzt problemlos in Bad und Haushalt benutzen können. Vom Dach dieses Hauses wird das Wasser in den Kunststofftank geleitet. Den haben die Menschen in Workshops gemeinsam hergestellt, wie auch den vorgeschalteten dreistufigen Filter. Der entfernt zunächst grobe Verunreinigungen aus dem Wasser – und schließlich auch ganz feine Partikel."
Estefa Ramos legt ein paar Blusen ins Becken und dreht den Wasserhahn auf. "Wasser für fast alle Zwecke", sagt sie begeistert.

Neben dem Haus von Estefa Ramos steht ihre Regenwasserauffanganlage.© Thomas Kruchem
"Als ich von dem Projekt hörte, war ich gleich Feuer und Flamme. Ich hatte ja vorher schon Regenwasser aufgefangen – zum Putzen vor allem. Dazu hatte ich einfach ein Fass an die Regenrinne unseres Hauses gestellt. Das neue Projekt haben wir in der Gemeindehalle ausführlich besprochen. Und anschließend haben wir alle zusammen die Teile besorgt oder selbst gebaut. Jetzt habe ich genug Wasser zum Wäschewaschen, Geschirrspülen, Duschen und sogar für die Toilette."
Nur für die Bereitstellung von Trinkwasser sei die Technik so noch nicht geeignet, erklärt mir der junge Ingenieur Guillermo Caliza. Aber immerhin: Rund 130 Haushalte in dem Viertel Atalaya habe seine Hilfsorganisation Red Habitat mit Regenwasserauffanganlagen ausgestattet. Ein Modellprojekt, das an Traditionen der Ureinwohner anknüpft und großes Interesse hervorruft. Nicht nur mehrere Nachbarn der Familie Ramos haben schon auf eigene Faust Regenauffanganlagen gebaut. Auch Boliviens Regierung hat angebissen und auf der Basis eines Leitfadens der Hilfsorganisation Red Habitat rund 120.000 Wohnungen in ländlichen Regionen mit Regenauffanganlagen ausgestattet. Für Guillermo Caliza und seine Kollegen ist das aber erst der Anfang. Sie entwickeln gerade eine Anlage, die Regen endlich auch in Trinkwasser verwandelt. Eine Alternative für hunderttausende Bewohner von La Paz und El Alto, die sich bis heute kostspielig aus Tankwagen versorgen müssen.
Kapitel 3 – Brunnenbauer in Bangladesch
Batíkura, ein Dorf im Nordosten von Bangladesch, nahe der Großstadt Mymensingh. Zwischen strohbedeckten Bambushütten spielen kleine Kinder.
Aus einem Tiefbrunnen schöpfen einige Kinder Wasser für das Mittagessen.
Bis vor 40 Jahren tranken die Menschen in Batíkura und fast allen Dörfern Bangladeschs Wasser aus Tümpeln und Teichen, in denen zugleich Kühe und Wasserbüffel badeten. Hunderttausende starben Jahr für Jahr an Durchfallerkrankungen wie Typhus und Cholera – bis Anfang der 1970er-Jahre das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF und andere Hilfsorganisationen die Menschen aufforderten, Bohrbrunnen anzulegen und daraus zu trinken. Gesagt, getan: Heute gibt es rund 20 Millionen Bohrbrunnen in Bangladesch aus denen 97 Prozent der ländlichen Bevölkerung ihr Trinkwasser beziehen - ohne Krankheitserreger. Doch da sei ein Problem, sagt Halima Begum, eine alte Frau in orange-rot geblümtem Sari, deren Handflächen übersät sind von wuchernder Hornhaut und wunden Rissen.
"Seit fünf Jahren wird die Haut auf meinen Handflächen und Fußsohlen immer härter und rissiger. Sie brennt und juckt. Außerdem tut mein Rücken weh, und ich werde immer schwächer. Meine größte Sorge aber ist, dass auch bei Kudeja, meiner Tochter, und Abdu, meinem Sohn, die Krankheit immer schlimmer wird. Kudeja hat große Schmerzen, wenn sie Wasser holt; und Abdu kann wohl bald nicht mehr arbeiten. Wovon sollen wir dann leben?"