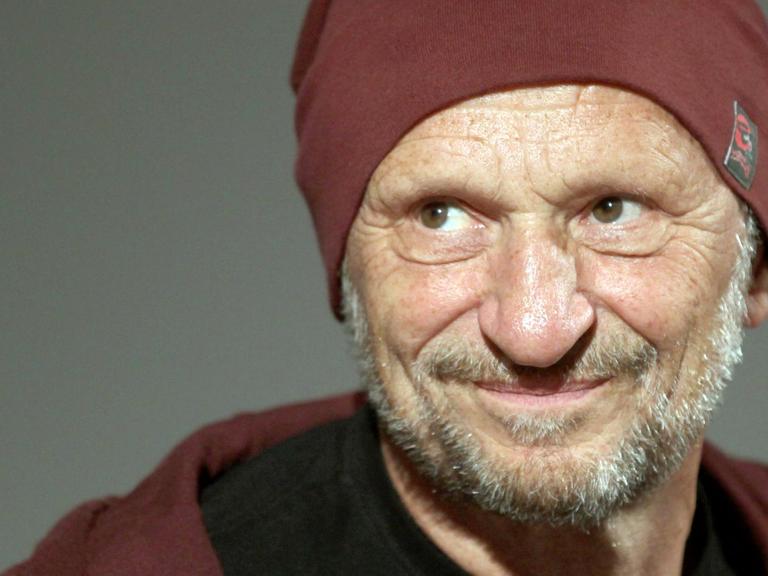Zwischen Subkultur und Profisport
23:57 Minuten

Skateboarder fahren auf Brettern, die ihnen die Welt bedeuten. Sie nehmen den urbanen Raum anders wahr: jede Treppe, jede Kurve eine Herausforderung. Und wenn es in der Stadt keine Rampen gibt, baut sich die Szene einfach ihre eigenen.
Dieses Feature ist eine Wiederholung vom 5. April 2020
"Skateboarding ist für mich mein ganzes Leben, ist immer in meinem Kopf, seit ich sieben oder acht Jahre alt bin. Ich kenne keinen anderen Weg", sagt Finn, 28 Jahre alt. Er kommt aus Nordirland, lebt aber schon fünf Jahre in Berlin. "Hier, das heißt DogShitSpot – es ist richtig gut! Es ist seit zwei, drei Jahren hier. Und alles ist selber gemacht, DIY."
Ein DIY-Skatepark-Projekt, Do It Yourself. Skater hatten vor zehn Jahren die brachliegende und von Hundebesitzern frequentierte Fläche neben Bahngleisen für sich entdeckt und begonnen, ungefragt kleine Rampen zu bauen. Jetzt hat der DogShitSpot in etwa die Größe eines Tennisplatzes.
Die Anlage wurde durch Skater und den Berliner Skateboardverein in Eigenregie geplant und gebaut. Deshalb entspricht er genau den Bedürfnissen der Skater. Alles ist hier möglich. Stufen sind in die Bahn integriert, Rampen und Geländer, Rundungen, Schanzen, Half- und Quarterpipes. Die Skater haben dafür ihre eigene Sprache.

Knapp 100 offizielle Skateparks gibt es in Berlin.© Unsplash / Hector Bermudez
Als Unkundiger hat man den Eindruck, Strukturelemente der modernen Architektur sind hier auf engem Raum nachgebaut und auf dem Skatepark platziert. Kein Wunder, denn die Eroberung des öffentlichen Raumes, von Plätzen, Treppen, abschüssigen Wegen und Bänken ist nicht nur der spezielle Reiz für Skater, sondern die ureigene Disziplin des Skateboardens: Das Streetskaten. Das Fahren auf der Straße, bei dem alle möglichen Tricks, Manöver und Kunststücke gezeigt werden.
Der Kick beim Skateboardfahren
Der Blick, mit dem sich Skateboardfahrer durch die Stadt bewegen, sei "ganz anders", sagt Jonathan. Er gehört zu den etwa 15 Skatern auf dem DogShitSpot. "Bei jeder Kante, jeder Treppe denkt man: Könnte ich da runter springen oder so?"
Er ist 30 Jahre alt, hat sein Hobby zum Beruf gemacht und arbeitet als Skateboardtrainer:
"Ich erwische mich jetzt immer noch dabei, dass ich das denke, wenn ich irgendwo mit dem Zug lang fahre und irgendwo Treppen sehe. Früher war es so, dass ich mir dann direkt aufgeschrieben habe, wo ich war und überlegt habe, ob man das fahren kann. Und dann fährt man irgendwann mal dran vorbei und stellt fest, ja, der Boden davor ist unglaublich schlecht. Das war total Quatsch, jetzt hierher zu fahren, aber es sah gut aus.
Oder ich kann mich zum Beispiel auch an meinen Schulweg erinnern, welche Bodenbeschaffung auf meinem Schulweg war, weil ich mit dem Skateboard zur Schule gefahren bin und ich mir immer den bestmöglichen Weg ausgesucht habe. Ich wusste genau, der Teerstreifen ist nicht ganz so glatt wie der Teerstreifen, also fahr ich da lang. Das vergessen viele, wenn sie jemand auf dem Skateboard sehen, dass die Jungs und Mädels, die das machen, ihr Umfeld wirklich ganz anders, sehr kreativ wahrnehmen. Es ist auch beim Sprayen der Kick, dass man sich schwierige Stellen sucht, auch wenn man weiß, man wird vielleicht erwischt. Aber wenn man es dann da schafft, dann ist es richtig cool. Und das ist beim Skateboardfahren genauso. Ich glaube, es ist auch ein Grund, warum die Szenen sehr verwandt sind."
Der öffentliche Raum bleibt Referenz
Der DogShitSpot gehört zu den größeren von knapp 100 offiziellen Skateparks in Berlin. In der Szene haben sie Namen wie Knorri, T-Park oder E-Lok. Unter den Anlagen gibt es aber auch solche, die kaum ihren Namen verdienen mit nur einer Rampe aus Holz. Trotz der Skateparks bleibt das Original mindestens so reizvoll wie sein Nachbau.
Hier bleiben die Streetskater ihrem Ursprung treu: Dem öffentlichen Raum. Das ist in Berlin nicht anders als in Hamburg, Dresden und München oder in jeder Stadt der Welt. Hauptsache, der Beton ist glatt und es gibt Hindernisse wie Stufen, Geländer und Absätze. Überall, wo es nicht ausdrücklich eingeschränkt oder wenigstens geduldet ist, hört man das Geklapper der Boards an solchen Plätzen.
"Wir hatten zum Beispiel eine Lautstärkenbeschwerde – wie man hört, ist es laut auf dem Boden – an der Warschauer Straße, wo ich mir sage, na ja, also, das ist jetzt nicht das Lauteste an dieser Straße. Da fahren Straßenbahnen im Fünfminutentakt, die quietschen um die Kurve rum, und es ist eine vierspurige Straße. Sich dann über die Skateboardfahrer zu beschweren, über die Lautstärke – das ist so ein bisschen, da verstehe ich es nicht mehr."
Jonathan denkt an ein Ereignis vor vier Jahren auf dem eher unspektakulär wirkenden Mittelstreifen zwischen Straßenbahnschienen in der Berliner Warschauer Straße. Mit nicht mehr als ein paar hintereinander stehenden Bänken auf glattem Beton ist dieser Hotspot selbst Skatern aus den USA ein Begriff. Das Bezirksamt wollte seinerzeit diesen Platz auf eine für Skater unattraktive Weise umgestalten. Beim Beginn der Bauarbeiten stand ein massives Polizeiaufgebot einer protestierenden, internationalen Skaterszene gegenüber. Diese trug die geliebten Bänke eigenhändig davon, um sie zu sichern. Der Bezirk lenkte schließlich ein und stellte neue Marmorbänke mit sogar eigens für die Skater abgeschliffenen Kanten auf.
Longboards - surfen auf dem Trockenen
Robert Barta ist 1975 in Prag geboren und Bildhauer. Auf dem Weg in seine Werkstatt macht Robert eine Pause in einem Straßencafé: "Ich hatte das Glück, durch ein Stipendium im Jahr 2002 für ein Jahr nach San Francisco zu gehen und dort habe ich Wellenreiten, also Surfen angefangen."
Sein circa ein Meter langes Skateboard hat er an einen Stuhl gelehnt.

Longboards verhalten sich ähnlich wie Wellenreiter.© Unsplash / Sasha Bond
"Nach dem Jahr kam ich wieder zurück, da waren die Wellen weg und der Pazifik auch. Irgendwann 2004 habe ich dann gesehen, dass so was wie Longboards gibt. Die sind wie ein Skateboard, nur, dass es wesentlich länger ist. Ich glaube, die gibt es schon bis 1,50 Meter, 1,60 Meter. Die Achsen sind ein bisschen breiter und sehr weich. Das heißt, man kann das Gewicht verlagern wie auf dem Wasser mit dem Surfbrett oder wie mit dem Snowboard. Dann fährt das Brett Kurven. Longboard heißt es im Surfen auch, auf dem man, wenn man die Welle fährt, nicht diese Kurven macht, sondern man läuft vor und zurück. Also, man läuft auf dem Brett."
So könnten auch Surfer, die nicht am Meer leben, auf dem Trockenen üben, fügt er noch hinzu.
So könnten auch Surfer, die nicht am Meer leben, auf dem Trockenen üben, fügt er noch hinzu.
Vom Swimming-Pool zur Halfpipe
Die kalifornischen Surfer wollten in den 60er-Jahren ihren Spaß auch an Land haben – mit einem rollenden Brett unter den Füßen. Doch viele Gemeinden an der Westküste der USA verboten das Skateboardfahren auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Da kam die Verordnung der kalifornischen Regierung, Wasser aufgrund extremer Dürre einzusparen, für die Skater zur rechten Zeit:
"So ist es eigentlich bei den Surfern in den 60ern entstanden. Die leeren Swimmingpools in Kalifornien wurden zu den ersten Halfpipes umfunktioniert, die es ja noch gar nicht gab."
Denn Wände und Böden der amerikanischen Pools hatten eine runde Form, wie eine riesige Schüssel, Bowl, daher auch der Name, Bowl-Skaten.

Sogenannte Bowl-Pools ohne Ecken wurden besonders in den 1960ern von Skatern sehr geschätzt.© Getty Images / Loop Images
"In den Pools konnte man ja nicht nur vor und zurück. Wenn der Pool eine organische Form hatte, vielleicht wie ein Herz, dann sind die quasi da drauf runter in die Kurven. Das hat sehr viel mit Surfen zu tun. Allerdings gleicht das eher dem Surfen mit kurzen Brettern, also, so genannten Shortboards – sehr kurz, sehr wendig. Das heißt, die fahren die Welle auf und ab und machen Cutbags, das heißt, ich fahre nicht in eine Richtung, sondern mache quasi wie einen U-turn zurück, komme wieder zurück und wieder hoch und wieder runter. Der Körper ist die ganze Zeit mit Gewichtsverlagerung beschäftigt und dasselbe muss man das ja auch können, wenn man ein guter Skater ist und diese Halfpipes fährt oder in den Pools fährt."
Funkenschlagen beim Downhill
Aus diesem Bowlskaten hat sich die Wettkampfdisziplin des "Skateboard Park" entwickelt. Den Parcours hierfür kann man sich wie einen riesigen amerikanischen Swimmingpool vorstellen. Über den geschwungenen Grund mit hügeligen Bodenwellen rasen die Skater auf Rampen, springen über die Halfpipes hinaus und nutzen alle Kanten um ihre Kunststücke zu machen. "Skateboard Park" wird nicht nur bei deutschen Meisterschaften gefahren. Sie ist inzwischen eine Disziplin bei den Olympischen Spielen. Das Freestyle-Skaten auf dem Longboard hat es allerdings noch nicht dorthin geschafft.
"Es gab auch mal in Berlin vor, ich glaube, bestimmt sieben, acht Jahren eine kleine EM für Freestyle-Longboard, das heißt: tanzen auf dem Longboard, während es fährt. Da haben Mädchen, Jungs, Erwachsene, Teenager teilgenommen, das war ein richtiger Wettbewerb. Das wurde eine eigene Sportart, 2007, glaube ich, und das hieß dann Downhill. Das heißt, die Leute hatten Handschuhe mit Gelenkschutz, der aus Stahl ist, mit dem sie sich dann tatsächlich dann, wenn sie mit 50 Kilometer pro Stunde in die Kurve fahren, mit der einen Hand am Asphalt abstützen und dann richtig Funken schlagen. Das sind dann oft so Geschichten, dass die in Teams, als Freunde, als Gruppen auf so einen Berg fahren, gucken, dass da wenig Autoverkehr ist oder gar keiner und dann diesen Berg runter fahren. In Kalifornien sind das 50 Kilometer Strecke runter, wenn man da in die Gebirge geht. Da geht es um Geschwindigkeit, aber auch um diese endlose Fahrt. Also, eine Stunde bergab zu fahren."

Auf Skateboards lange Straßen hinunter fahren - zum Beispiel in Kalifornien kann eine solche Abfahrt schon mal eine Stunde dauern.© Unsplash / Jamie Brown
Für Robert ist das zu gefährlich. Doch kürzere Strecken in der Stadt fährt er immer mit seinem Board. Und manchmal begleitet er seine Freunde damit sogar auf Radtouren.
"Als die Longboards dann auf den Straßen fuhren, weil die eben auch schneller sind, gab es von der Gesellschaft so ein bisschen Abneigung dagegen. Die abfälligen Bemerkungen der Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger, das Longboard und jetzt fährt er da entlang auf der Radspur – kommt vielleicht auch auf die Stadt an. In Kalifornien, da würde es keinen Menschen interessieren. Das heißt, man nimmt halt einfach die kleinen Straßen, 30er-Zonen, wo eben wenig Verkehr ist."
Warum Skaten auch Sprache vermittelt
Berlin-Moabit. Eine Gruppe Kids zwischen 12 und 15 Jahren will in ihrer Projektwoche auf verschiedenen Skateparks Kunststücke üben. Mit ihren Boards stehen sie vor der Baracke des Berliner Vereins Drop-In und warten auf ihre Betreuer, damit es endlich losgeht. Doch diese müssen erst noch ein paar Fragen zu ihrem Verein beantworten.
Sara ist 35 Jahre und kommt selbst aus der Skateboardszene. Sie arbeitet bem Berliner Verein Drop-In. Drop-In heißt ein Trick beim Skaten, bei dem man sich mit seinem Board von der Kante einer Halfpipe kopfüber hinunterstürzt:
"Wir machen Jugend- und Bildungsarbeit. Schwerpunktmäßig richtet sich das Angebot an geflüchtete Jugendliche, aber auch Jugendliche aus dem Kiez. Unser tägliches Angebot besteht aus Sprachförderung, klassischem Deutschunterricht und im Anschluss ein Freizeitprogramm mit Schwerpunkt Skateboarding und das ein tolles Medium ist, um Jugendlichen Sprache auf unkomplizierte, niedrigschwellige Art zu vermitteln. Uns ist es wichtig, auch deutsche Kids mit einzubeziehen, weil es ja nichts bringt, wenn wir dann doch immer wieder nur isoliert quasi Jugendliche mit Fluchthintergrund mitnehmen, sondern, das soll sich ja eben vermischen. Viele kommen aus Afghanistan, Irak, Syrien. Wir haben aber auch Leute aus Afrika oder auch aus dem asiatischen Raum. Das ist recht vielfältig."
Brücken zwischen den Kulturen...
Jost Schmidt hat zusammen mit anderen Skatern den Verein Drop-In gegründet:
"Die Überlegung war, dass wir gemerkt haben, wie gut das Verhältnis zwischen jungen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Männlein, Weiblein und so weiter ist, wenn sie sich ein Hobby teilen, bei dem sie aber nicht gegeneinander antreten, sondern etwas zusammen Kreatives machen. Ein konkreter Anlass war, bereits 2012 hat in Berlin-Marzahn eine Unterkunft für Geflüchtete eröffnet. Da gab es diese klassischen Anwohnerproteste. Uns war es zu dem Zeitpunkt wahnsinnig wichtig, zu sagen, nein, Menschen anderer Kulturen sind hier auch willkommen, und wir gehen da einfach hin und schnappen uns Skateboarder, schnappen uns Skateboards und bieten einen kleinen Kurs an.
Und weil das so gut angekommen ist und vielleicht auch geschafft hat, eine kleine Brücke in die Nachbarschaft zu schlagen, weil dann Menschen gleichen Alters sich das gleiche Hobby teilen konnten, haben wir gesagt, die nächste Herausforderung ist, die Kids sitzen in den Willkommensklassen allein, die sitzen in den Unterkünften alleine, die haben keinen Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft, also müssen wir Skateboarding nutzen, um Sozialraumerkundungen zu machen, um andere Kinder aus der Nachbarschaft dazu einzuladen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen Verein, der diesen Ansatz verfolgt. Und da ist dann 2015 Drop-In geboren gewesen."
... und zwischen den Altersgruppen
Die Kids sind im Skatepark angekommen. Bevor es losgeht, sollen sie beschreiben, was sie sich heute vorgenommen haben: Kick Flipp, Worry Flip, Tray Flip, Frontside Plant und der Olli sollen verbessert werden. Böhmische Dörfer für den Laien. Die beiden Betreuer Krissi und Jonathan zeigen den Kids, dass auch sie noch zu lernen haben.
"Skateboardfahren hat keine Altersgrenze", erklärt Jonathan von Drop-In. "In der Disziplin, in der ich am liebsten fahre, im Bowl-Fahren, kann es sein, dass neben dir ein Kind steht, das ist 12 Jahre alt und auf der anderen Seite steht ein Typ, der ist 55 Jahre alt, und die unterhalten sich über einen Trick, den sie gerade üben, und das ist ganz normal. Die würden sich in der U-Bahn oder irgendwo nicht angucken, nicht unterhalten, gar nicht, aber in dem Moment, wo sie gerade Skateboard in der Hand haben, stehen sie da und reden miteinander."
Die Mädchen werden mehr
Über 20 Skater rasen an diesem Nachmittag über die Anlage, doch es gibt keine Zusammenstöße. Niemand fährt einfach drauf los. Es scheint große Umsicht zu herrschen. Man wartet, bis die Rampe oder Bank, auf der man fahren möchte, wieder frei ist. Skatende Mädchen sind hier allerdings in der Minderzahl.
"Ich bin damit groß geworden, dass bei mir im Skatepark damals in Dortmund zwei Girls immer gefahren sind. Hier in Berlin war es dann ein bisschen anders", erklärt Jost Schmidt. "Aber dank Olympia und dank verschiedener Skate-Contests in den Staaten und auf der ganzen Welt, wo Frauen auch teilhaben, ist es sehr viel stärker geworden in den letzten Jahren."

Auf dem Skateboard stehen auch immer mehr Mädchen und Frauen.© Unsplash / Flo Karr
Und Krissi ergänzt: "Es gibt auch öfter mal Girl-Sessions, also extra Skatekurse für Mädchen." Für Krissi ist die Arbeit bei Drop-In ein Nebenjob. Sie studiert Erziehungswissenschaften.
"Vor ein paar Jahren haben sich viele Mädchen auch einfach nicht getraut, weil das einfach ein sehr männerdominierter Sport war. Es nimmt aber immer mehr ab, und das merkt man heute. Ist ein cooler Fortschritt für Mädchen und Frauen, dass sie sich einfach auch mehr trauen. Je mehr Mädchen das machen, desto mehr traut man sich dann natürlich auch. Und mit Übung können wir es genau so gut wie viele andere Jungs."
Skepsis gegenüber Vereinen
Skateboarding ist kein Mannschaftssport. Er ist allein von seinem subkulturellen Ursprung her nicht darauf aus, gegeneinander in Konkurrenz zu treten. Natürlich ist man stolz auf das, was man sich mit Ehrgeiz und Durchhaltewillen beigebracht hat, aber eher, um es vorzuführen und andere damit zu motivieren oder ihnen zu zeigen, wie man's macht. Sobald auf der Piste ein schwieriger Trick wirklich gut geklappt hat, wird von den anderen applaudiert, egal ob gerade ein Kind oder ein Erwachsener sein Kunststück gezeigt hat. Skaten wird eher als individualisierter Lebensausdruck denn als Sport angesehen.
Deshalb stehen die Skater der Organisation in Vereinen ambivalent gegenüber. Dennoch sind sie notwendig, als Ansprechpartner und Initiatoren gegenüber Städten und Kommunen, wenn es um die Konzeption neuer Skateparks geht, und nicht nur um das Aufstellen von Skate-Elementen aus dem Katalog.
"Skateboardfahren ist in Deutschland immer noch Kategorie Spielplatz, Grünbauflächenamt", sagt Jonathan. "Ich habe selber die Erfahrung gemacht und mich in Dortmund mit der zuständigen Person unterhalten. Die meinte, na ja, wir kriegen einen Katalog, dann nehmen wir eine Rutsche und eine Schaukel und stellen die in den Sandkasten und das Gleiche mache ich halt mit einem Skatepark. Das führt dann dazu, dass man Rampen hat, die mitten in der Wand enden oder auf Backsteinen gebaut werden. Und die Stadt kann sagen, wir haben einen neuen Skatepark gebaut und viel Geld ausgegeben. Es gibt super viele verlassene, nie benutzte Skate-Anlagen. Deutschland ist, was Skateparks angeht, so ein bisschen wie mit dem Internet. Das ist echt so ein Entwicklungsland."
In Schweden ist Skateboarding Schulsport
Ganz anders ist die Situation in Schweden. Dort ist an manchen Schulen Skateboarding sogar Bestandteil des Sportunterrichts. In Malmö ging man noch einen Schritt weiter. Anstatt einfach nur eine Skaterklasse an einer Schule zu initiieren, gründete die Malmöer Skater-Organisation ein eigenes Gymnasium für Skateboarder. Gerade auch für solche, die mit ihrem Schuldasein eigentlich bereits innerlich abgeschlossen hatten.
Am Bryggeriets Gymnasium wird Skateboarding mit anderen Ausbildungsgeboten verknüpft. Es werden Kurse in Design, Mode, Cartoongestaltung und Foto- wie Filmproduktion angeboten. Deren Inhalte leiten sich von der Begeisterung für das Skaten her. So soll für die Schüler die Basis für eine mögliche berufliche Perspektive eröffnet werden.
Von Malmö aus, eine Stunde in jede Himmelrichtung sind vier oder fünf gute Parks. Und gerade im Süden unten sind in den letzten zehn Jahren so unglaublich tolle Anlagen entstanden. In jedem kleinen Dorf ist ein kleiner Skatepark, der kreativ ist, der nicht aus dem Katalog kommt, sondern handgeshaped ist.
Rampen Marke Eigenbau
Doch auch Deutschland macht Fortschritte. Die Auftragsbücher des Bremer Unternehmens Anker-Rampen sind voll. Gerade haben junge Mitarbeiter eine Anlage in Berlin-Friedrichshain fertig gestellt. Auch sie sind natürlich Skater – und sie sind keine Facharbeiter, so wie Sven Müller, der wie sein Kollege, aus der DIY-Szene kommt.
Wenn er selbst Betonbau nicht gelernt hat, wie muss man sich dann den Weg seiner Qualifikation vorstellen?
"Dass Jungs sich einfach selber, ja, an der Hand packen und sagen, wir sparen jetzt Geld für Zementsäcke und einen Betonmischer und die fangen dann an, ihre eigenen Rampen zu bauen. An der Greifswalder Straße wird zum Beispiel gerade an so einem Schrottplatz, Containerplatz eine gebaut. Da stört man niemanden und die Jungs bauen da ihre eigenen Rampen."
Der Besitzer des Grundstücks hat noch keine Baugenehmigung. Bis dahin können die Skater das Gelände mietfrei nutzen.
"Dafür haben wir hier immer Partys gemacht, so ein bisschen Geld eingenommen und davon haben wir immer Beton gekauft", erzählt Max, einer der Skater, die hier bauen. "Und die Leute waren großzügig. Ganz Berlin kommt vorbei und gibt gerne mal was ab."
"Familien mit ihren Kidies", ergänzt Tom, ein weiterer Skater. "Hier kommen namhafte Namen der Szene, Teams aus Amerika, Leute um Graffiti zu sprühen."
Vielleicht können Tom, Max und ihre Skaterfreunde noch ein halbes Jahr bleiben. Dann suchen sie nach einer anderen Brache in der Stadt und bauen sich einen neuen Skatepark.
(leicht gekürzte und bearbeitete Onlineversion, thg)