Die Attraktivität der Macht
Anhand von Beispielen aus verschiedenen Kulturen erläutern zehn österreichische Wissenschaftler den Zusammenhang von Sex und Macht. Das geschieht mit akademischer Genauigkeit, aber auch mit einer guten Beimischung von lustvollem Voyeurismus und vergnügter Erzählfreude.
Zu Recht erinnert das Vorwort des Buches an den Medienhype, der sich seinerzeit einstellte, als die Verbindung von Nicolas Sarkozy und Carla Bruni bekannt wurde. Wir erinnern uns: Der Dynamische und die Schöne – das entzückte die Gazetten und auch ihre Leserinnen und Leser. Mit welch einem Vergnügen hatte man kolportiert, dass die erfahrene Bruni der langen Liste prominenter Liebhaber nun endlich einen hinzufügen wollte, der nicht nur über Geld und Prominenz, sondern sogar über Atomwaffen verfügte. Sie bekam ihn, er bekam sie, die Redakteure atmeten auf – da war Stoff auf Jahre hinaus.
Gehen wir in die Geschichte: Was wollte Cäsar von Cleopatra? Und vor allem: Was wollte Cleopatra von Cäsar? Cäsar, mit 51 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Macht, und Cleopatra, 21-jährig, auf dem Weg dorthin - wie viel Leidenschaft mag im Spiel gewesen sein, als sich die junge Frau in einem Wäschesack versteckt in Cäsars Palast einschmuggeln ließ – und wie viel Berechnung? Immerhin arrangierte Cleopatra die Ermordung ihres mitregierenden Bruders, und dazu brauchte sie die Deckung des mächtigen Cäsar:
"Zu einseitig lag der Fokus der Betrachtungen dieses prominenten Paares auf dem überbetonten 'Liebesverhältnis' beider zueinander, denn es ging dabei um viel mehr. Die in den letzten Jahren zutage getretenen Denkmäler aus Ägypten werfen ein facettenreiches Bild auf die Interessen der Königin, insbesondere auf die Rolle, die Kleopatras dynastisches Denken bei der Sicherung ihrer Herrschaft gespielt hat."
Ganz sicherlich war Cleopatra angezogen von dem Mann, der zwar keine Atomwaffen, aber ansonsten die wohl größte Macht seiner Zeit in Händen hielt, ganz sicher aber auch, dass sie eine eigene Machtposition erringen und ausbauen wollte.
Einer der Autoren hat sich erkennbar auch von dem Unterhaltungswert seines Themas verführen lassen. "Wenn Khane kuscheln" lautet die Überschrift seines Beitrags und in der Tat: Die kuschelige Seite an Tschingis Khan ist bislang in der Forschung wenig betont worden. Vielmehr kannte man an den kriegerischen Tartaren eher die unangenehme Seite, wie sie ein christlicher Beobachter beschrieb:
"Es befriedigte sie, wenn sie die Tochter in Gegenwart des Vaters oder die Ehefrau in Anwesenheit des Mannes missbrauchten."
Aber der Beitrag erwähnt auch, dass Frauen, die im Regelfall als "Fundsache", also als Beutegut, eingesackt wurden, zu Amt und Würden aufsteigen konnten wie Yesüi, die Frau des Tschingis Khan, die nach seinem Tod große Teile seines Reiches als persönliches Erbe erhielt. Die Vielweiberei der Khane, die sich mit zahlreichen Haupt- und Nebenfrauen umgaben, rechtlose Sklavinnen -
"für den sexuellen Gebrauch zwischendurch -"
- gar nicht mitgezählt, missfiel naturgemäß den christlichen Reisenden, die den Hof der Khane besuchten. Aber sie fanden nicht allein aus moralischen, sondern auch aus pragmatischen Gründen, dass die eigenen Sitten daheim angenehmer waren:
"Die Weiber sind kostbar im Einkauf und in der Unterhaltung, und mehrere stören gewöhnlich den Hausfrieden, darum haben die meisten Männer nur eine Frau."
Was die christliche Wertschätzung der Frau betrifft, so zeigte sich, dass den tatarischen Potentaten durchaus auch katholische Prinzessinnen als Ehefrauen zugeführt wurden, um die Außenpolitik zu verbessern und vielleicht auch, um durch die eheliche Gemeinschaft die Heiden zum wahren Glauben zu bekehren – wie die Prinzessin sich in dieser Missionarsposition fühlte, war unerheblich.
Wir lesen die Geschichte des Earl of Rochester, im 18. Jahrhundert ein notorischer Säufer und Wüstling, bekannt als Signior Dildo. Wir lassen uns die Erfahrungen der zeitgenössischen Bordellforschung mitteilen und lernen, dass gerade das hochgestellte und akademisch gebildete Publikum sich in sadomasochistischen Praktiken übt, der österreichische öffentliche Dienst scheint hier eine Vorreiterrolle innezuhaben. Der forschende Volkskundler zu diesem Thema bedankt sich mehrmals bei seiner Gattin:
"Meine gütige Frau Birgit stand meiner Idee freundlich gegenüber und ließ mich gewähren."
Ein weiterer Artikel beschäftigt sich mit dem Haus Coburg, das im 19. Jahrhundert einen regen Export von Prinzen und Prinzessinnen im heirats- und vor allem gebärfähigen Alter betrieb. Fürst Bismarck sprach uncharmant, aber nicht frei von Realismus von den "Hengsten Europas", die Coburg zu den benachbarten Dynastien schickte, zur Auffrischung des Blutes und zum Nutzen des familiären Netzwerkes.
Die Coburger waren vielleicht nur die Fleißigsten, aber das System praktizierten auch die anderen: Peter Wiesflecker zitiert die österreichische Kaiserin Maria Theresia – eine ihrer Töchter war kurz vor ihrer Verheiratung verstorben, für den unglücklichen Ehemann in spe, immerhin ein König, musste Ersatz beschafft werden. Maria Theresia entwarf einen Brief an den zu Verheiratenden -
"Ich billige Ihnen jetzt sofort jene meiner Töchter zu, die Ihnen am meisten passend erschiene."
- um dann das endgültige Meisterwerk der Diplomatie so zu formulieren, als habe sie Gebrauchtwagen im Angebot:
"Ich habe derzeit zwei, die passen könnten, die eine ist die Erzherzogin Maria Amalia, von der man findet, dass sie ein hübsches Gesicht hat und die ihrer Gesundheit nach zahlreiche Nachkommenschaft versprechen dürfte, und die andere, Erzherzogin Charlotte, die auch kerngesund ist."
Der Bräutigam im Übrigen war ein herzloser Vollidiot, dem es augenscheinlich zutiefst egal war, mit wem er verheiratet wurde. Im Bett mit der Macht zu sein war wohl kaum ein Vergnügen, Glücksfälle wie der von Queen Victoria und dem Coburger Prinzen Albert waren eher selten.
Die Autoren versuchen nicht, eine abschließende Generallinie zu entwickeln, sondern sie zeigen an Beispielen aus unterschiedlichen Kulturen den Zusammenhang von Sex und Macht. Das geschieht mit wissenschaftlicher Genauigkeit, aber auch mit einer guten Beimischung von lustvollem Voyeurismus und vergnügter Erzählfreude. Das alles liest man gern und mit Gewinn.
Und die Päpste kommen auch vor.
Johannes Gießauf, Andrea Penz, Peter Wiesflecker (Hg.): Im Bett mit der Macht. Kulturgeschichtliche Blicke in die Schlafzimmer der Herrschenden
Böhlau Verlag, Wien 2011
203 Seiten, 29,90 Euro
Gehen wir in die Geschichte: Was wollte Cäsar von Cleopatra? Und vor allem: Was wollte Cleopatra von Cäsar? Cäsar, mit 51 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Macht, und Cleopatra, 21-jährig, auf dem Weg dorthin - wie viel Leidenschaft mag im Spiel gewesen sein, als sich die junge Frau in einem Wäschesack versteckt in Cäsars Palast einschmuggeln ließ – und wie viel Berechnung? Immerhin arrangierte Cleopatra die Ermordung ihres mitregierenden Bruders, und dazu brauchte sie die Deckung des mächtigen Cäsar:
"Zu einseitig lag der Fokus der Betrachtungen dieses prominenten Paares auf dem überbetonten 'Liebesverhältnis' beider zueinander, denn es ging dabei um viel mehr. Die in den letzten Jahren zutage getretenen Denkmäler aus Ägypten werfen ein facettenreiches Bild auf die Interessen der Königin, insbesondere auf die Rolle, die Kleopatras dynastisches Denken bei der Sicherung ihrer Herrschaft gespielt hat."
Ganz sicherlich war Cleopatra angezogen von dem Mann, der zwar keine Atomwaffen, aber ansonsten die wohl größte Macht seiner Zeit in Händen hielt, ganz sicher aber auch, dass sie eine eigene Machtposition erringen und ausbauen wollte.
Einer der Autoren hat sich erkennbar auch von dem Unterhaltungswert seines Themas verführen lassen. "Wenn Khane kuscheln" lautet die Überschrift seines Beitrags und in der Tat: Die kuschelige Seite an Tschingis Khan ist bislang in der Forschung wenig betont worden. Vielmehr kannte man an den kriegerischen Tartaren eher die unangenehme Seite, wie sie ein christlicher Beobachter beschrieb:
"Es befriedigte sie, wenn sie die Tochter in Gegenwart des Vaters oder die Ehefrau in Anwesenheit des Mannes missbrauchten."
Aber der Beitrag erwähnt auch, dass Frauen, die im Regelfall als "Fundsache", also als Beutegut, eingesackt wurden, zu Amt und Würden aufsteigen konnten wie Yesüi, die Frau des Tschingis Khan, die nach seinem Tod große Teile seines Reiches als persönliches Erbe erhielt. Die Vielweiberei der Khane, die sich mit zahlreichen Haupt- und Nebenfrauen umgaben, rechtlose Sklavinnen -
"für den sexuellen Gebrauch zwischendurch -"
- gar nicht mitgezählt, missfiel naturgemäß den christlichen Reisenden, die den Hof der Khane besuchten. Aber sie fanden nicht allein aus moralischen, sondern auch aus pragmatischen Gründen, dass die eigenen Sitten daheim angenehmer waren:
"Die Weiber sind kostbar im Einkauf und in der Unterhaltung, und mehrere stören gewöhnlich den Hausfrieden, darum haben die meisten Männer nur eine Frau."
Was die christliche Wertschätzung der Frau betrifft, so zeigte sich, dass den tatarischen Potentaten durchaus auch katholische Prinzessinnen als Ehefrauen zugeführt wurden, um die Außenpolitik zu verbessern und vielleicht auch, um durch die eheliche Gemeinschaft die Heiden zum wahren Glauben zu bekehren – wie die Prinzessin sich in dieser Missionarsposition fühlte, war unerheblich.
Wir lesen die Geschichte des Earl of Rochester, im 18. Jahrhundert ein notorischer Säufer und Wüstling, bekannt als Signior Dildo. Wir lassen uns die Erfahrungen der zeitgenössischen Bordellforschung mitteilen und lernen, dass gerade das hochgestellte und akademisch gebildete Publikum sich in sadomasochistischen Praktiken übt, der österreichische öffentliche Dienst scheint hier eine Vorreiterrolle innezuhaben. Der forschende Volkskundler zu diesem Thema bedankt sich mehrmals bei seiner Gattin:
"Meine gütige Frau Birgit stand meiner Idee freundlich gegenüber und ließ mich gewähren."
Ein weiterer Artikel beschäftigt sich mit dem Haus Coburg, das im 19. Jahrhundert einen regen Export von Prinzen und Prinzessinnen im heirats- und vor allem gebärfähigen Alter betrieb. Fürst Bismarck sprach uncharmant, aber nicht frei von Realismus von den "Hengsten Europas", die Coburg zu den benachbarten Dynastien schickte, zur Auffrischung des Blutes und zum Nutzen des familiären Netzwerkes.
Die Coburger waren vielleicht nur die Fleißigsten, aber das System praktizierten auch die anderen: Peter Wiesflecker zitiert die österreichische Kaiserin Maria Theresia – eine ihrer Töchter war kurz vor ihrer Verheiratung verstorben, für den unglücklichen Ehemann in spe, immerhin ein König, musste Ersatz beschafft werden. Maria Theresia entwarf einen Brief an den zu Verheiratenden -
"Ich billige Ihnen jetzt sofort jene meiner Töchter zu, die Ihnen am meisten passend erschiene."
- um dann das endgültige Meisterwerk der Diplomatie so zu formulieren, als habe sie Gebrauchtwagen im Angebot:
"Ich habe derzeit zwei, die passen könnten, die eine ist die Erzherzogin Maria Amalia, von der man findet, dass sie ein hübsches Gesicht hat und die ihrer Gesundheit nach zahlreiche Nachkommenschaft versprechen dürfte, und die andere, Erzherzogin Charlotte, die auch kerngesund ist."
Der Bräutigam im Übrigen war ein herzloser Vollidiot, dem es augenscheinlich zutiefst egal war, mit wem er verheiratet wurde. Im Bett mit der Macht zu sein war wohl kaum ein Vergnügen, Glücksfälle wie der von Queen Victoria und dem Coburger Prinzen Albert waren eher selten.
Die Autoren versuchen nicht, eine abschließende Generallinie zu entwickeln, sondern sie zeigen an Beispielen aus unterschiedlichen Kulturen den Zusammenhang von Sex und Macht. Das geschieht mit wissenschaftlicher Genauigkeit, aber auch mit einer guten Beimischung von lustvollem Voyeurismus und vergnügter Erzählfreude. Das alles liest man gern und mit Gewinn.
Und die Päpste kommen auch vor.
Johannes Gießauf, Andrea Penz, Peter Wiesflecker (Hg.): Im Bett mit der Macht. Kulturgeschichtliche Blicke in die Schlafzimmer der Herrschenden
Böhlau Verlag, Wien 2011
203 Seiten, 29,90 Euro
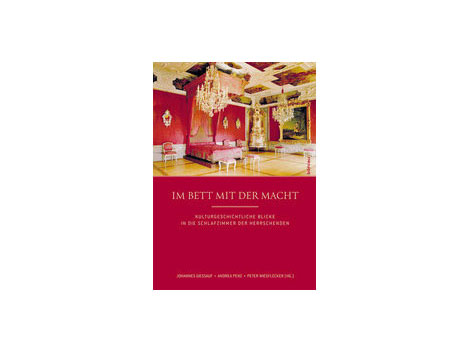
Cover: "Im Bett mit der Macht" von Johannes Gießauf u.a.© Böhlau Verlag
