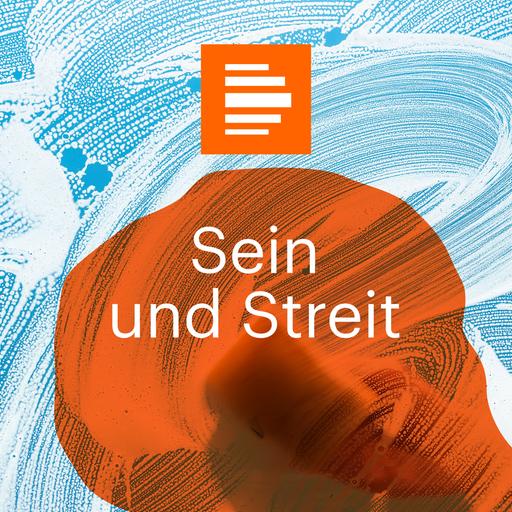Wettbewerb – ethisch betrachtet

Wettbewerb prägt unser ganzes Leben, den Beruf, aber zunehmend auch private Lebensverhältnisse. Warum braucht man da um Himmels willen noch eine "Ethik des Wettbewerbs"? Diese Frage stellten wir dem Münchner Wirtschaftsethiker Christoph Lütge.
Lob mir den Wettbewerb - Gespräch mit dem Wirtschaftsethiker Christoph Lütge (audio)
Konkurrenz belebt nicht nur das Geschäft, Konkurrenz und Wettbewerb sind auch der Motor dessen, was man heute "Arbeitsgesellschaft" nennt. Um im Hamsterrad des globalen oder regionalen Wettbewerbs bestehen zu können, wird vom Einzelnen immer mehr erwartet. Angesichts von Arbeitsverdichtung, Burn-Out-Phänomenen oder Ellenbogen-Egoismus kommt man schnell auf die Idee, dass all diese Folgen einer strikten Wettbewerbsorientierung mit dem guten Leben oder dem richtigen Handeln – also mit einer ethischen Perspektive – nicht viel zu tun haben. Ja, dass es in der Ethik sogar vornehmlich darum geht, Konkurrenz und Wettbewerb zu begrenzen. Dies sei falsch, behauptet der an der Technischen Universität München lehrende Wirtschaftsethiker Christoph Lütge:
"Was wir brauchen, ist eine Ethik, die auch Unternehmergeist und wettbewerbliches Denken als moralisch wertvoll hervorhebt."
Christoph Lütge: Ethik des Wettbewerbs
C.H. Beck Verlag
155 Seiten, 12,95 Euro
C.H. Beck Verlag
155 Seiten, 12,95 Euro
Außerdem:
Kleine Leute – große Fragen (Audio)
Dass Freiheit mehr ist, als irgendwo herumlaufen zu können, das zeigt sich in unserer Reihe "Kleine Leute – große Fragen", in der Kinder die Frage beantworten, ob ein Gefangener frei sein kann.
Vertrauen ist gut! (Audio) – Beitrag von Änne Seidel
Der Begriff des Vertrauens als Grundbedingung gelingenden Zusammenlebens hat in der Philosophie in den letzten Jahren eine beachtliche Konjunktur erlebt. Just und womöglich gerade in einer Zeit, die wesentlich von Vertrauensverlusten gekennzeichnet ist, von der Politikverdrossenheit der Bürger bis hin zu den Abhörskandalen um die NSA. Letzten Mittwoch wurde das Internationale Literaturfestival Berlin eröffnet, das in diesem Jahre dem Vertrauen eine eigene Veranstaltungsreihe widmet: "Kulturen des Vertrauens". Unsere Autorin Änne Seidel hat an vertrauensbildenden Maßnahme teilgenommen.
"Frankreich fordert Interventionen in Libyen", "Bundesregierung wirft Russland erstmals militärische Intervention in der Ostukraine vor", nur zwei Überschriften sind das aus den letzten beiden Wochen. Öffentlich etwas eine Intervention zu nennen, ist selbst schon eine politische Handlung, ein – wie die Philosophen sagen - Sprechakt. Wie sehr unser Blick auf das, was derzeit in der Ukraine, in Syrien, Libyen, dem Irak oder im Gazastreifen geschieht, eben auch davon geprägt ist, welche Worte man verwendet, davon handelt hier im Deutschlandradio Kultur unser "Kleines Lexikon des Krieges". "Intervention" lautet unser Lexikoneintrag heute, untersucht von dem Hamburger Philosophen Hans-Joachim Lenger.
Unsere "Drei Fragen" (Audio) - Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Worüber sollen wir streiten?
Heute mit Antworten des Künstlers Olaf Nicolai, der eigentlich mit den "großen" Fragen nichts anzufangen weiß und trotzdem nicht klein bei gibt.