Die Gleichheit der Anderen
Dem Journalisten Marc Brost zufolge gibt es zwei entscheidende Gerechtigkeitsbegriffe: die Leistungs- sowie die Chancengerechtigkeit. Letzterer sei für ihn der "elementarste und wichtigste Begriff, weil er das Wohlstandsversprechen der sozialen Marktwirtschaft in sich trägt."
Ulrike Ackermann: In unserer noch anhaltenden Wirtschaftskrise, auch wenn das Licht am Ende des Tunnels wieder heller wird, wurden jene Stimmen immer lauter, die prinzipielle Zweifel an der Funktionsfähigkeit des Kapitalismus äußerten. Die Vorbehalte gegenüber dem Markt und seinen Selbstheilungskräften nahmen zu. Gegen den sogenannten Neoliberalismus und die soziale Kälte wurde polemisiert und dagegen die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit in Stellung gebracht – ein Zauberwort, das auch im bürgerlichen Lager Karriere gemacht hat.
Darüber wollen wir heute reden. Im Studio begrüße ich dazu Dr. Karen Horn, Volkswirtin und Leiterin des Hauptstadtbüros des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln. Guten Tag, Frau Horn.
Karen Horn: Guten Tag, Frau Ackermann.
Ulrike Ackermann: Und Marc Brost, Wirtschaftsredakteur des Hauptstadtbüros der "ZEIT", guten Tag, Herr Brost.
Marc Brost: Guten Tag.
Ulrike Ackermann: Zwei Bücher stehen heute im Zentrum unserer Diskussion, zum einen das von Karen Horn und Katja Gentinetta herausgegebene Buch "Abschied von der Gerechtigkeit. Für eine Neujustierung von Freiheit und Gleichheit im Zeichen der Krise" und zum anderen das Buch das Medienwissenschaftlers Norbert Bolz "Profit für alle. Soziale Gerechtigkeit neu denken", so der Titel.
Doch zunächst zu Ihrem Buch, Frau Horn. An welchen Kriterien lässt sich Gerechtigkeit eigentlich messen?
Karen Horn: Ja, Frau Ackermann, da stellen Sie die schwierigste Frage gleich am Anfang. Genau mit diesem Problem wollten wir uns in diesem Buch beschäftigen und haben sich die Autoren, deren Essays wir in dem Buch versammelt haben, auch in der Tat beschäftigt. In der Regel ist es so, dass Gerechtigkeit zusammenschrumpft auf das Kriterium der Gleichheit, und zwar der materiellen Gleichheit, weil das eben das ist, was man am einfachsten messen kann. Sie schauen sich einfach Einkommen und eventuell noch Vermögensbestände an.
In der philosophischen Tradition reicht das aber natürlich überhaupt nicht aus, sondern da richtet man den Blick lieber auf eine formelle Gleichheit, eine Gleichheit, die dann mit Rechten zu tun hat, also, dass jeder das gleiche Recht hat und mit dem Verfahren, wie es in der Gesellschaft angewandt ist, einverstanden sein kann. Das ist eine etwas andere Perspektive, die sich in Zahlen nicht so leicht messen lässt, sondern eben in mehr formellen Kriterien. Die ist allerdings auch etwas schwieriger zu vermitteln. Ich glaube, das relevante Kriterium ist in der Tat insofern immer noch tatsächlich die materielle Gleichheit, als dass es das ist, worauf die meisten Leute schauen. Darauf muss man auch sicherlich Antworten finden.
Wir haben den Titel unseres Buches bewusst so gewählt. Es war zwar nicht unsere Idee, die Idee kommt von Paul Nolte, das "Abschied von der Gerechtigkeit" zu nennen. Aber wir haben uns auf diesen provokanten Titel eingelassen und ihn gerne übernommen, weil wir meinen, dass die Sozialromantik, die sich an diesem Gerechtigkeitsbegriff misst oder an ihm ansetzt, der dann wiederum auf materielle Fragen enggeführt ist, nicht weit führt und dass man sich von genau dem verabschieden sollte.
Ulrike Ackermann: Herr Brost, das Stichwort Sozialromantik ist gefallen. Sehen Sie das auch so, was den Begriff der sozialen Gerechtigkeit anlangt?
Marc Brost: Das Problem beim Begriff der sozialen Gerechtigkeit ist, glaube ich, dass es ein ausgehöhlter Begriff ist, der in der politischen Debatte benutzt wird, von links wie von der liberalen Seite, von oben wie von unten. Und jeder versteht unter Gerechtigkeit etwas anderes. Frau Horn sagte gerade zu Recht, die Meisten würden aus dem Bauch heraus materielle Gleichheit als das Anstrebenswerte halten. Wenn man sich dann selbst hinterfragt oder auch mal neuere Erkenntnisse der Verhaltensökonomie zum Beispiel anschaut, dann kommt man drauf, dass materielle Gleichheit so nie existieren wird. Die Meisten von uns würden lieber in einer Welt leben, in der sie selbst 75.000 Euro verdienen und die anderen 60.000, als dass sie 90.000 verdienen und die anderen 100.000. Also, man vergleicht sich die ganze Zeit. Man schaut danach, was Andere haben. Man strebt nach mehr. Man strebt nach Wohlstand, man will Andere überholen. Das ist das Kernelement des Wettbewerbs.
Ich finde, es gibt zwei Gerechtigkeitsbegriffe, auf die man sich konzentrieren sollte. Das eine ist die Frage der Leistungsgerechtigkeit, womit natürlich dann wiederum einhergeht: Wer sind eigentlich die Leistungsträger in der Gesellschaft? Da gibt es, das haben wir im Wahlkampf gesehen, schon ganz unterschiedliche Antworten. Die christlich-bürgerliche Koalition, die christlich-liberale Koalition hat einen anderen Fokus auf Leistungsträger als das politisch linke Lager. Und der zweite Begriff ist die Chancengerechtigkeit. Das ist der für mich elementarste und wichtigste Begriff, weil er letztendlich das Wohlstandsversprechen der sozialen Marktwirtschaft in sich trägt. Wer hat wirklich Möglichkeiten, an Wohlstand teilzuhaben, den die Gesellschaft insgesamt erwirtschaftet?
Ulrike Ackermann: Friedrich von Hayek hat davon gesprochen, dass "soziale Gerechtigkeit Unsinn" sei. Unser Gespräch entwickelt sich ja auch ein bisschen in die Richtung, tatsächlich diesen Begriff auszudifferenzieren. Man kann ja vielleicht einfach mal an diesen drei Größen sich orientieren: Also, Gerechtigkeit als Rechtsgleichheit, was heißt das eigentlich? Gerechtigkeit als Chancengleichheit? Und in der dritten Kategorie: Gerechtigkeit als Ergebnisgleichheit? Und das, scheint mir, läuft ja dann doch wieder in Richtung materielle Gleichheit.
Karen Horn: Ja, auf jeden Fall. Darf ich kurz noch mal auf Hayek eingehen? Das ist nämlich immer ein ganz guter Punkt, an dem man sich reiben kann, um auch die eigenen Begriffe so ein bisschen zu schärfen. Er hat gesagt: Der Begriff soziale Gerechtigkeit mache ungefähr so viel Sinn wie der Begriff "ein moralischer Stein". Also, es passe einfach gar nicht zusammen.
Was er damit sagen wollte oder was seine dahinter verborgene Überlegung war, war, dass Gerechtigkeit einen Tauschakt eigentlich voraussetzt, also, dass ich mich zum Beispiel mit Ihnen in einem Tauschprozess engagiere. Das heißt, ich gebe Ihnen etwas und ich erwarte auch etwas dafür zurück. Und wir gehen insofern gerecht miteinander um, als wir uns das geben, was dem jeweils Hingegebenen auch entspricht.
Wenn es aber kein handelndes Individuum gibt, von dem man eine solche Gerechtigkeit im Tauschakt verlangen kann, dann entbehrt das Konzept der Grundlage. Er sagt einfach: Damit es Gerechtigkeit geben kann und damit der Begriff irgendwie Sinn ergibt, muss es einen handelnden Menschen geben. Und wenn man von sozialer Gerechtigkeit spricht, denkt man an eine Gesellschaft. Die Gesellschaft ist zwangsläufig ein Kollektiv und keine einzelne handelnde Persönlichkeit. Und er meinte eben, da macht der Begriff überhaupt keinen Sinn.
Das ist, glaube ich, zwar logisch sauber, aber es führt letztlich dann doch irgendwie nicht weiter, weil in der Gesellschaft diese Befindlichkeit in der Tat vorhanden ist. Die Menschen möchten, dass ihr Gemeinwesen auf eine Art und Weise organisiert ist, dass elementare Gerechtigkeitsvorstellungen auch dabei berücksichtigt und realisiert werden. Und da kommt man dann eben auf verschiedene Möglichkeiten, das zu fassen, diesen Begriff umzusetzen, mit Inhalt zu füllen. Und, wie Sie schon sagten, Rechtsgleichheit ist eben der erste und – ich denke – für mich auch wichtigste Ansatzpunkt. Da geht es darum, dass die Regeln, in denen unser gesellschaftliches Leben sich abspielt, so gefasst sind, dass sie für uns alle in gleicher Weise gelten, dass es also keine Diskriminierung im Negativen und auch keine Privilegierung im Positiven gibt, sondern dass wir – weil wir als Menschen erst mal alle gleich sind – auch gleiche Rechte haben. Das ist, glaube ich, wirklich die Grundlage dessen, wie ein Gemeinwesen organisiert sein sollte. Aber dass ich sage, dass es so organisiert sein sollte, zeigt vielleicht auch schon, auf welcher Ebene ich mich bewege, nämlich auf der Regelebene und nicht auf der Ebene der Ergebnisse des gesellschaftlichen Prozesses. Ergebnisse haben Sie angesprochen in Ihrem dritten Kriterium, der Ergebnisgerechtigkeit.
Das sind zwei sehr unterschiedliche Ansatzpunkte. Und genau dieser Unterschied ist von großer Bedeutung. Denn wenn Sie meinen, an den Ergebnissen schon ablesen zu können, ob Gerechtigkeit herrscht oder nicht, dann ist es Ihnen egal, auf welchem Wege sie letztlich da hinkommen. Und dann könnten Sie dafür auch wunderbar ein totalitäres System akzeptieren. Und darum kann es nicht gehen.
Marc Brost: Das Spannende an dem Buch von Frau Horn finde ich neben diesen sehr spannenden und intellektuell herausfordernden Essays, die sie und ihre Co-Autorin zusammengetragen hat, eigentlich den Statistikteil. Das hört sich jetzt salopper und braver an, als es de facto ist. Denn das Schwierige ist ja tatsächlich, Gleichheit beziehungsweise soziale Gerechtigkeit zu messen. Es gibt dafür verschiedene Kriterien. Und ich finde, dass die Autorinnen da die relevanten Zahlen zusammengetragen haben, die auch noch mal einen interessanten Blick veröffentlichen.
Ich würde gern zwei zitieren. Das eine ist die Frage Lohnungleichheit in OECD-Ländern, also in den westlichen Industrienationen. Dort haben die Autorinnen herausgefunden, dass die Lohnungleichheit bis 2005, das war quasi bis zum Beginn des letzten Aufschwungs, deutlich zugenommen hat. Das ist natürlich die Erklärung dafür, warum die Hartz-Reformen, die notwendig waren, oder die gesamten Reformen der damaligen rot-grünen Regierung gesellschaftlich so umstritten waren, weil sie in eine Phase gefallen sind, in der der Einzelne von diesen Reformen erst mal nichts hatte. Das zeigt, wenn man über Gerechtigkeit spricht oder auch Gerechtigkeit herstellen will – die Reformen damals dienten ja dazu, langfristig eine Gesellschaft gerechter, fairer, wettbewerbsorientierter zu machen -, dass man sie irgendwie politisch verankern muss. Das funktionierte nicht. Das ist ein wesentlicher Grund, warum diese Reformen damals und vielleicht auch noch heute gesellschaftlich so nicht akzeptiert sind.
Die noch spannendere Grafik war die, in der Sie gefragt haben, ob staatliche Transfers eigentlich denen zugute kommen, die wirklich etwas davon haben sollten. Sie haben unterschieden zwischen den ärmeren und den reicheren Bevölkerungsgruppen, wenn ich das mal so holzschnittartig darstellen darf, und haben herausgefunden, dass staatliche Transfers nicht in dem Maße denen zugute kommen, denen sie eigentlich zugute kommen sollten, also, den ärmeren Bevölkerungsschichten. Und da sind wir mitten in der aktuellen politischen Debatte, wenn wir über Wachstumsbeschleunigungsgesetz reden und die Frage, was die bürgerliche schwarz-gelbe Regierung da jetzt tut. - Kindergelderhöhung, Kinderfreibetrag, auch Mehrwertsteuersenkung für Hoteliers - , ist das wirklich die Politik und sind das die Transfers beziehungsweise auch die Steuergeschenke, die wir in dieser Situation brauchen? Mittelbar lese ich aus dieser Grafik: Nein, die brauchen wir nicht. Wir hätten andere gebraucht.
Ulrike Ackermann: Merkwürdig ist doch nun, dass das Gefühl der Ungerechtigkeit in der Öffentlichkeit – obwohl sich auch das Durchschnittseinkommen seit dem Zweiten Weltkrieg verdreifacht hat, der Lebensstandard gestiegen ist – stark ist, was zuweilen auch befördert wird, wenn man beobachtet, dass nun auch von der politischen Klasse dieser Begriff soziale Gerechtigkeit insbesondere in Wahlkampfzeiten gerne aufgegriffen wird.
Karen Horn: Das kann ich bestätigen. Ich glaube, man kann mit diesem Gefühl der Ungerechtigkeit, das offensichtlich – wie gesagt – tatsächlich vorhanden ist, einfach sehr gut Politik machen. Man kann das ansprechen. Also, ein Appell an Gerechtigkeit ist etwas, was nie irgendwo auf taube Ohren stoßen wird. Insofern kann man da aber auch alles Mögliche drunter subsumieren und versuchen zu verkaufen.
Es ist, wie wir bei dem von Herrn Brost schon erwähnten Faktenteil in unserem Buch gemerkt haben, nicht so einfach, sich da ein umfassendes Bild zu machen und die diversen, sich gegenseitig konterkarierenden Aspekte dann gegeneinander aufzurechnen. Das ist wirklich schwierig. Und gerade weil das so schwierig und so komplex ist, fällt es im politischen Diskurs einfach unter den Tisch und man kann sich deswegen noch besser auf einzelne Aspekte fokussieren und die dann entsprechend politisch vermarkten. Ich glaube, das funktioniert einfach immer wieder gut in der politischen Diskussion.
Mir wäre sehr daran gelegen, dass man das Ganze ein bisschen mehr rationalisiert und ein bisschen eben durch Fakten auch zur Aufklärung beiträgt und den Fokus vielleicht ein wenig wieder verschiebt von den rein materiellen Fragen. Denn nur darum kann es nicht gehen.
Noch eine kleine Anmerkung zu den Kommentaren eben zu unserem Faktenteil: Wir haben festgestellt, dass der Sozialstaat in Deutschland insofern ja recht gut funktioniert, als ein Großteil der Ungleichheiten ja tatsächlich eingeebnet wird. Es geht aber darüber hinaus. Und es gibt eben Umverteilungsmaßnahmen, die eigentlich genau das Gegenteil dessen erzielen, was wir eigentlich beabsichtigen. Das passiert genau dann, wenn man bestimmte Gerechtigkeitsaspekte so politisiert, dass man Zustimmung dafür erntet, ohne dass die Leute genau hingucken, was damit passiert.
Ein Beispiel, wenn ich eins geben darf, etwas, was wir schon lange kritisieren, ist die Frage der Studienfinanzierung in Deutschland. Wir leisten uns da massiv eine Umverteilung nach oben. Und irgendwie hat sich da noch niemanden gefunden, der da massiv gegen Stellung bezieht. Das wundert mich eigentlich seit Jahr und Tag.
Marc Brost: Insofern ist ja eigentlich so eine Krise auch ein schöner Anlass, nicht nur über soziale Gerechtigkeit nachzudenken, was – glaube ich – beide Bücher, die wir heute besprechen, sehr gut machen, sondern über die Frage: Was ist eigentlich noch mal das Kernelement der sozialen Marktwirtschaft? Wo wollen wir hin? Das ist ja auch so ein Begriff, der im Wahlkampf von allen, zumindest demokratisch verankerten Parteien, wie selbstverständlich benutzt wurde, jeweils mit einer anderen Intention. Auch dieser Begriff ist natürlich ausgehöhlt. Jeder beruft sich auf Ludwig Erhard oder auf Ordnungspolitik oder auf das Soziale an der Marktwirtschaft und versteht darunter was anderes.
Wenn Sie nach der Akzeptanz von Reformen und von Gerechtigkeit oder nach dem Ruf gefragt haben, Frau Ackermann, warum alles so ungerecht sei in diesem Land, warum die Bürger das Gefühl haben, dann würde ich ganz gern noch mal auf die Situation vor der Krise zurückkommen. Das ist ja noch nicht so lange her. Das waren die Jahre 2006/2007, in denen wir einen sehr starken Wirtschaftsaufschwung hatten, in denen wir hohe Steuereinnahmen hatten, möglichst damit verbunden eben auch plötzlich politische Flexibilitäten, in denen wir politisch gestalten konnten, und in denen wir eigentlich auch Dinge hätten verändern können im Sinne von Frau Horn, dass man einige Teile der Gesellschaft mehr belastet, andere deutlich entlastet, und im Sinne einer Neudefinition der sozialen Marktwirtschaft wirklich ein paar Stellschrauben verändert.
Wichtig aber, finde ich, ist, wenn man sich diesen Aufschwung noch mal anschaut – und jetzt zitiere ich die ideologisch unverdächtige Bundesbank -, es war der erste Aufschwung in der Geschichte der Republik, in dem die Realeinkommen nicht gestiegen, sondern gesunken sind. Also, die soziale Marktwirtschaft war – provokant formuliert – nicht mehr so sozial, wie sie davor sehr lange gewesen ist. Und das ist das Kernelement unserer Diskussion. Das ist der Grund, warum viele Bürger diese Gesellschaft als ungerecht, unsozial, ja eben nicht mehr zeitgemäß empfinden.
Ulrike Ackermann: Sie geben da genau das richtige Stichwort, Herr Brost. Wir können damit zu dem zweiten Buch übergehen, nämlich jenes von Norbert Bolz. Er fordert ein "neues Verständnis von sozialer Gerechtigkeit". Also, er verwirft diesen Begriff nicht völlig und beobachtet den Aufstieg eines – von ihm so genannten – "Sozialkapitalismus", der die Idee der Brüderlichkeit im 21. Jahrhundert verwirklichen wird – so seine These.
Herr Brost, Sie haben das Buch gelesen. Was halten Sie von diesem Szenario dieses Sozialkapitalismus, diesem Begriff, den Norbert Bolz hier einführt?
Marc Brost: Kurz geantwortet würde ich sagen: guter Ansatz, schlechte Ausführung. Ich halte das für einen hochinteressanten Versuch, aus der Sicht eines Soziologen diese notwendige Neudefinition der sozialen Marktwirtschaft zu wagen. Er versucht das auch, indem er ganz anders auf die Dinge blickt, nicht per se ökonomisch oder politisch, indem er sich soziale Netzwerke anschaut, indem er soziales Unternehmertum thematisiert, also so eine Art selbstreinigende Kraft des Kapitalismus von innen heraus. Also, er gibt die Marktwirtschaft nicht per se verloren. Das finde ich ganz, ganz wichtig, denn soziale Marktwirtschaft ist ja eine Erfolgsgeschichte in Deutschland.
Wenn ich mich dann aber eben frage, ja, was sind denn die Beispiele für soziales Unternehmertum, wo sieht er empirisch als eine Art Graswurzelbewegung denn schon was entstehen, lässt er mich ratlos und damit am Ende auch einigermaßen hilflos zurück. Ich finde die These sehr spannend, kann mit ihr aber am Ende nicht arbeiten, weil sie nicht fundiert und nicht ausgearbeitet wird.
Ulrike Ackermann: Bolz sagt ja, dass soziale Gerechtigkeit gerade nicht durch staatliche Umverteilung herstellbar sei, sondern durch die Produktion eines sozialen Reichtums, von dem alle profitieren. Er spricht von einer "äußeren Balance", die gefunden werden muss zwischen "ökologischer Ökonomie", also grünem Kapitalismus, und der "inneren Balance" unserer Gesellschaft durch eine "Versöhnung von Profitmotiv und Verantwortung". Das sind für ihn alles so Begrifflichkeiten, die diesen sozialen Kapitalismus oder Sozialkapitalismus ausmachen.
Frau Horn, als Volkswirtin, was halten Sie von dieser Idee?
Karen Horn: Im Grunde ist das, was er da entwirft, eine Variante oder noch nicht mal eine Variante, sondern einfach eine andere Formulierung dessen, was wir unter dem Slogan "Wohlstand für Alle" schon mal gehört haben. Er nennt es eben "Profit für Alle". Das hat bei mir dazu geführt, dass ich, als ich das Buch in die Hand bekam und den Inhalt eben noch nicht kannte, erst mal ziemlich erschrocken zusammengefahren bin. Das erinnerte mich so an die Wahlkampfplakate der Linken. Aber damit hat es nun gar nichts zu tun. Es geht wirklich im Grunde um den Erhardschen Ansatz. Es geht darum, dass die Regelwerke in unserer Gesellschaft so gesetzt werden, dass Wohlstand entsteht, und zwar ein Wohlstand, den er nicht gerne so enggeführt nur auf das Bruttoinlandsprodukt gefasst sehen möchte, sondern er versucht gleichzeitig auch noch abzugreifen, dass uns auch noch andere Dinge glücklich machen außer dem reinen materiellen Wohlstand, also, dass wir auch einen gewissen Sinn im Leben brauchen, dass wir auch unserem Miteinander diesen Sinn ziehen. Daher kommt dieser Aspekt des "sorgenden Kapitalismus", wie er es nennt.
Also, ich möchte eigentlich ein bisschen milder mit ihm umgehen. Ich finde, er benutzt einfach andere Worte, um zu sagen, dass eben dieses Modell der sozialen Marktwirtschaft, wie es Ludwig Erhard in Deutschland durchgesetzt hat, eigentlich ein ganz gutes Modell ist, dass man das auch wieder entdecken sollte, dass man es pflegen sollte. Er benutzt dafür moderne Ausdrücke, aber im Grunde geht es um nichts anderes. Und er setzt auf Kooperation. Er setzt darauf, dass diese Dinge, was Sie erwähnt haben mit dem ökologischen Aspekt zum Beispiel und mit der Nachhaltigkeit und so weiter, dass die auch von selbst sich einrichten, wenn denn die Menschen miteinander umgehen, also dass das eigentlich ein automatisches Resultat der gesellschaftlichen Interaktion ist.
Und als Soziologe schaltet er noch etwas vor, was ich spannend finde, nämlich die Tatsache, dass eine Gesellschaft auch einen Diskurs über diese Dinge braucht, dass sie sich klar werden muss über den Sinn, den die Menschen ihrem Leben geben wollen, die Frage der Moral, die die Menschen miteinander leben wollen. Also, er fordert so eine Art Bewusstwerdung, eine Klärung des eigenen Bewusstseins heraus und möchte dann im Anschluss daran, dass sich die Dinge doch mehr oder minder von selbst ergeben. Und er hat – finde ich – auch das Zutrauen, dass das passieren wird.
Die Rolle, die er dem Staat bei alledem zuweist, ist die Rolle als Regelsetzer. Und da sind Sie wieder ganz lupenrein in dem Konzept der ordnungspolitischen Schule.
Ulrike Ackermann: Herr Brost, Sie wollten eben direkt dazu Stellung nehmen.
Marc Brost: Was mich bei Bolz am meisten verstört hat, war seine Kritik am vorsorgenden Sozialstaat. Wenn ich kurz mal zitieren darf, er sagte: "Durch den vorsorgenden Sozialstaat wird die Daseinsfürsorge präventiv." – Das ist richtig. Es werde geholfen, "auch wenn es noch gar keinen Bedarf gibt." – Und jetzt kommt es: "Konkret funktioniert das so, dass die Betreuer und Sozialarbeiter den Fürsorgebedarf durch die Benennung von Defiziten erzeugen." – Also, Fürsorgebedarf wird erst dadurch erzeugt, dass man Sozialarbeit macht. Ich finde, er stellt die ganze Debatte auf den Kopf. Denn im Grunde ist doch der vorsorgende Sozialstaat oder die Idee, dass man eben Defizite abstellt, bevor sie gesellschaftlich, auch ökonomisch-gesellschaftlich zu groß werden, dass man durch frühkindliche Bildung, durch die Chancen von Weiterbildung Arbeitslosigkeit zum Beispiel verhindert, dass man also in gewisser Weise nicht nur durch eine Regelsetzung, sondern dass eben auch durch die Erzeugung von Chancen – und das heißt, der Staat muss sich frühzeitig auch um gewisse Leute kümmern, die keine Chancen sonst haben – wieder Gerechtigkeit herstellt.
Für mich war der vorsorgende Sozialstaat eigentlich eine sinnvolle Weiterdefinition des nachsorgenden Sozialstaats, den wir zu lange hatten, dass wir eben dann erst zahlen, wenn im wahrsten Sinne des Wortes das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das stellt er jetzt, wie gesagt, aus meiner Sicht völlig auf den Kopf. Und ich verstehe es einfach nicht.
Ulrike Ackermann: Frau Horn, verstehen Sie es?
Karen Horn: Also, ich lege es zumindest auf eine bestimmte Art und Weise aus. Ich denke, dass er das nicht grundsätzlich in Abrede stellt, dass das nützlich ist, dass der Sozialstaat Strukturen bereit stellt, die der Vorsorge dienen. Aber es kann auch zu weit gehen. Also, nach meiner Interpretation ist es das, was er geißelt, dass er sagt, dass wir das so weit getrieben haben, dass der Wohlfahrtsstaat insgesamt so groß geworden ist, dass wir eben auch so flächendeckend vorsorgen gegen Dinge, dass das dazu führt, dass sich dann im Endeffekt die Menschen aus dieser Eigenverantwortung entlassen fühlen und dadurch eben die Defizite in der Tat entstehen.
Also, er spielt so ein bisschen da, glaube ich, auf der Anreizebene und sagt: Ein Staat, der zu viel Vorsorge treibt, nimmt den einzelnen Menschen das Heft des Handelns so weit aus der Hand. Dadurch wird das dann so eine Art self-fulfilling prophecy.
Ulrike Ackermann: Er spricht ja an anderer Stelle auch davon, dass wir einen "sozial gezähmten" Sozialstaat bräuchten und sieht in der Vergangenheit das große Problem, dass diese Form der Fürsorge und Vorsorge eine "Betreuten-Mentalität" produziert, die sozusagen zu einer "erlernten Hilflosigkeit" führt und letztendlich der Todfeind von Mut und Initiative des Einzelnen ist.
Marc Brost: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist Stand 2003, aber das waren ja gerade die viel zu spät letztendlich politisch etablierten, aber dann umso mehr notwendigen Reformen von Rot-Grün, also alles, was wir heute unter der Hartz-Gesetzgebung oder unter der Agenda 2010 subsumieren. Das hat sich ja geändert. Das Prinzip des Förderns und Forderns ist ja gerade auf der Ebene des Forderns und damit auch der finanziellen Anreize oder der finanziellen Verluste, wenn man es einmal so rum betrachtet, doch sehr stark durchgesetzt worden. Also, ich sehe nicht, dass es heute noch einen großen Anreiz gibt, sich nicht in die Gesellschaft einzubringen und auf irgendwelchen sozialen Wohltaten auszuruhen. Da, finde ich, müsste sich Bolz dann wiederum ehrlich machen. Wenn er schreibt, dass noch immer jede Transferleistung den Anreiz vermindert, die Armut durch eigene Anstrengung zu überwinden, dann muss er ganz klar sagen, dass er die Regelsätze für Hartz IV reduzieren will. Das lese ich an der Stelle aber nicht.
Ulrike Ackermann: Vielleicht kommen wir noch mal auf einen anderen Punkt bei Norbert Bolz, auf seine These: Er ist der Meinung, dass die moderne Wirtschaft eine soziale Software brauche und dass wir im Prinzip auch mit einem neuen Sozialkapital arbeiten müssten, nämlich mit Verknüpfungen, Beziehungen und Positionen. Ich möchte ihn ganz kurz einmal zitieren:
"Die zentrale Formel", so Bolz, "unserer Zeit lautet: Netzwerk = Wettbewerb + Zusammenarbeit. Die Gelegenheiten, die Netzwerke bieten, erzeugen die Motivation zum Schenken, Teilen und Zusammenarbeiten. Deshalb kann man von der Geburt des Sozialkapitalismus aus dem Geist der Netzwerke sprechen." Und bei den Netzwerken denkt er natürlich insbesondere an das Internet, also das Prozesse der Selbstorganisation von Netzwerken überhaupt erst ermöglicht.
Seine Sichtweise auf diese Form, diese Bedeutung des Internets, ist natürlich äußerst optimistisch. Er sieht mit dieser Form des Internets, mit dieser Entstehung neuer Netzwerke sozusagen die Schwungfeder für diesen neuen Sozialkapitalismus, wie er ihn nennt. Ist sein Optimismus da berechtigt, Frau Horn?
Karen Horn: Das ist auch wieder eine sehr schwierige Frage. Ich denke grundsätzlich, dass das Internet die Infrastruktur bereitstellt für Netzwerke, für eine stärkere Vernetzung und insofern auf jeden Fall das Potenzial dazu hat.
Was wir sehen in der Internetgesellschaft, ist ja auch zugleich, und das weiß er, glaube ich, als Soziologe auf jeden Fall auch, eine Segmentierung, auch wieder eine Gruppenbildung. Also, die Gesellschaft differenziert sich wieder aus in verschiedene Typen von Leuten, die eben in bestimmten Ecken des Netzes unterwegs sind. Also, es ist nicht etwas, was einen Konsens sozusagen oder einen generellen Zugang zu den gleichen Inhalten quer durch die gesamte Gesellschaft bietet und generiert. Das ist nicht der Fall, sondern wir erleben eine Ausdifferenzierung mit verschiedenen Segmentierungen.
Aber immerhin, die Infrastruktur ist dafür da, dass sich eben diese, dann vielleicht nicht ganz allumfassenden, sondern kleineren Netzwerke bilden können und dass man auch von Netzwerk zu Netzwerk hüpfen kann, wenn man das möchte.
Der Infrastrukturgedanke ist wichtig, weil der eben erlaubt, dass man miteinander in Kontakt tritt und – wie das der Ökonom immer gerne sagt – Austausch miteinander betreibt. Das bezieht sich aber eben nicht nur auf ökonomische Dinge, sondern Austausch ist im weitesten Sinne gedacht. Und da knüpft Bolz eigentlich an, ohne das explizit so zu sagen. Und wahrscheinlich lehnt er sich auch inhaltlich gar nicht so sehr an, aber es läuft auf dasselbe hinaus. Die Argumentation von Bolz läuft vergleichsweise parallel zu dem, was im Oktober noch mal in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt sein dürfte, nämlich die Arbeiten der neuen Wirtschaftsnobelpreisträger. Elinor Ostrom jedenfalls hat sehr stark über diese Frage, was ist Sozialkapital, wie kommt es zustande, geschrieben. Und das ist, glaube ich, ein sehr ertragreicher Ansatz.
Ulrike Ackermann: Kommen wir noch mal ganz kurz auf die aktuelle Situation zu sprechen. Ein kurzes Statement: Fördert die schwarz-gelbe Regierung mit ihrer Politik derzeit eher eine Betreuungs-Mentalität, eine Mentalität der Hilflosigkeit, so wie es Bolz kritisiert, oder stärkt sie eher den Mut und die Initiative des Einzelnen?
Marc Brost: Ich glaube, dass man diese Frage im Augenblick gar nicht beantworten kann, weil die Regierung alles tut, um ihre Motive zu verschleiern und die wahre Regierung beziehungsweise der wahre Koalitionsvertrag erst nach der NRW-Wahl im Mai 2010 sichtbar wird. Alles, was wir jetzt erleben, ist eine Art Fortsetzung der Großen Koalition mit anderen Mitteln. Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das ich vorhin kritisiert habe, kann man en detail kritisieren, verändert aber ja nichts an der großen Stoßrichtung. Insofern würde ich sagen, man kann auf diese Frage jetzt noch keine Antwort geben, ich zumindest nicht.
Ulrike Ackermann: Wir sprachen heute über das von Karen Horn und Katja Gentinetta herausgegebene Buch "Abschied von der Gerechtigkeit. Für eine Neujustierung von Freiheit und Gleichheit im Zeichen der Krise", erschienen im Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und über das Buch von Norbert Bolz "Profit für alle. Soziale Gerechtigkeit neu denken", erschienen im Murmann Verlag.
Zum Abschluss möchte ich meine beiden Gäste nun bitten, selbst noch eine Buchempfehlung auszusprechen. Frau Horn.
Karen Horn: Ja, ein Buch, das ich immer wieder gern in die Hand nehme, das nicht ganz neu ist, aber aus dem Jahr 2002 kommt, ist von Thomas Sowell "A conflict of visions", also, "Ein Konflikt der Visionen". Es geht, wie es im Untertitel heißt, um "Ideological origins of political struggles", also die ideologischen Wurzeln politischer Kämpfe.
Ulrike Ackermann: Herr Brost, Ihr Vorschlag bitte.
Marc Brost: Mein Vorschlag heißt "This time is different." – "Dieses Mal ist alles anders", ein Buch, das Kenneth Rogoff geschrieben hat, der frühere Chefökonom des IWF, und das uns acht Jahrhunderte voll finanzieller Verrücktheiten und auch Wirtschaftskrisen erklären soll. "Dieses Mal ist alles anders" wäre der deutsche Titel. Das sagen sich die Leute jedes Mal, wenn die nächste Blase entsteht. Und dann kommt's doch wieder zum Crash.
Ulrike Ackermann: Ich wiederhole noch mal kurz die empfohlenen Titel: Thomas Sowell "A conflict of visions", erschienen im Verlag Basic Books, 2007, und Kenneth Rogoff und Carmen Reinhart "This time ist different", erschienen im Verlag Princeton University Press, 2009.
Herzlichen Dank Karin Horn und Marc Brost für dieses Gespräch. Festzuhalten bleibt, wenn soziale Gerechtigkeit in eins gesetzt wird mit sozialer Gleichheit, erdrückt sie wohl eher die Freiheit und Tatkraft der vielen Einzelnen, die unsere offene Gesellschaft lebendig halten und für ihre Fortentwicklung sorgen.
Darüber wollen wir heute reden. Im Studio begrüße ich dazu Dr. Karen Horn, Volkswirtin und Leiterin des Hauptstadtbüros des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln. Guten Tag, Frau Horn.
Karen Horn: Guten Tag, Frau Ackermann.
Ulrike Ackermann: Und Marc Brost, Wirtschaftsredakteur des Hauptstadtbüros der "ZEIT", guten Tag, Herr Brost.
Marc Brost: Guten Tag.
Ulrike Ackermann: Zwei Bücher stehen heute im Zentrum unserer Diskussion, zum einen das von Karen Horn und Katja Gentinetta herausgegebene Buch "Abschied von der Gerechtigkeit. Für eine Neujustierung von Freiheit und Gleichheit im Zeichen der Krise" und zum anderen das Buch das Medienwissenschaftlers Norbert Bolz "Profit für alle. Soziale Gerechtigkeit neu denken", so der Titel.
Doch zunächst zu Ihrem Buch, Frau Horn. An welchen Kriterien lässt sich Gerechtigkeit eigentlich messen?
Karen Horn: Ja, Frau Ackermann, da stellen Sie die schwierigste Frage gleich am Anfang. Genau mit diesem Problem wollten wir uns in diesem Buch beschäftigen und haben sich die Autoren, deren Essays wir in dem Buch versammelt haben, auch in der Tat beschäftigt. In der Regel ist es so, dass Gerechtigkeit zusammenschrumpft auf das Kriterium der Gleichheit, und zwar der materiellen Gleichheit, weil das eben das ist, was man am einfachsten messen kann. Sie schauen sich einfach Einkommen und eventuell noch Vermögensbestände an.
In der philosophischen Tradition reicht das aber natürlich überhaupt nicht aus, sondern da richtet man den Blick lieber auf eine formelle Gleichheit, eine Gleichheit, die dann mit Rechten zu tun hat, also, dass jeder das gleiche Recht hat und mit dem Verfahren, wie es in der Gesellschaft angewandt ist, einverstanden sein kann. Das ist eine etwas andere Perspektive, die sich in Zahlen nicht so leicht messen lässt, sondern eben in mehr formellen Kriterien. Die ist allerdings auch etwas schwieriger zu vermitteln. Ich glaube, das relevante Kriterium ist in der Tat insofern immer noch tatsächlich die materielle Gleichheit, als dass es das ist, worauf die meisten Leute schauen. Darauf muss man auch sicherlich Antworten finden.
Wir haben den Titel unseres Buches bewusst so gewählt. Es war zwar nicht unsere Idee, die Idee kommt von Paul Nolte, das "Abschied von der Gerechtigkeit" zu nennen. Aber wir haben uns auf diesen provokanten Titel eingelassen und ihn gerne übernommen, weil wir meinen, dass die Sozialromantik, die sich an diesem Gerechtigkeitsbegriff misst oder an ihm ansetzt, der dann wiederum auf materielle Fragen enggeführt ist, nicht weit führt und dass man sich von genau dem verabschieden sollte.
Ulrike Ackermann: Herr Brost, das Stichwort Sozialromantik ist gefallen. Sehen Sie das auch so, was den Begriff der sozialen Gerechtigkeit anlangt?
Marc Brost: Das Problem beim Begriff der sozialen Gerechtigkeit ist, glaube ich, dass es ein ausgehöhlter Begriff ist, der in der politischen Debatte benutzt wird, von links wie von der liberalen Seite, von oben wie von unten. Und jeder versteht unter Gerechtigkeit etwas anderes. Frau Horn sagte gerade zu Recht, die Meisten würden aus dem Bauch heraus materielle Gleichheit als das Anstrebenswerte halten. Wenn man sich dann selbst hinterfragt oder auch mal neuere Erkenntnisse der Verhaltensökonomie zum Beispiel anschaut, dann kommt man drauf, dass materielle Gleichheit so nie existieren wird. Die Meisten von uns würden lieber in einer Welt leben, in der sie selbst 75.000 Euro verdienen und die anderen 60.000, als dass sie 90.000 verdienen und die anderen 100.000. Also, man vergleicht sich die ganze Zeit. Man schaut danach, was Andere haben. Man strebt nach mehr. Man strebt nach Wohlstand, man will Andere überholen. Das ist das Kernelement des Wettbewerbs.
Ich finde, es gibt zwei Gerechtigkeitsbegriffe, auf die man sich konzentrieren sollte. Das eine ist die Frage der Leistungsgerechtigkeit, womit natürlich dann wiederum einhergeht: Wer sind eigentlich die Leistungsträger in der Gesellschaft? Da gibt es, das haben wir im Wahlkampf gesehen, schon ganz unterschiedliche Antworten. Die christlich-bürgerliche Koalition, die christlich-liberale Koalition hat einen anderen Fokus auf Leistungsträger als das politisch linke Lager. Und der zweite Begriff ist die Chancengerechtigkeit. Das ist der für mich elementarste und wichtigste Begriff, weil er letztendlich das Wohlstandsversprechen der sozialen Marktwirtschaft in sich trägt. Wer hat wirklich Möglichkeiten, an Wohlstand teilzuhaben, den die Gesellschaft insgesamt erwirtschaftet?
Ulrike Ackermann: Friedrich von Hayek hat davon gesprochen, dass "soziale Gerechtigkeit Unsinn" sei. Unser Gespräch entwickelt sich ja auch ein bisschen in die Richtung, tatsächlich diesen Begriff auszudifferenzieren. Man kann ja vielleicht einfach mal an diesen drei Größen sich orientieren: Also, Gerechtigkeit als Rechtsgleichheit, was heißt das eigentlich? Gerechtigkeit als Chancengleichheit? Und in der dritten Kategorie: Gerechtigkeit als Ergebnisgleichheit? Und das, scheint mir, läuft ja dann doch wieder in Richtung materielle Gleichheit.
Karen Horn: Ja, auf jeden Fall. Darf ich kurz noch mal auf Hayek eingehen? Das ist nämlich immer ein ganz guter Punkt, an dem man sich reiben kann, um auch die eigenen Begriffe so ein bisschen zu schärfen. Er hat gesagt: Der Begriff soziale Gerechtigkeit mache ungefähr so viel Sinn wie der Begriff "ein moralischer Stein". Also, es passe einfach gar nicht zusammen.
Was er damit sagen wollte oder was seine dahinter verborgene Überlegung war, war, dass Gerechtigkeit einen Tauschakt eigentlich voraussetzt, also, dass ich mich zum Beispiel mit Ihnen in einem Tauschprozess engagiere. Das heißt, ich gebe Ihnen etwas und ich erwarte auch etwas dafür zurück. Und wir gehen insofern gerecht miteinander um, als wir uns das geben, was dem jeweils Hingegebenen auch entspricht.
Wenn es aber kein handelndes Individuum gibt, von dem man eine solche Gerechtigkeit im Tauschakt verlangen kann, dann entbehrt das Konzept der Grundlage. Er sagt einfach: Damit es Gerechtigkeit geben kann und damit der Begriff irgendwie Sinn ergibt, muss es einen handelnden Menschen geben. Und wenn man von sozialer Gerechtigkeit spricht, denkt man an eine Gesellschaft. Die Gesellschaft ist zwangsläufig ein Kollektiv und keine einzelne handelnde Persönlichkeit. Und er meinte eben, da macht der Begriff überhaupt keinen Sinn.
Das ist, glaube ich, zwar logisch sauber, aber es führt letztlich dann doch irgendwie nicht weiter, weil in der Gesellschaft diese Befindlichkeit in der Tat vorhanden ist. Die Menschen möchten, dass ihr Gemeinwesen auf eine Art und Weise organisiert ist, dass elementare Gerechtigkeitsvorstellungen auch dabei berücksichtigt und realisiert werden. Und da kommt man dann eben auf verschiedene Möglichkeiten, das zu fassen, diesen Begriff umzusetzen, mit Inhalt zu füllen. Und, wie Sie schon sagten, Rechtsgleichheit ist eben der erste und – ich denke – für mich auch wichtigste Ansatzpunkt. Da geht es darum, dass die Regeln, in denen unser gesellschaftliches Leben sich abspielt, so gefasst sind, dass sie für uns alle in gleicher Weise gelten, dass es also keine Diskriminierung im Negativen und auch keine Privilegierung im Positiven gibt, sondern dass wir – weil wir als Menschen erst mal alle gleich sind – auch gleiche Rechte haben. Das ist, glaube ich, wirklich die Grundlage dessen, wie ein Gemeinwesen organisiert sein sollte. Aber dass ich sage, dass es so organisiert sein sollte, zeigt vielleicht auch schon, auf welcher Ebene ich mich bewege, nämlich auf der Regelebene und nicht auf der Ebene der Ergebnisse des gesellschaftlichen Prozesses. Ergebnisse haben Sie angesprochen in Ihrem dritten Kriterium, der Ergebnisgerechtigkeit.
Das sind zwei sehr unterschiedliche Ansatzpunkte. Und genau dieser Unterschied ist von großer Bedeutung. Denn wenn Sie meinen, an den Ergebnissen schon ablesen zu können, ob Gerechtigkeit herrscht oder nicht, dann ist es Ihnen egal, auf welchem Wege sie letztlich da hinkommen. Und dann könnten Sie dafür auch wunderbar ein totalitäres System akzeptieren. Und darum kann es nicht gehen.
Marc Brost: Das Spannende an dem Buch von Frau Horn finde ich neben diesen sehr spannenden und intellektuell herausfordernden Essays, die sie und ihre Co-Autorin zusammengetragen hat, eigentlich den Statistikteil. Das hört sich jetzt salopper und braver an, als es de facto ist. Denn das Schwierige ist ja tatsächlich, Gleichheit beziehungsweise soziale Gerechtigkeit zu messen. Es gibt dafür verschiedene Kriterien. Und ich finde, dass die Autorinnen da die relevanten Zahlen zusammengetragen haben, die auch noch mal einen interessanten Blick veröffentlichen.
Ich würde gern zwei zitieren. Das eine ist die Frage Lohnungleichheit in OECD-Ländern, also in den westlichen Industrienationen. Dort haben die Autorinnen herausgefunden, dass die Lohnungleichheit bis 2005, das war quasi bis zum Beginn des letzten Aufschwungs, deutlich zugenommen hat. Das ist natürlich die Erklärung dafür, warum die Hartz-Reformen, die notwendig waren, oder die gesamten Reformen der damaligen rot-grünen Regierung gesellschaftlich so umstritten waren, weil sie in eine Phase gefallen sind, in der der Einzelne von diesen Reformen erst mal nichts hatte. Das zeigt, wenn man über Gerechtigkeit spricht oder auch Gerechtigkeit herstellen will – die Reformen damals dienten ja dazu, langfristig eine Gesellschaft gerechter, fairer, wettbewerbsorientierter zu machen -, dass man sie irgendwie politisch verankern muss. Das funktionierte nicht. Das ist ein wesentlicher Grund, warum diese Reformen damals und vielleicht auch noch heute gesellschaftlich so nicht akzeptiert sind.
Die noch spannendere Grafik war die, in der Sie gefragt haben, ob staatliche Transfers eigentlich denen zugute kommen, die wirklich etwas davon haben sollten. Sie haben unterschieden zwischen den ärmeren und den reicheren Bevölkerungsgruppen, wenn ich das mal so holzschnittartig darstellen darf, und haben herausgefunden, dass staatliche Transfers nicht in dem Maße denen zugute kommen, denen sie eigentlich zugute kommen sollten, also, den ärmeren Bevölkerungsschichten. Und da sind wir mitten in der aktuellen politischen Debatte, wenn wir über Wachstumsbeschleunigungsgesetz reden und die Frage, was die bürgerliche schwarz-gelbe Regierung da jetzt tut. - Kindergelderhöhung, Kinderfreibetrag, auch Mehrwertsteuersenkung für Hoteliers - , ist das wirklich die Politik und sind das die Transfers beziehungsweise auch die Steuergeschenke, die wir in dieser Situation brauchen? Mittelbar lese ich aus dieser Grafik: Nein, die brauchen wir nicht. Wir hätten andere gebraucht.
Ulrike Ackermann: Merkwürdig ist doch nun, dass das Gefühl der Ungerechtigkeit in der Öffentlichkeit – obwohl sich auch das Durchschnittseinkommen seit dem Zweiten Weltkrieg verdreifacht hat, der Lebensstandard gestiegen ist – stark ist, was zuweilen auch befördert wird, wenn man beobachtet, dass nun auch von der politischen Klasse dieser Begriff soziale Gerechtigkeit insbesondere in Wahlkampfzeiten gerne aufgegriffen wird.
Karen Horn: Das kann ich bestätigen. Ich glaube, man kann mit diesem Gefühl der Ungerechtigkeit, das offensichtlich – wie gesagt – tatsächlich vorhanden ist, einfach sehr gut Politik machen. Man kann das ansprechen. Also, ein Appell an Gerechtigkeit ist etwas, was nie irgendwo auf taube Ohren stoßen wird. Insofern kann man da aber auch alles Mögliche drunter subsumieren und versuchen zu verkaufen.
Es ist, wie wir bei dem von Herrn Brost schon erwähnten Faktenteil in unserem Buch gemerkt haben, nicht so einfach, sich da ein umfassendes Bild zu machen und die diversen, sich gegenseitig konterkarierenden Aspekte dann gegeneinander aufzurechnen. Das ist wirklich schwierig. Und gerade weil das so schwierig und so komplex ist, fällt es im politischen Diskurs einfach unter den Tisch und man kann sich deswegen noch besser auf einzelne Aspekte fokussieren und die dann entsprechend politisch vermarkten. Ich glaube, das funktioniert einfach immer wieder gut in der politischen Diskussion.
Mir wäre sehr daran gelegen, dass man das Ganze ein bisschen mehr rationalisiert und ein bisschen eben durch Fakten auch zur Aufklärung beiträgt und den Fokus vielleicht ein wenig wieder verschiebt von den rein materiellen Fragen. Denn nur darum kann es nicht gehen.
Noch eine kleine Anmerkung zu den Kommentaren eben zu unserem Faktenteil: Wir haben festgestellt, dass der Sozialstaat in Deutschland insofern ja recht gut funktioniert, als ein Großteil der Ungleichheiten ja tatsächlich eingeebnet wird. Es geht aber darüber hinaus. Und es gibt eben Umverteilungsmaßnahmen, die eigentlich genau das Gegenteil dessen erzielen, was wir eigentlich beabsichtigen. Das passiert genau dann, wenn man bestimmte Gerechtigkeitsaspekte so politisiert, dass man Zustimmung dafür erntet, ohne dass die Leute genau hingucken, was damit passiert.
Ein Beispiel, wenn ich eins geben darf, etwas, was wir schon lange kritisieren, ist die Frage der Studienfinanzierung in Deutschland. Wir leisten uns da massiv eine Umverteilung nach oben. Und irgendwie hat sich da noch niemanden gefunden, der da massiv gegen Stellung bezieht. Das wundert mich eigentlich seit Jahr und Tag.
Marc Brost: Insofern ist ja eigentlich so eine Krise auch ein schöner Anlass, nicht nur über soziale Gerechtigkeit nachzudenken, was – glaube ich – beide Bücher, die wir heute besprechen, sehr gut machen, sondern über die Frage: Was ist eigentlich noch mal das Kernelement der sozialen Marktwirtschaft? Wo wollen wir hin? Das ist ja auch so ein Begriff, der im Wahlkampf von allen, zumindest demokratisch verankerten Parteien, wie selbstverständlich benutzt wurde, jeweils mit einer anderen Intention. Auch dieser Begriff ist natürlich ausgehöhlt. Jeder beruft sich auf Ludwig Erhard oder auf Ordnungspolitik oder auf das Soziale an der Marktwirtschaft und versteht darunter was anderes.
Wenn Sie nach der Akzeptanz von Reformen und von Gerechtigkeit oder nach dem Ruf gefragt haben, Frau Ackermann, warum alles so ungerecht sei in diesem Land, warum die Bürger das Gefühl haben, dann würde ich ganz gern noch mal auf die Situation vor der Krise zurückkommen. Das ist ja noch nicht so lange her. Das waren die Jahre 2006/2007, in denen wir einen sehr starken Wirtschaftsaufschwung hatten, in denen wir hohe Steuereinnahmen hatten, möglichst damit verbunden eben auch plötzlich politische Flexibilitäten, in denen wir politisch gestalten konnten, und in denen wir eigentlich auch Dinge hätten verändern können im Sinne von Frau Horn, dass man einige Teile der Gesellschaft mehr belastet, andere deutlich entlastet, und im Sinne einer Neudefinition der sozialen Marktwirtschaft wirklich ein paar Stellschrauben verändert.
Wichtig aber, finde ich, ist, wenn man sich diesen Aufschwung noch mal anschaut – und jetzt zitiere ich die ideologisch unverdächtige Bundesbank -, es war der erste Aufschwung in der Geschichte der Republik, in dem die Realeinkommen nicht gestiegen, sondern gesunken sind. Also, die soziale Marktwirtschaft war – provokant formuliert – nicht mehr so sozial, wie sie davor sehr lange gewesen ist. Und das ist das Kernelement unserer Diskussion. Das ist der Grund, warum viele Bürger diese Gesellschaft als ungerecht, unsozial, ja eben nicht mehr zeitgemäß empfinden.
Ulrike Ackermann: Sie geben da genau das richtige Stichwort, Herr Brost. Wir können damit zu dem zweiten Buch übergehen, nämlich jenes von Norbert Bolz. Er fordert ein "neues Verständnis von sozialer Gerechtigkeit". Also, er verwirft diesen Begriff nicht völlig und beobachtet den Aufstieg eines – von ihm so genannten – "Sozialkapitalismus", der die Idee der Brüderlichkeit im 21. Jahrhundert verwirklichen wird – so seine These.
Herr Brost, Sie haben das Buch gelesen. Was halten Sie von diesem Szenario dieses Sozialkapitalismus, diesem Begriff, den Norbert Bolz hier einführt?
Marc Brost: Kurz geantwortet würde ich sagen: guter Ansatz, schlechte Ausführung. Ich halte das für einen hochinteressanten Versuch, aus der Sicht eines Soziologen diese notwendige Neudefinition der sozialen Marktwirtschaft zu wagen. Er versucht das auch, indem er ganz anders auf die Dinge blickt, nicht per se ökonomisch oder politisch, indem er sich soziale Netzwerke anschaut, indem er soziales Unternehmertum thematisiert, also so eine Art selbstreinigende Kraft des Kapitalismus von innen heraus. Also, er gibt die Marktwirtschaft nicht per se verloren. Das finde ich ganz, ganz wichtig, denn soziale Marktwirtschaft ist ja eine Erfolgsgeschichte in Deutschland.
Wenn ich mich dann aber eben frage, ja, was sind denn die Beispiele für soziales Unternehmertum, wo sieht er empirisch als eine Art Graswurzelbewegung denn schon was entstehen, lässt er mich ratlos und damit am Ende auch einigermaßen hilflos zurück. Ich finde die These sehr spannend, kann mit ihr aber am Ende nicht arbeiten, weil sie nicht fundiert und nicht ausgearbeitet wird.
Ulrike Ackermann: Bolz sagt ja, dass soziale Gerechtigkeit gerade nicht durch staatliche Umverteilung herstellbar sei, sondern durch die Produktion eines sozialen Reichtums, von dem alle profitieren. Er spricht von einer "äußeren Balance", die gefunden werden muss zwischen "ökologischer Ökonomie", also grünem Kapitalismus, und der "inneren Balance" unserer Gesellschaft durch eine "Versöhnung von Profitmotiv und Verantwortung". Das sind für ihn alles so Begrifflichkeiten, die diesen sozialen Kapitalismus oder Sozialkapitalismus ausmachen.
Frau Horn, als Volkswirtin, was halten Sie von dieser Idee?
Karen Horn: Im Grunde ist das, was er da entwirft, eine Variante oder noch nicht mal eine Variante, sondern einfach eine andere Formulierung dessen, was wir unter dem Slogan "Wohlstand für Alle" schon mal gehört haben. Er nennt es eben "Profit für Alle". Das hat bei mir dazu geführt, dass ich, als ich das Buch in die Hand bekam und den Inhalt eben noch nicht kannte, erst mal ziemlich erschrocken zusammengefahren bin. Das erinnerte mich so an die Wahlkampfplakate der Linken. Aber damit hat es nun gar nichts zu tun. Es geht wirklich im Grunde um den Erhardschen Ansatz. Es geht darum, dass die Regelwerke in unserer Gesellschaft so gesetzt werden, dass Wohlstand entsteht, und zwar ein Wohlstand, den er nicht gerne so enggeführt nur auf das Bruttoinlandsprodukt gefasst sehen möchte, sondern er versucht gleichzeitig auch noch abzugreifen, dass uns auch noch andere Dinge glücklich machen außer dem reinen materiellen Wohlstand, also, dass wir auch einen gewissen Sinn im Leben brauchen, dass wir auch unserem Miteinander diesen Sinn ziehen. Daher kommt dieser Aspekt des "sorgenden Kapitalismus", wie er es nennt.
Also, ich möchte eigentlich ein bisschen milder mit ihm umgehen. Ich finde, er benutzt einfach andere Worte, um zu sagen, dass eben dieses Modell der sozialen Marktwirtschaft, wie es Ludwig Erhard in Deutschland durchgesetzt hat, eigentlich ein ganz gutes Modell ist, dass man das auch wieder entdecken sollte, dass man es pflegen sollte. Er benutzt dafür moderne Ausdrücke, aber im Grunde geht es um nichts anderes. Und er setzt auf Kooperation. Er setzt darauf, dass diese Dinge, was Sie erwähnt haben mit dem ökologischen Aspekt zum Beispiel und mit der Nachhaltigkeit und so weiter, dass die auch von selbst sich einrichten, wenn denn die Menschen miteinander umgehen, also dass das eigentlich ein automatisches Resultat der gesellschaftlichen Interaktion ist.
Und als Soziologe schaltet er noch etwas vor, was ich spannend finde, nämlich die Tatsache, dass eine Gesellschaft auch einen Diskurs über diese Dinge braucht, dass sie sich klar werden muss über den Sinn, den die Menschen ihrem Leben geben wollen, die Frage der Moral, die die Menschen miteinander leben wollen. Also, er fordert so eine Art Bewusstwerdung, eine Klärung des eigenen Bewusstseins heraus und möchte dann im Anschluss daran, dass sich die Dinge doch mehr oder minder von selbst ergeben. Und er hat – finde ich – auch das Zutrauen, dass das passieren wird.
Die Rolle, die er dem Staat bei alledem zuweist, ist die Rolle als Regelsetzer. Und da sind Sie wieder ganz lupenrein in dem Konzept der ordnungspolitischen Schule.
Ulrike Ackermann: Herr Brost, Sie wollten eben direkt dazu Stellung nehmen.
Marc Brost: Was mich bei Bolz am meisten verstört hat, war seine Kritik am vorsorgenden Sozialstaat. Wenn ich kurz mal zitieren darf, er sagte: "Durch den vorsorgenden Sozialstaat wird die Daseinsfürsorge präventiv." – Das ist richtig. Es werde geholfen, "auch wenn es noch gar keinen Bedarf gibt." – Und jetzt kommt es: "Konkret funktioniert das so, dass die Betreuer und Sozialarbeiter den Fürsorgebedarf durch die Benennung von Defiziten erzeugen." – Also, Fürsorgebedarf wird erst dadurch erzeugt, dass man Sozialarbeit macht. Ich finde, er stellt die ganze Debatte auf den Kopf. Denn im Grunde ist doch der vorsorgende Sozialstaat oder die Idee, dass man eben Defizite abstellt, bevor sie gesellschaftlich, auch ökonomisch-gesellschaftlich zu groß werden, dass man durch frühkindliche Bildung, durch die Chancen von Weiterbildung Arbeitslosigkeit zum Beispiel verhindert, dass man also in gewisser Weise nicht nur durch eine Regelsetzung, sondern dass eben auch durch die Erzeugung von Chancen – und das heißt, der Staat muss sich frühzeitig auch um gewisse Leute kümmern, die keine Chancen sonst haben – wieder Gerechtigkeit herstellt.
Für mich war der vorsorgende Sozialstaat eigentlich eine sinnvolle Weiterdefinition des nachsorgenden Sozialstaats, den wir zu lange hatten, dass wir eben dann erst zahlen, wenn im wahrsten Sinne des Wortes das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das stellt er jetzt, wie gesagt, aus meiner Sicht völlig auf den Kopf. Und ich verstehe es einfach nicht.
Ulrike Ackermann: Frau Horn, verstehen Sie es?
Karen Horn: Also, ich lege es zumindest auf eine bestimmte Art und Weise aus. Ich denke, dass er das nicht grundsätzlich in Abrede stellt, dass das nützlich ist, dass der Sozialstaat Strukturen bereit stellt, die der Vorsorge dienen. Aber es kann auch zu weit gehen. Also, nach meiner Interpretation ist es das, was er geißelt, dass er sagt, dass wir das so weit getrieben haben, dass der Wohlfahrtsstaat insgesamt so groß geworden ist, dass wir eben auch so flächendeckend vorsorgen gegen Dinge, dass das dazu führt, dass sich dann im Endeffekt die Menschen aus dieser Eigenverantwortung entlassen fühlen und dadurch eben die Defizite in der Tat entstehen.
Also, er spielt so ein bisschen da, glaube ich, auf der Anreizebene und sagt: Ein Staat, der zu viel Vorsorge treibt, nimmt den einzelnen Menschen das Heft des Handelns so weit aus der Hand. Dadurch wird das dann so eine Art self-fulfilling prophecy.
Ulrike Ackermann: Er spricht ja an anderer Stelle auch davon, dass wir einen "sozial gezähmten" Sozialstaat bräuchten und sieht in der Vergangenheit das große Problem, dass diese Form der Fürsorge und Vorsorge eine "Betreuten-Mentalität" produziert, die sozusagen zu einer "erlernten Hilflosigkeit" führt und letztendlich der Todfeind von Mut und Initiative des Einzelnen ist.
Marc Brost: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist Stand 2003, aber das waren ja gerade die viel zu spät letztendlich politisch etablierten, aber dann umso mehr notwendigen Reformen von Rot-Grün, also alles, was wir heute unter der Hartz-Gesetzgebung oder unter der Agenda 2010 subsumieren. Das hat sich ja geändert. Das Prinzip des Förderns und Forderns ist ja gerade auf der Ebene des Forderns und damit auch der finanziellen Anreize oder der finanziellen Verluste, wenn man es einmal so rum betrachtet, doch sehr stark durchgesetzt worden. Also, ich sehe nicht, dass es heute noch einen großen Anreiz gibt, sich nicht in die Gesellschaft einzubringen und auf irgendwelchen sozialen Wohltaten auszuruhen. Da, finde ich, müsste sich Bolz dann wiederum ehrlich machen. Wenn er schreibt, dass noch immer jede Transferleistung den Anreiz vermindert, die Armut durch eigene Anstrengung zu überwinden, dann muss er ganz klar sagen, dass er die Regelsätze für Hartz IV reduzieren will. Das lese ich an der Stelle aber nicht.
Ulrike Ackermann: Vielleicht kommen wir noch mal auf einen anderen Punkt bei Norbert Bolz, auf seine These: Er ist der Meinung, dass die moderne Wirtschaft eine soziale Software brauche und dass wir im Prinzip auch mit einem neuen Sozialkapital arbeiten müssten, nämlich mit Verknüpfungen, Beziehungen und Positionen. Ich möchte ihn ganz kurz einmal zitieren:
"Die zentrale Formel", so Bolz, "unserer Zeit lautet: Netzwerk = Wettbewerb + Zusammenarbeit. Die Gelegenheiten, die Netzwerke bieten, erzeugen die Motivation zum Schenken, Teilen und Zusammenarbeiten. Deshalb kann man von der Geburt des Sozialkapitalismus aus dem Geist der Netzwerke sprechen." Und bei den Netzwerken denkt er natürlich insbesondere an das Internet, also das Prozesse der Selbstorganisation von Netzwerken überhaupt erst ermöglicht.
Seine Sichtweise auf diese Form, diese Bedeutung des Internets, ist natürlich äußerst optimistisch. Er sieht mit dieser Form des Internets, mit dieser Entstehung neuer Netzwerke sozusagen die Schwungfeder für diesen neuen Sozialkapitalismus, wie er ihn nennt. Ist sein Optimismus da berechtigt, Frau Horn?
Karen Horn: Das ist auch wieder eine sehr schwierige Frage. Ich denke grundsätzlich, dass das Internet die Infrastruktur bereitstellt für Netzwerke, für eine stärkere Vernetzung und insofern auf jeden Fall das Potenzial dazu hat.
Was wir sehen in der Internetgesellschaft, ist ja auch zugleich, und das weiß er, glaube ich, als Soziologe auf jeden Fall auch, eine Segmentierung, auch wieder eine Gruppenbildung. Also, die Gesellschaft differenziert sich wieder aus in verschiedene Typen von Leuten, die eben in bestimmten Ecken des Netzes unterwegs sind. Also, es ist nicht etwas, was einen Konsens sozusagen oder einen generellen Zugang zu den gleichen Inhalten quer durch die gesamte Gesellschaft bietet und generiert. Das ist nicht der Fall, sondern wir erleben eine Ausdifferenzierung mit verschiedenen Segmentierungen.
Aber immerhin, die Infrastruktur ist dafür da, dass sich eben diese, dann vielleicht nicht ganz allumfassenden, sondern kleineren Netzwerke bilden können und dass man auch von Netzwerk zu Netzwerk hüpfen kann, wenn man das möchte.
Der Infrastrukturgedanke ist wichtig, weil der eben erlaubt, dass man miteinander in Kontakt tritt und – wie das der Ökonom immer gerne sagt – Austausch miteinander betreibt. Das bezieht sich aber eben nicht nur auf ökonomische Dinge, sondern Austausch ist im weitesten Sinne gedacht. Und da knüpft Bolz eigentlich an, ohne das explizit so zu sagen. Und wahrscheinlich lehnt er sich auch inhaltlich gar nicht so sehr an, aber es läuft auf dasselbe hinaus. Die Argumentation von Bolz läuft vergleichsweise parallel zu dem, was im Oktober noch mal in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt sein dürfte, nämlich die Arbeiten der neuen Wirtschaftsnobelpreisträger. Elinor Ostrom jedenfalls hat sehr stark über diese Frage, was ist Sozialkapital, wie kommt es zustande, geschrieben. Und das ist, glaube ich, ein sehr ertragreicher Ansatz.
Ulrike Ackermann: Kommen wir noch mal ganz kurz auf die aktuelle Situation zu sprechen. Ein kurzes Statement: Fördert die schwarz-gelbe Regierung mit ihrer Politik derzeit eher eine Betreuungs-Mentalität, eine Mentalität der Hilflosigkeit, so wie es Bolz kritisiert, oder stärkt sie eher den Mut und die Initiative des Einzelnen?
Marc Brost: Ich glaube, dass man diese Frage im Augenblick gar nicht beantworten kann, weil die Regierung alles tut, um ihre Motive zu verschleiern und die wahre Regierung beziehungsweise der wahre Koalitionsvertrag erst nach der NRW-Wahl im Mai 2010 sichtbar wird. Alles, was wir jetzt erleben, ist eine Art Fortsetzung der Großen Koalition mit anderen Mitteln. Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das ich vorhin kritisiert habe, kann man en detail kritisieren, verändert aber ja nichts an der großen Stoßrichtung. Insofern würde ich sagen, man kann auf diese Frage jetzt noch keine Antwort geben, ich zumindest nicht.
Ulrike Ackermann: Wir sprachen heute über das von Karen Horn und Katja Gentinetta herausgegebene Buch "Abschied von der Gerechtigkeit. Für eine Neujustierung von Freiheit und Gleichheit im Zeichen der Krise", erschienen im Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und über das Buch von Norbert Bolz "Profit für alle. Soziale Gerechtigkeit neu denken", erschienen im Murmann Verlag.
Zum Abschluss möchte ich meine beiden Gäste nun bitten, selbst noch eine Buchempfehlung auszusprechen. Frau Horn.
Karen Horn: Ja, ein Buch, das ich immer wieder gern in die Hand nehme, das nicht ganz neu ist, aber aus dem Jahr 2002 kommt, ist von Thomas Sowell "A conflict of visions", also, "Ein Konflikt der Visionen". Es geht, wie es im Untertitel heißt, um "Ideological origins of political struggles", also die ideologischen Wurzeln politischer Kämpfe.
Ulrike Ackermann: Herr Brost, Ihr Vorschlag bitte.
Marc Brost: Mein Vorschlag heißt "This time is different." – "Dieses Mal ist alles anders", ein Buch, das Kenneth Rogoff geschrieben hat, der frühere Chefökonom des IWF, und das uns acht Jahrhunderte voll finanzieller Verrücktheiten und auch Wirtschaftskrisen erklären soll. "Dieses Mal ist alles anders" wäre der deutsche Titel. Das sagen sich die Leute jedes Mal, wenn die nächste Blase entsteht. Und dann kommt's doch wieder zum Crash.
Ulrike Ackermann: Ich wiederhole noch mal kurz die empfohlenen Titel: Thomas Sowell "A conflict of visions", erschienen im Verlag Basic Books, 2007, und Kenneth Rogoff und Carmen Reinhart "This time ist different", erschienen im Verlag Princeton University Press, 2009.
Herzlichen Dank Karin Horn und Marc Brost für dieses Gespräch. Festzuhalten bleibt, wenn soziale Gerechtigkeit in eins gesetzt wird mit sozialer Gleichheit, erdrückt sie wohl eher die Freiheit und Tatkraft der vielen Einzelnen, die unsere offene Gesellschaft lebendig halten und für ihre Fortentwicklung sorgen.
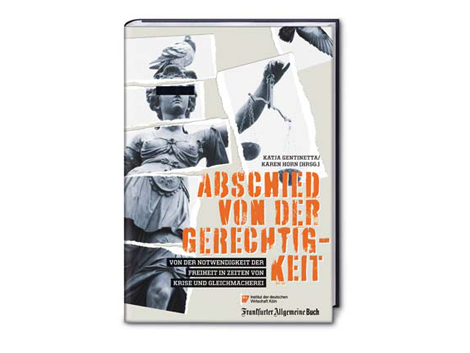
Karen Horn: "Abschied von der Gerechtigkeit"© promo
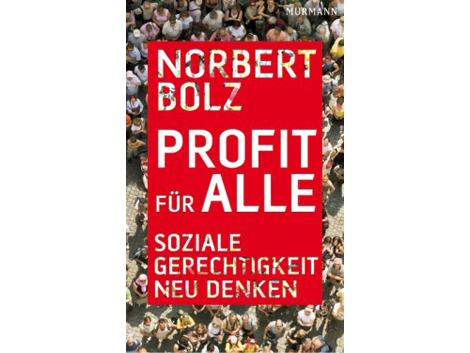
Norbert Bolz: "Profit für alle. Soziale Gerechtigkeit neu denken"© promo
