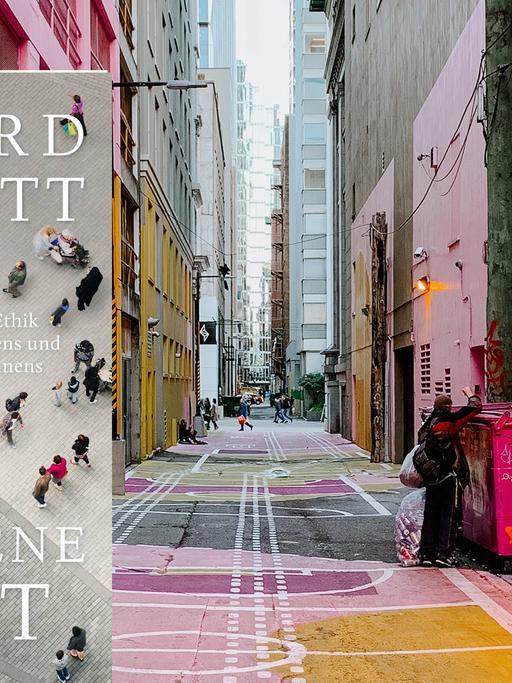Sprecherin: Frauke Poolman
Sprecher: Robert Frank, Joachim Schönfeld
Ton: Jan Fraune
Regie: Cordula Dickmeiss
Redaktion: Martin Hartwig
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019
Wie wollen wir in Zukunft leben?
31:52 Minuten

Der Soziologe Richard Sennett möchte Städte als offene Systeme denken, mit Freiräumen, die Bürger selbst gestalten können. Schöner werden Städte dadurch nicht unbedingt, aber menschlicher. Doch die Freiräume weichen oft standardisierten Apartmentbauten.
Die Koloniestraße in Wedding ist eine eher unauffällige Straße mit gleichgültigen Hausfassaden, stumpfer Stein, nicht besonders einladend. Nordberliner Tristesse. Es geht durch eine Toreinfahrt hindurch auf den Hof der Koloniestraße 10. Hier zeigt sich eine andere Welt, ein anderes Jahrtausend.
"Das ist ein Fuhrhof von 1880. Ursprünglich waren das Ställe. Dann später wurden das Werkstätten, das ist eine klassische Hofstruktur wie es sie früher im Wedding immer und überall gab", erzählt Marie Münch. Sie ist 30 Jahre alt und wohnt mit sieben anderen Menschen in dem alten Remisenhof. 17 weitere Leute leben im Vorderhaus. Es ist Frühjahr. Die Bewohner des Hofes bauen Vogelhäuschen.
"Das ist ein Fuhrhof von 1880. Ursprünglich waren das Ställe. Dann später wurden das Werkstätten, das ist eine klassische Hofstruktur wie es sie früher im Wedding immer und überall gab", erzählt Marie Münch. Sie ist 30 Jahre alt und wohnt mit sieben anderen Menschen in dem alten Remisenhof. 17 weitere Leute leben im Vorderhaus. Es ist Frühjahr. Die Bewohner des Hofes bauen Vogelhäuschen.
"Wir haben Vögel hier, Fledermäuse fliegen hier rum. Es bietet Schutz für Tiere, wir haben Bienen, Obstbäume. Im Sommer echt eine Oase. Weintrauben wachsen dahinten, kann sich jeder bedienen, Aprikosen, Pfirsiche."
Richard Sennett: "Die Idee einer offenen Stadt basiert für mich auf der Idee eines offenen Systems. Und ein offenes System versucht, verschiedene Elemente zu kombinieren, die oft komplex und widersprüchlich sind. Die sollen so kombiniert werden, dass sie über die Zeit erhalten bleiben."
Für die Bewohner ist der Remisenhof ein Paradies. Alte Garagen und Werkstätten rahmen das Gelände ein, Tanzschüler treffen auf Automechaniker, treffen auf Künstler. Kinder spielen im Hof, alte Leute sitzen in der Sonne. Über den Werkstätten haben sich Mieter in geräumigen Wohnungen eingerichtet.
Marie: "Und dann waren diese ganzen Gewerbeflächen, die ganzen Garagen, das war halt alles vermietet. Kühlerwerkstatt und dann waren Künstler hier drin, hier ist eine Tanzschule, war 20 Jahre drin, wo die Leute halt aus dem Kiez herkamen. Und hier war halt ordentlich was los."

Treffpunkt für die Bewohner aus dem Kiez: der "Künstlerhof Kolonie 10" im Wedding: Nun sollen hier neue Apartments entstehen.© imago
R. Sennett: "Eine offene Stadt steht im Kontrast zu einer geschlossenen Stadt, in der alles perfekt geplant ist, damit es zusammenpasst, eine Stadt, die die Komplexität der einzelnen Teile reduziert, damit alles mechanisch perfekt läuft. Gleichzeitig ist die geschlossene Stadt aber statisch. Und wir wollen, dass Städte dynamisch sind. Wir wollen Städte, in denen etwas passieren kann."
Der Hof macht zufällige Treffen mit Menschen möglich, die normalerweise aneinander vorbeigehen, ohne sich anzuschauen.
Schon 2016 wurde der Tanzschule und mehreren Werkstätten gekündigt. Die Erbengemeinschaft, der dieser Hof gehörte, hatte ihn an einen Immobilienfonds verkauft.
Chaotische Städte sind interessante Städte
Seit er in Städten wohnt, macht der Soziologe und Urbanist Richard Sennett immer wieder diese eine Beobachtung: "Ich hatte dieses intuitive Gefühl, als ich zum ersten Mal nach New York gezogen bin, da war ich 17, dass diese Unordnung, das Chaos New York City auch eine Menge Leben gibt, während kontrolliertere Städte oft tot wirkten."
Eine Stadt, die Menschen ein gutes Leben ermöglicht, sollte offen sein, findet Sennett. So sah das schon die Stadt- und Architekturkritikerin Jane Jacobs, die Sennetts Denken geprägt hat. Jacobs wollte den zwanglosen, informellen Austausch auf der Straße fördern. Ihr Ziel war es, Orte zu schaffen, an denen sich unterschiedliche Menschen begegnen können. Orte wie den Remisenhof in Berlin-Wedding. Er steht mustergültig für eine Struktur, wie sie Richard Sennett in seinem Buch "Die offene Stadt" beschreibt.
Eine Stadt, die Menschen ein gutes Leben ermöglicht, sollte offen sein, findet Sennett. So sah das schon die Stadt- und Architekturkritikerin Jane Jacobs, die Sennetts Denken geprägt hat. Jacobs wollte den zwanglosen, informellen Austausch auf der Straße fördern. Ihr Ziel war es, Orte zu schaffen, an denen sich unterschiedliche Menschen begegnen können. Orte wie den Remisenhof in Berlin-Wedding. Er steht mustergültig für eine Struktur, wie sie Richard Sennett in seinem Buch "Die offene Stadt" beschreibt.
Marie: "Es ist halb sieben Uhr morgens. Ich bin ein bisschen früher wach als sonst und höre Stimmen im Hof. Und ich geh zum Fenster, guck raus und sehe Menschen auf diesem Hof stehen, die ich noch nie gesehen habe vorher. Und sehe, die Leute tragen Werkzeuge rein, es fährt ein Radlader auf den Hof."
Das passiert Anfang Dezember 2018. Den Gewerbemietern war ja schon 2016 gekündigt worden.
Marie: "Dann denk ich: ich geh da jetzt mal runter und frag mal nach, was die hier planen zu tun. Und ich treffe unten auf einen Herren von diesem Abrissunternehmen und er erklärt mir, er wird jetzt diesen Hof abreißen hier, die Garagen, die Werkstätten, die kommen jetzt weg."

Morgens kommen Bauarbeiter, beginnen mit dem Abriss der Garagen in der Koloniestraße 10.© imago
Der Hof soll abgerissen werden. Ein neuer Investor möchte dort Mikroapartments bauen, so wie bereits auf dem Nebengrundstück.
Mikroapartments werden derzeit in vielen Großstädten gebaut, immer da, wo sich eine kleine Baulücke zeigt. Die kleinen Wohneinheiten werden oft als Studentenapartments vermietet. Für Richard Sennett stehen sie für das Gegenteil der offenen Stadt.
R. Sennett: "Die kommen ursprünglich aus Japan. Und wir wissen viel darüber, wie die Menschen das Leben dort empfinden. Sie haben einen eigenen Raum, das mögen sie. Aber nach drei oder vier Monaten erleben sie das als sehr klaustrophobisch. Die Studenten, die dort oft wohnen, fühlen sich isoliert. Diese Art der Lagerung von Menschen ist sozial ziemlich destruktiv."
Zurzeit wird an vielen Orten in Deutschland um die offene Stadt gerungen, so wie in der Koloniestraße 10 in Berlin.
Marie: "Die Herren vom Abrissunternehmen lassen sich auch nicht abbringen und zäunen unsere Remisen ein, die zäunen die Garagen ein, zäunen den ganzen Hof ein. Dann hab ich da nichts mehr zu sagen auf einmal."
Wo wohnt es sich besser?
Ein geschlossenes System ist auch laut Sennett nicht auf den ersten Blick unfreundlich. Effizienz ist ja nichts Schlechtes. Der berühmte Architekt Le Corbusier hat den Satz geprägt: "Das Haus ist eine Maschine zum Wohnen" und versuchte dementsprechend, die effizienteste Wohnform zu entwickeln.
Sara Böker ist Anfang 20 und hat eines von rund 200 Mikroappartements in einem großen Gebäudekomplex in Berlin-Mitte gemietet.
Sara Böker: "Ja, ist klein, aber fein."
Reporterin: "Und wie viele Quadratmeter sind das genau jetzt?"
Böker: "Um die 21, also inklusive Bad."
Reporterin: "Ja gut, die Dusche ist gar nicht so klein, dafür, dass das Badezimmer so klein ist."
Böker: "Nein, das stimmt. Das ist echt auch gut, wie soll ich sagen, gut aufgebaut oder gut integriert, dass das irgendwie so passt. Also, das Bad war mir noch nie zu klein, muss ich sagen."
Reporterin: "Und sonst?"
Böker: "Die Küche, die finde ich tatsächlich zu klein."
Die Mikroapartments sind eine Reaktion auf das Wachstum und die Verdichtung der Städte und beides schreitet weiter voran. In 30 Jahren werden voraussichtlich zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten wohnen. Wohnraum ist gefragt. Schnell, günstig und pragmatisch.
Reporterin: "Und wie viele Quadratmeter sind das genau jetzt?"
Böker: "Um die 21, also inklusive Bad."
Reporterin: "Ja gut, die Dusche ist gar nicht so klein, dafür, dass das Badezimmer so klein ist."
Böker: "Nein, das stimmt. Das ist echt auch gut, wie soll ich sagen, gut aufgebaut oder gut integriert, dass das irgendwie so passt. Also, das Bad war mir noch nie zu klein, muss ich sagen."
Reporterin: "Und sonst?"
Böker: "Die Küche, die finde ich tatsächlich zu klein."
Die Mikroapartments sind eine Reaktion auf das Wachstum und die Verdichtung der Städte und beides schreitet weiter voran. In 30 Jahren werden voraussichtlich zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten wohnen. Wohnraum ist gefragt. Schnell, günstig und pragmatisch.
An vielen Orten, an denen Mikroapartments errichtet werden, regt sich jedoch Protest, denn die winzigen Wohnungen werden ja nicht gebaut, um die Wohnungsnot zu lindern, sondern sollen vor allem Rendite abwerfen und: Je kleiner die Einheit, desto leichter lässt sie sich vermarkten.
In Berlin kostet ein Mikroappartement mit 20 Quadratmetern etwa 620 Euro Miete pro Monat, inklusive Reparaturen und der Nutzung von Gemeinschaftsräumen, etwa einer großen Küche.
Sara Böker: "Es ist auf jeden Fall teuer, hier zu wohnen, klar, vor allem für 20 Quadratmeter. Aber es ist nicht so, als würde ich nicht ständig gucken, wie es denn woanders ist. Und in der Lage, also so Fahrradlänge zur Uni, man findet einfach nichts, was jetzt großartig viel günstiger wäre."
In Berlin fehlen rund 310.000 bezahlbare Wohnungen – gerade auch kleine Wohnungen für Einpersonenhaushalte. Das ergab eine Studie der Humboldt-Universität Berlin und der Goethe-Universität Frankfurt im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Diesen Bedarf decken Mikroapartments also durchaus.
Geschlossene Systeme wirken zunächst erstmal übersichtlich, effizient, klar. In einer geschlossenen Stadt zu wohnen, könne auch angenehm sein, sagt Sennett. Die Dynamik und Flexibilität, die eine offene Zukunft von uns verlangt, werde damit aber enorm eingeschränkt. Für Sennett spielt sich die Frage nach Offenheit und Geschlossenheit auf unterschiedlichen Eben ab. Der Urbanist und seine Lehrmeisterin Jane Jacobs sehen Städte als Orte der Begegnung, des Aufeinanderstoßens unterschiedlicher Elemente, Menschen, Charaktere.

Überall in Berlin wachsen neue Apartmenthäuser in den Himmel: Hier an der Rummelsburger Bucht.© imago / Winfried Rothermel
Eine "Botoxreaktion" der Stadt
"Und das Städtische oder Urbanität ist ja nichts anderes als die Fähigkeit mit unterschiedlichen Kulturen, also mit Differenz umzugehen. Das ist der Kern des Städtischen, dass man das Fremde verarbeiten kann", sagt Felicitas Hillmann. Sie forscht zur "Regenerierung von Städten" am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner und ist Professorin an der TU Berlin. Hillmann knüpft an Sennetts Theorie an.
"Das heißt, er sagt, die Städter brauchen eigentlich migrantisches Wissen. Was wir zurzeit sehen, ist eben diese Ausblendungsleistung. Wir haben eine neoliberalisierte Stadt also eine Stadt mit Spekulation. Das führt zu Botoxreaktionen. Das heißt, die Städte sehen immer wieder ähnlich aus irgendwie, auch gut, aber unten drunter fehlt das städtische Leben. Es gibt diese Lähmung. Ich habe das mal als Botox bezeichnet: außen glatt, innen gelähmt."
Für sie ist es klar, dass Städte davon profitieren, wenn sie ihren Bewohnern eine Auseinandersetzung mit dem Fremden ermöglichen, zum Beispiel durch progressive Migrationspolitik.
Für sie ist es klar, dass Städte davon profitieren, wenn sie ihren Bewohnern eine Auseinandersetzung mit dem Fremden ermöglichen, zum Beispiel durch progressive Migrationspolitik.
"Für Deutschland ist es schon so, dass wir sehen, dass wir Städte haben, die mit diesem kosmopolitischen oder dieser starken migrationsbedingten Vielfalt einen Vorteil haben. Das sind Städte wie Frankfurt am Main. Die haben ganz früh auch ein Amt für multikulturelle Politiken gehabt. Die haben sich damit beschäftigt."

Außen glatt, innen gelähmt? - Hochhäuser und Straßenfluchten am Potsdamer Platz im Zentrum Berlins.© dpa / Wolfram Steinberg
Marie: "Als es dann kurz nach zehn ist, entscheiden sich die Herren vom Abrissunternehmen, die Abrissarbeiten fortzuführen. Dachpappen werden runtergerissen, Türen werden ausgehangen, Schlösser werden aufgebrochen."
Die Mieter geraten in Panik, da nicht klar ist, wie sich der Abriss der Garagen auf die Grundsubstanz der Wohnungen auswirkt.
Marie: "In quasi allerletzter Minuten, nachdem schon Schaden entstanden ist, aber bevor die Grundsubstanz betroffen ist, kommen die Herren und Damen vom Stadtplanungsamt, vom Bezirksamt, vom Milieuschutz und verhindern dann schlussendlich diesen Abriss."
Richard Sennett will offene Städte schaffen
R. Sennett: "In geschlossenen Systemen ist das Ganze genau die Summe seiner Teile. Man fügt Elemente hinzu, aber zwischen den Elementen gibt es keine Synergien. In einem offenen System ist das anders. Da ist das Ganze durch die Interaktion größer als die Summe seiner Teile."
Nicht Klarheit, sondern Komplexität sollte laut Sennett das Ziel von Stadtplanung sein. Das setze eine Struktur voraus, die es erlaube, Absonderliches, Seltsames und Mögliches zusammenzufügen. Ein geschlossenes System dagegen zeichnet sich laut Sennett unter anderem dadurch aus, additiv zu sein.
Nicht Klarheit, sondern Komplexität sollte laut Sennett das Ziel von Stadtplanung sein. Das setze eine Struktur voraus, die es erlaube, Absonderliches, Seltsames und Mögliches zusammenzufügen. Ein geschlossenes System dagegen zeichnet sich laut Sennett unter anderem dadurch aus, additiv zu sein.

Der US-amerikanische Soziologe und Kulturhistoriker Richard Sennett plädiert für Komplexität statt Klarheit als Ziel von Stadtplanung.© picture alliance / dpa
Ein Mikroapartment neben dem anderen. Unzählige Wiederholungen derselben kleinen Einheit, ohne eine Beziehung untereinander.
Sennett: "Eine enge Verknüpfung von Form und Funktion ist immer ein Rezept für technische Obsoleszenz. Denn wenn sich die Funktion ändert, bleibt die Form zwecklos zurück. Das Problem habe ich zum Beispiel in chinesischen Städten gesehen, in denen sehr kleine Wohnungen gebaut wurden, als China die Ein-Kind-Politik strikt verfolgt hat. Die Wohnungen waren genau an die Ein-Kind-Familie angepasst. Inzwischen gibt es viele Familien mit mehreren Kindern und die Wohnungen können nicht mehr genutzt werden."
Geschlossene Systeme haben eine klare Funktion
Wenn ein Gebäude aber eine zu klare Funktion erfüllt, sei der Verfall nicht aufzuhalten, meint Sennett. Zumal etwa der Klimawandel oder mögliche neue Fluchtbewegungen die Städte vor neue und wenig bekannte Herausforderungen stellen. Jan Trapp, Stadtplaner am Difu-Institut in Berlin, macht sich genau dazu Gedanken.
"Konkret arbeite ich gerade an der Frage, wie die Transformation von Wasser-Infrastrukturen in der Stadt aussehen kann vor dem Hintergrund des Klimawandels. Und da gehen wir sehr stark von einem Kopplungsbegriff aus. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die technische Wasser-Infrastruktur im Grunde genommen sich mit anderen Infrastrukturen in der Stadt, insbesondere mit Grün in der Stadt, Grünflächen, Grün-Dächer, aber auch mit dem blauen Infrastruktur, also den Gewässern, in der Stadt anders koppeln muss, einfach um mehr Sicherheit und Flexibilität auch im Umgang mit stärker abweichenden Klimaphänomen zu geben - also Starkregen in kurzer Zeit und auch längere Trockenperioden."
Für Trapp geht es in seiner Arbeit darum, die Stadt auf möglichst verschiedene Szenarien vorzubereiten. Er hält wenig davon, Millionenbeträge in Beton zu verbuddeln, um große unterirdische Rohrsysteme zu schaffen. Denn wie viel Starkregen letztendlich komme, sei noch ungewiss.
"Und wenn ich jetzt aber anfange, über eher kleinteilige Infrastrukturen nachzudenken und über diesen Kopplungsansatz, wenn ich also über Grün-Dächer, Grün-Fassaden, Grünflächen, Versickerungsmulden, mehr Bäume nachdenke, dann sind das Investitionen, die kleinteiliger sind, die ich auch dadurch, dass sie kleinteiliger sind, leichter anpassen kann an zukünftige Bedingungen."
Er erkennt Teile von Sennetts Theorie auch in seiner Arbeit wieder, zum Beispiel, wenn es darum geht, Regenauffangbecken zu bauen, die bei Trockenheit einen anderen Zweck erfüllen: nämlich als Sportplätze oder Parks.

Von Bürgern gegründet und gepflegte Grünfläche: der Gemeinschaftsgarten Himmelbeet in Berlin-Wedding.© dpa / Jens Kalaene
"Das sind genauso Offenheitsfragen. Das eine ist monofunktional unter der Erde, es ist einfach weg und gebaut und hat einen spezifischen Zweck, von dem ich nicht weiß, ob man den zukünftig und wie oft den es erfüllen muss. Oder ich baue eher ein Stück weit kleinteilig, in kleineren Strukturen und gewinne darüber auch mehr Flexibilität."
Eine offene Stadt - was heißt das für die Architektur?
"Ja, hier. Das ist für mich ein gutes Beispiel. Hier will man eigentlich nachts nicht tot gefunden werden, kein Grün." – Der Architekt und Stadtplaner Markus Appenzeller empfindet die Berliner Innenstadt als gutes Beispiel, als gutes Beispiel für eine geschlossene Stadt.
Dabei brauche es manchmal gar nicht viel um das zu ändern: Sitzgelegenheiten, aufgebrochene Fassaden, Läden oder Gewerbe, die zum Hereinkommen einladen.
"Der Begriff offene Stadt kommt ja ursprünglich aus der Militärgeschichte. Als offene Stadt hat man eine Stadt bezeichnet, die vom Gegner verlassen war, die man damals im Prinzip ohne Einsatz von Gewalt Waffengewalt einnehmen konnte."
Dabei brauche es manchmal gar nicht viel um das zu ändern: Sitzgelegenheiten, aufgebrochene Fassaden, Läden oder Gewerbe, die zum Hereinkommen einladen.
"Der Begriff offene Stadt kommt ja ursprünglich aus der Militärgeschichte. Als offene Stadt hat man eine Stadt bezeichnet, die vom Gegner verlassen war, die man damals im Prinzip ohne Einsatz von Gewalt Waffengewalt einnehmen konnte."
Offenheit heißt Anfälligkeit für Schwierigkeiten
"Mittlerweile hat sich das aber, also dieser Begriff hat eine andere Bedeutung gekriegt. Jetzt geht es letztendlich um eine Stadt, die verschiedensten sozialen Gruppen Räume bietet, die auch die Möglichkeit bietet, sie sich anzueignen, wo auch letztendlich eine Offenheit, eine Durchlässigkeit sozial, räumlich, ökonomisch da ist."
Die Theorie der offenen Stadt hat auf der Ebene der Stadtplaner viel in Bewegung gesetzt, erzählt Appenzeller, obwohl er Richard Sennett nicht in allem folgt.
Die Theorie der offenen Stadt hat auf der Ebene der Stadtplaner viel in Bewegung gesetzt, erzählt Appenzeller, obwohl er Richard Sennett nicht in allem folgt.
"Ich bin da manchmal ein bisschen kritisch. Er hat es bei der Habitat Konferenz in Quito vor zwei Jahren in der Form von Quito Papers zum universellen Entwicklungsideal erhoben. Ich saß zufällig bei der Präsentation neben einem Bekannten von mir, der aus Ghana stammt. Der meinte: Mit der offenen Stadt ist ja alles schön und die Durchlässigkeit und so. Aber das funktioniert auch gut, wenn man im Zentrum von London lebt und man die Polizei anruft und zehn Sekunden später steht ein Polizeiauto vor der Tür. Wo ich lebe, gibt es im Prinzip keine öffentlichen Dienstleistungen, das heißt, ich muss für alles selber sorgen.
Die offene Stadt, das komplexe System stellt in solchen Kontexten sogar eine Gefahr da. Was jetzt eigentlich dazu führt, dass das an bestimmten Orten Leute sich für Gated Communities entscheiden. Und das ist eben genau das Gegenteil von Offener-Stadt-Umarmen, weil es einfach die einzige Möglichkeit ist für sie, ihre Lebensumstände zu verbessern."
Ein paar Monate nach dem Beinahe-Abriss der Garagen haben sich die Mieter zu einem Plenum versammelt. Die Bewohner der Koloniestraße eignen sich ihren Raum an, wollen teilhaben. Stadtentwicklung von unten, Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligen und ihren Lebensraum selbst gestalten wollen. Unterschieden und Differenz Raum geben statt Profit und Kapitalinteressen. Prozesse im Sinne der offenen Stadt? Nicht unbedingt! Bürgerbeteiligung hat auch ihre Schattenseiten.
Die offene Stadt, das komplexe System stellt in solchen Kontexten sogar eine Gefahr da. Was jetzt eigentlich dazu führt, dass das an bestimmten Orten Leute sich für Gated Communities entscheiden. Und das ist eben genau das Gegenteil von Offener-Stadt-Umarmen, weil es einfach die einzige Möglichkeit ist für sie, ihre Lebensumstände zu verbessern."
Ein paar Monate nach dem Beinahe-Abriss der Garagen haben sich die Mieter zu einem Plenum versammelt. Die Bewohner der Koloniestraße eignen sich ihren Raum an, wollen teilhaben. Stadtentwicklung von unten, Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligen und ihren Lebensraum selbst gestalten wollen. Unterschieden und Differenz Raum geben statt Profit und Kapitalinteressen. Prozesse im Sinne der offenen Stadt? Nicht unbedingt! Bürgerbeteiligung hat auch ihre Schattenseiten.

Gated Community in Deutschland: ein neu errichtetes, durch hohe Mauern geschütztes Wohnviertel in Düsseldorf.© imago / C. Hardt / Future Image
Warschau: Paradebeispiel der postmodernen Stadt
Warschau! Eine Stadt mit sichtbaren historischen Brüchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der weitgehenden Zerstörung wurde Warschau nach sozialistischem Leitbild gestaltet: breite Straßen, Großwohnsiedlungen, der Kulturpalast in der Innenstadt ein Monument des sozialistischen Klassizismus. Nach dem Ende des Sozialismus ein radikaler Schwenk zur Postmoderne: Einkaufszentren, Bürotürme, Entertainment Areale – alles ganz ohne Vorgaben oder Konzept.
"Warschau war auch sehr stark politisch fragmentiert, erst zu Beginn der Nullerjahre hat man dort eine Gebiets- und Verwaltungsreform durchgeführt. Das heißt, ich habe in Warschau eine forcierte Post-Modernisierung und erkenne sehr stark, wie diese unterschiedlichen, oder dieses Weggehen von Form-Follows-Function, das wir sehr schön ausgeprägt hatten in der sozialistischen Stadt, die sozialistische Moderne hat ja auch sehr stark Funktionen getrennt, also Wohnen, man muss sich nur mal diese großen Wohnblöcke an den Stadträndern vor Augen halten." – Olaf Kühne ist Professor für Geografie an der Universität Tübingen. In Warschau zeige sich besonders deutlich, wie sich sowohl Stadtplanung von oben als auch Beteiligung von unten als Fluch und als Segen erweisen können – wie sowohl die Idee der Planstadt, als auch das freie Walten der Einzelinteressen, geschlossene Systeme hervorbringt. Im Falle Warschaus regelrechte "Gated Communities".
"Warschau war auch sehr stark politisch fragmentiert, erst zu Beginn der Nullerjahre hat man dort eine Gebiets- und Verwaltungsreform durchgeführt. Das heißt, ich habe in Warschau eine forcierte Post-Modernisierung und erkenne sehr stark, wie diese unterschiedlichen, oder dieses Weggehen von Form-Follows-Function, das wir sehr schön ausgeprägt hatten in der sozialistischen Stadt, die sozialistische Moderne hat ja auch sehr stark Funktionen getrennt, also Wohnen, man muss sich nur mal diese großen Wohnblöcke an den Stadträndern vor Augen halten." – Olaf Kühne ist Professor für Geografie an der Universität Tübingen. In Warschau zeige sich besonders deutlich, wie sich sowohl Stadtplanung von oben als auch Beteiligung von unten als Fluch und als Segen erweisen können – wie sowohl die Idee der Planstadt, als auch das freie Walten der Einzelinteressen, geschlossene Systeme hervorbringt. Im Falle Warschaus regelrechte "Gated Communities".

Blick über Warschau: Nach der Wende entstanden in der Stadt immer mehr "Gated Communities".© pictrue alliance / dpa / image Broker
"Und was habe ich heute? Kolleginnen haben das vor einigen Jahren mal ermittelt, dass es um die Wende, zwischen den Nuller- und den Zehner-Jahren, dort um die 400 Gated Communities, geschlossene Gemeinschaften, gibt, also zutrittsbeschränkte Wohnquartiere. Das natürlich ein Element der Entkomplexisierung ist, von Weltbeziehung. Ich ziehe mich in einen Raum zurück, der mir Sicherheit suggeriert, der für mich überschaubar ist."
Diese Gated Communities sind in Beteiligungsverfahren entstanden. Sennett will den Bürgern deshalb nicht einfach das Zepter in die Hand geben. Er hält gezielte Planung von oben für sinnvoll, wenn sie klug vorgeht und Bürger nach ihren Interessen fragt, sie ihnen aber nicht komplett überlässt.
R. Sennett: "Ich denke, das ist eine etwas kompliziertere Angelegenheit, als einfach das zu bauen, was die Menschen haben wollen. Die populärste neue Wohnform ist die Gated Community, also eine sehr exklusive Wohnform. Und ich glaube nicht, dass wir einfach diesem Bedürfnis folgen sollten. Ich glaube, wir sollten komplexe Umgebungen bauen und Leute dazu bringen, aus ihren Gated Communities herauszukommen."
R. Sennett: "Ich denke, das ist eine etwas kompliziertere Angelegenheit, als einfach das zu bauen, was die Menschen haben wollen. Die populärste neue Wohnform ist die Gated Community, also eine sehr exklusive Wohnform. Und ich glaube nicht, dass wir einfach diesem Bedürfnis folgen sollten. Ich glaube, wir sollten komplexe Umgebungen bauen und Leute dazu bringen, aus ihren Gated Communities herauszukommen."
"Mordor" nennen die Warschauer einen neuen Business-Bezirk
Leszek Wisniewski ist Stadtplaner und Architekt in Warschau und beobachtet, wie sich seine Stadt in den letzten 30 Jahren verändert hat.
"Die Orte in Warschau, an denen wir gerade viele Probleme haben, sind monofunktional, zum Beispiel ein großer Business-Bezirk im Süden der Stadt, der Mordor genannt wird. Ja, Mordor. Und zwar, weil dort 80.000 bis 100.000 Menschen arbeiten, es aber sehr schlechten öffentlichen Nahverkehr gibt. Das heißt, die meisten Arbeiter fahren mit dem Auto hin und es gibt jeden Morgen und Abend extreme Staus."
Olaf Kühne: "Ich habe im Prinzip eine völlige Umkehr in Warschau der sozialistischen Tradition, ich geh weg von einer Planung, die letztlich sehr detailliert Stadt entwickeln wollte, hin zu einer, man könnte auch sagen Nicht-Planung, wie wir sie in Los Angeles oder vielen Teilen der USA finden."
Die sozialistische Epoche und die postmoderne Phase seit 1989 sind aber nicht alles, was sich an der städtischen Struktur von Warschau ablesen lässt. Die Stadtplaner, die zu Zeiten der zweiten polnischen Republik am Werk waren, haben einige Viertel in Warschau hinterlassen, die auch Hundert Jahre später noch eine angenehme Ausstrahlung haben und ihren Zweck erfüllen, zum Beispiel Ochota. Ein sehr beliebtes, ruhiges Viertel, gar nicht so weit von den ausladenden Autotrassen der Innenstadt entfernt.
Leszek Wisniewski: "Ich habe über die Jahre beobachtet, dass kleine Bezirke mit einem definierten Zentrum und einer definierten Nachbarschaft, mit klaren Grenzen, dass dort Gemeinschaften entstehen. Das ist natürlich gut. Aber das ist ein Beispiel für Top-Down-Planung. Die wurden alle Anfang des 20. Jahrhunderts ohne Beteiligung geplant."
Leszek Wisniewski sitzt auf einer Bank auf einem seiner Lieblingsplätze im Viertel Ochota. Ein wirklich unauffälliger Park mit einem Springbrunnen und ein paar Tischtennisplatten.
"Diese Plätze, die mitten in der Nachbarschaft versteckt sind, das ist, glaube ich, wichtig. Der Platz ist umrahmt von Häusern. Die Menschen überqueren den Platz unbewusst. Manchmal kommen sie natürlich auch bewusst her, aber ich glaube, dass diese unbewussten Aktivitäten ziemlich wichtig für eine Stadt sind. Deshalb funktionieren diese Bezirke, die vor dem Krieg geplant wurden, oft so gut."
"Diese Plätze, die mitten in der Nachbarschaft versteckt sind, das ist, glaube ich, wichtig. Der Platz ist umrahmt von Häusern. Die Menschen überqueren den Platz unbewusst. Manchmal kommen sie natürlich auch bewusst her, aber ich glaube, dass diese unbewussten Aktivitäten ziemlich wichtig für eine Stadt sind. Deshalb funktionieren diese Bezirke, die vor dem Krieg geplant wurden, oft so gut."
Die Stadt gibt es zwei Mal – als Ville und als Cité
Stadtplanung braucht also mehr als die Beteiligung der Bürger. Sie braucht auch gezielte Planung von oben, die genau die Effekte im Blick behält, die die physische Struktur der Stadt auf die Menschen hat. Dafür unterscheidet Richard Sennett zwischen zwei Formen von Stadt: Der Ville, der physischen Stadt. Und der Cité, der Lebensweise, der Haltung der Bewohner.
Ein Beispiel dafür, wie die Ville die Cité verändern kann, ist die Einführung des Pissoirs in Paris 1834. Vorher war es normal, dass Männer an jede Straßenecke urinierten, wie wir es heute eher von Hunden kennen. Nach Einführung des Pissoirs wurde der Urin unterirdisch weggeschafft. Dadurch veränderte sich auch die Cité, die Geisteshaltung. Es galt jetzt als beschämend, vor den Augen anderer auf die Straße zu pinkeln. Das wiederum hatte einen Effekt auf die Ville, den physischen Raum: Weil es nicht mehr überall nach Urin und Kot stank, entwickelte sich das Straßenleben als sozialer Raum, es entstanden Cafés.
Kühne: "Das macht es natürlich auch schwieriger, Stadt heute nicht nur als physischen Raum oder Ville, wie Sennett das ja in Anschluss an den französischen Begriff nennt, zu sehen: Sondern ich habe auch eine pluralisierende, vervielfältigende, sich individualisierende Cité. Wenn ich eine komplexer werdende Gesellschaft habe, weil ich von den Finalitätsmythen der Moderne, das ist die ideale Endgesellschaft, abweiche, sondern gesellschaftliche Entwicklung wie wissenschaftliche Entwicklung ist eben ein Suchprozess. Das muss sich auch in irgendeiner Form in der Ville im physischen Raum niederschlagen."

Gelungene Stadtplanung braucht Bürgerbeteiligung: Proteste gegen den Abriss in der Koloniestraße 10 in Berlin-Wedding.© picture alliance / dpa / Eibner-Pressefoto / Koch
Wenn die Gesellschaft, die Cité, also komplexer wird, muss sich das auch in der Ville, in der physischen Struktur niederschlagen.
R. Sennett: "In 40 Jahren als Stadtplaner bin ich immer wieder daran gescheitert, Politiker dazu zu bringen, dass sie sagen: Ja, wir wollen eine komplexe Umwelt schaffen. Ich glaube, das muss aus der Zivilgesellschaft kommen, auch wenn sich das verrückt anhört."
Es seien oft die Verlierer der geschlossenen Systeme, die sich engagierten, Städte zu öffnen. Das ist auch der Ansatzpunkt für Felicitas Hillmann.
Hillmann: "Das Bewusstsein dafür, dass man sich viel stärker mit Migration als einem Treiber von Stadtentwicklung beschäftigen muss, ist meiner Ansicht nach noch zu wenig diskutiert."
Hillmann: "Das Bewusstsein dafür, dass man sich viel stärker mit Migration als einem Treiber von Stadtentwicklung beschäftigen muss, ist meiner Ansicht nach noch zu wenig diskutiert."
Wenn die Cité auch mitbedacht wird, ist das für Hillmann immerhin schon ein Anfang. Kulturveranstaltungen wie der Karneval der Kulturen in Berlin, die von einer diversen Stadtbevölkerung ausgehen, sind für sie Positivbeispiele. Aber solche Entwicklungen brauchten Zeit.
R. Sennett: "Meiner Erfahrung nach waren es oft diejenigen, die Veränderungen in den USA herbeigeführt haben, die die Effekte der geschlossenen Stadt am eigenen Leib gespürt haben: Arme oder Schwarze. Sie sind politisch aktiv geworden und haben den Wandel erzwungen."
R. Sennett: "Meiner Erfahrung nach waren es oft diejenigen, die Veränderungen in den USA herbeigeführt haben, die die Effekte der geschlossenen Stadt am eigenen Leib gespürt haben: Arme oder Schwarze. Sie sind politisch aktiv geworden und haben den Wandel erzwungen."
Städte sind krumm und dürfen krumm sein
Spätsommer. In Berlin-Wedding bereiten die Bewohner des Remisenhofes eine Kiezversammlung vor. Was der neue Investor mit ihrem Hof vorhat, ob er verkaufen möchte oder versucht, Mikro-Apartments zu bauen, das wissen die Bewohner der Koloniestraße 10 noch nicht.
Marie Münch: "Wir warten im Endeffekt täglich auf Neuigkeiten. Wir hoffen immer, dass es keine Hiobsbotschaften sind. Wir sind im guten Kontakt mit Netzwerken und Initiativen. Ansonsten müssen wir abwarten, was als nächstes passiert. Wir haben noch keine gekündigten Wohnungsmietverträge und der aktuelle Stand ist im Endeffekt ein zähes und bisschen zermürbendes Abwarten."
Der Philosoph Immanuel Kant schrieb 1784 in einem Aufsatz über kosmopolitisches Leben: "Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts Gerades gezimmert sein." Sennett folgert daraus: Städte sind krumm und dürfen krumm sein, weil sie von Unterschieden geprägt sind. Das ist es, was die Stadt eigentlich als Stadt ausmacht.