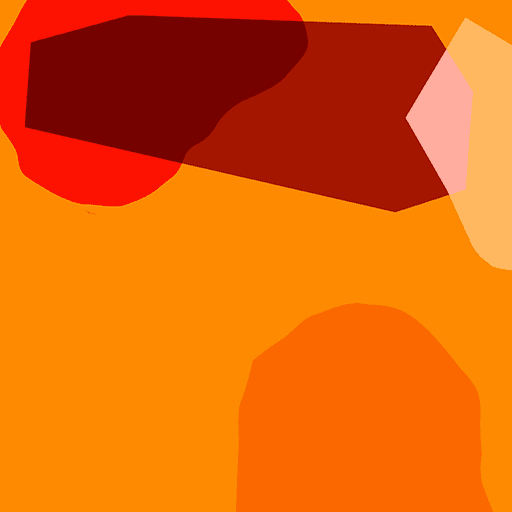"Die offene Wunde"
Zum Raum wird hier die Zeit, Erlösung dem Erlöser: Wenige Opern umgibt eine solche Aura wie Richard Wagners "Parsifal". Eine Aura, in der sich der Mythos des Erlösers in weihevoller Unschärfe zu verbreiten pflegt. Wer hier wen erlöst und wodurch, bleibt meist unklar. Ein wenig Licht im Gralstempel kann nicht schaden.
Richard Wagner war ein Meister der Selbstinszenierung, aber mit den Legenden um die Entstehung des "Parsifal", seiner letzten Oper – pardon: seinem "Bühnenweihfestspiel" – übertraf er sich selbst: Ein sonniger Karfreitagsnachmittag in Zürich, die Kuppel des Doms zu Siena, ein Zaubergarten in Neapel und andere Ur-Erlebnisse sollen ihm die Geschichte des "reinen Toren" eingegeben haben – eine Geschichte, deren Bayreuther Uraufführungs-Inszenierung von 1882 durch Wagners Witwe Cosima jahrzehntelang drachengleich gehütet wurde.
Amfortas, Sohn des Gralskönigs Titurel, leidet an einer Wunde, die nur der heilige Speer schließen kann. Einer "offenen Wunde" kommt auch das Verhältnis der Nachwelt – der deutschen zumal – zu dieser Oper gleich. Einem Werk, in dem Wagners Inspiration in eine antisemitisch grundierte, diffuse Kunstreligion mündet. Ein Werk, das aber auch in solcher Hinsicht völlig unverdächtige Geister wie Pierre Boulez und Christoph Schlingensief zu einer öffentlichkeitswirksamen Zusammenarbeit animiert hat: Boulez hat den "Parsifal" am Anfang und in der Spätzeit seiner Dirigentenlaufbahn in Bayreuth mit Hingabe dirigiert und dem weihevollen Wagner-Sound eines Hans Knappertsbusch einen schlanken, modernen, geradezu flotten Klang gegenübergestellt.
Wie sieht Christian Jost dieses Werk? Der Komponist und Dirigent, 1963 in Trier geboren, hat sich mit mehreren Opern (zuletzt "Hamlet") als ein Erbe Richard Wagners legitimiert; er ist einer der am meisten gespielten Komponisten seiner Generation. Im Gespräch mit Uwe Friedrich diskutiert Jost die wesentlichen Aspekte des "Parsifal", den er selbst zu seinen Lieblingsopern zählt.
Amfortas, Sohn des Gralskönigs Titurel, leidet an einer Wunde, die nur der heilige Speer schließen kann. Einer "offenen Wunde" kommt auch das Verhältnis der Nachwelt – der deutschen zumal – zu dieser Oper gleich. Einem Werk, in dem Wagners Inspiration in eine antisemitisch grundierte, diffuse Kunstreligion mündet. Ein Werk, das aber auch in solcher Hinsicht völlig unverdächtige Geister wie Pierre Boulez und Christoph Schlingensief zu einer öffentlichkeitswirksamen Zusammenarbeit animiert hat: Boulez hat den "Parsifal" am Anfang und in der Spätzeit seiner Dirigentenlaufbahn in Bayreuth mit Hingabe dirigiert und dem weihevollen Wagner-Sound eines Hans Knappertsbusch einen schlanken, modernen, geradezu flotten Klang gegenübergestellt.
Wie sieht Christian Jost dieses Werk? Der Komponist und Dirigent, 1963 in Trier geboren, hat sich mit mehreren Opern (zuletzt "Hamlet") als ein Erbe Richard Wagners legitimiert; er ist einer der am meisten gespielten Komponisten seiner Generation. Im Gespräch mit Uwe Friedrich diskutiert Jost die wesentlichen Aspekte des "Parsifal", den er selbst zu seinen Lieblingsopern zählt.