Die Sache mit der Demoskopie
Immer, wenn Fehlleistungen der Demoskopie offenbar werden, pflegen sich die Fürsten der Demoskopie damit herauszureden, dass ihre Prognosen nicht mehr seien als die Wiedergabe punktueller Stimmungslagen, es gehe eher um Trends und Tendenzen, und Fehlermargen existierten allemal. Auf den Einwand, dass kaum als Trend gelten dürfe, was sich am Ende als dessen völliges Gegenteil erweise, lautet die Antwort, Trends könnten sich plötzlich umkehren.
Es gibt in Deutschland vier große Meinungsforschungsinstitute: Forsa, Emnid, Forschungsgruppe Wahlen, Allensbach. Ihre zum gleichen Zeitpunkt veranstalteten Erhebungen differieren fast immer und dies zuweilen erheblich. Die Verantwortlichen sind von der Seriosität ihrer Arbeit gleichwohl überzeugt.
Wir dürfen fragen wieso.
Die Demoskopie sieht sich als angewandte Sozialwissenschaft. Nach dem Zufallsprinzip wird eine bestimmte Anzahl von Männern und Frauen ausgewählt, die übliche Größe liegt um die 2000. Die Ausgewählten werden nach ihren Meinungen, Stimmungen und Erwartungen befragt. Ihre Antworten gelten als repräsentativ für die der Gesamtbevölkerung.
Erfinder des Verfahrens sind zwei US-Amerikaner, Thurstone und Gallup. Ihre Methode, in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts erstmals praktiziert, wurde bald in Europa und der übrigen Welt übernommen. Seither spielen Meinungsforscher eine wesentliche Rolle in der Politik ebenso wie in der Ökonomie.
Die Demoskopie nennt ihr Verfahren empirisch. Empirie bedeutet: das Festhalten von Tatsachen und deren Interpretation. Das natürliche Feld der Empirie sind die exakten Naturwissenschaften, wo die Fakten eindeutig sind und generalisierende Schlüsse zulassen, in Gestalt von Regeln und Gesetzen. Das gilt für die Mechanik wie für die Elektrophysik, für die Chemie, für die Virologie.
Dass Veränderungen in menschlichen Gesellschaften nach Gesetzen ablaufen, die ähnlich zwingend seien wie jene in den Naturwissenschaften, ist eine im 19. Jahrhundert gewachsene Überzeugung. Karl Marx und Friedrich Engels hingen ihr ebenso an wie die Soziologen aus der Schule von Emile Durkheim und Max Weber. Es gibt Anlass, an der Sache zu zweifeln.
Bleiben wir bei der Demoskopie. Die biologischen Daten eines Menschen sind objektiv feststellbar: Größe, Alter, Haarfarbe, Gewicht. Was in seinem Kopf als Gedanke existiert, ist dies nicht. Erfragte Antworten können täuschen oder lügen, aus welchem Motiv immer, und selbst wenn sie die Wahrheit sind, was garantiert eigentlich, dass 2000 Auskünfte tatsächlich repräsentativ sind für zehn oder fünfzig Millionen? Empirie ist das alles nicht.
Kommt hinzu, dass die Resultate, einmal publiziert, ihrerseits Wirkung entfalten. Denn selbst wenn sie, was wahrscheinlich ist, höchst ungenau und damit falsch ausfallen, können sie infolge ihrer medialen Multiplikation das Publikum massiv beeinflussen und damit jene Tendenz herstellen, die zuvor bloß behauptet wurde. Wir haben es mit einer höchst zweifelhaften Form der sich selbst erfüllenden Redundanz zu tun.
Die Demoskopie ist so zuverlässig wie die Wetterprognose: Mal stimmt sie, mal stimmt sie nicht. Dabei haben es die Meteorologen wenigstens noch mit sicheren Ausgangsmaterialien zu tun: Luftdruck, Tagestemperaturen und Regenmengen sind objektiv mess- und feststellbar, Gedanken sind es nicht.
Gleichwohl gibt es die Demoskopie, und sie gedeiht prächtig. Wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich stellt sie für die Politik die sogenannte Sonntagsfrage. Die Ergebnisse nehmen Parteipolitiker mit angehaltenem Atem zur Hand. Die von der Umfrage Begünstigten triumphieren, während die Verlierer in Panik verfallen. Die Demoskopie beeinflusst Regierungsentscheidungen, Personalauswahl, Parteiprogramme. Sie beliefert Presse und elektronische Medien mit Schlagzeilen und Tortendiagrammen. Da es so ist, sieht sie keinen Grund, an sich selbst und ihrem Tun irgend zu zweifeln.
Es gibt die Demoskopie, weil es die Demoskopie gibt. Dies ist die Grundlage ihrer Existenz. Wenn wir sie ernst nehmen, haben wir es nicht besser verdient.
Rolf Schneider stammt aus Chemnitz. Er war Redakteur der kulturpolitischen Monatszeitschrift "Aufbau" in Berlin (Ost) und wurde dann freier Schriftsteller. Wegen ‘groben Verstoßes gegen das Statut’ wurde er im Juni 1979 aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen, nachdem er unter anderem zuvor mit elf Schriftstellerkollegen in einer Resolution gegen die Zwangsausbürgerung Wolf Biermanns protestiert hatte. Veröffentlichungen u. a. "November", "Volk ohne Trauer" und "Die Sprache des Geldes". Rolf Schneider schreibt gegenwärtig für eine Reihe angesehener Zeitungen und äußert sich insbesondere zu kultur- und gesellschaftspolitischen Themen.
Wir dürfen fragen wieso.
Die Demoskopie sieht sich als angewandte Sozialwissenschaft. Nach dem Zufallsprinzip wird eine bestimmte Anzahl von Männern und Frauen ausgewählt, die übliche Größe liegt um die 2000. Die Ausgewählten werden nach ihren Meinungen, Stimmungen und Erwartungen befragt. Ihre Antworten gelten als repräsentativ für die der Gesamtbevölkerung.
Erfinder des Verfahrens sind zwei US-Amerikaner, Thurstone und Gallup. Ihre Methode, in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts erstmals praktiziert, wurde bald in Europa und der übrigen Welt übernommen. Seither spielen Meinungsforscher eine wesentliche Rolle in der Politik ebenso wie in der Ökonomie.
Die Demoskopie nennt ihr Verfahren empirisch. Empirie bedeutet: das Festhalten von Tatsachen und deren Interpretation. Das natürliche Feld der Empirie sind die exakten Naturwissenschaften, wo die Fakten eindeutig sind und generalisierende Schlüsse zulassen, in Gestalt von Regeln und Gesetzen. Das gilt für die Mechanik wie für die Elektrophysik, für die Chemie, für die Virologie.
Dass Veränderungen in menschlichen Gesellschaften nach Gesetzen ablaufen, die ähnlich zwingend seien wie jene in den Naturwissenschaften, ist eine im 19. Jahrhundert gewachsene Überzeugung. Karl Marx und Friedrich Engels hingen ihr ebenso an wie die Soziologen aus der Schule von Emile Durkheim und Max Weber. Es gibt Anlass, an der Sache zu zweifeln.
Bleiben wir bei der Demoskopie. Die biologischen Daten eines Menschen sind objektiv feststellbar: Größe, Alter, Haarfarbe, Gewicht. Was in seinem Kopf als Gedanke existiert, ist dies nicht. Erfragte Antworten können täuschen oder lügen, aus welchem Motiv immer, und selbst wenn sie die Wahrheit sind, was garantiert eigentlich, dass 2000 Auskünfte tatsächlich repräsentativ sind für zehn oder fünfzig Millionen? Empirie ist das alles nicht.
Kommt hinzu, dass die Resultate, einmal publiziert, ihrerseits Wirkung entfalten. Denn selbst wenn sie, was wahrscheinlich ist, höchst ungenau und damit falsch ausfallen, können sie infolge ihrer medialen Multiplikation das Publikum massiv beeinflussen und damit jene Tendenz herstellen, die zuvor bloß behauptet wurde. Wir haben es mit einer höchst zweifelhaften Form der sich selbst erfüllenden Redundanz zu tun.
Die Demoskopie ist so zuverlässig wie die Wetterprognose: Mal stimmt sie, mal stimmt sie nicht. Dabei haben es die Meteorologen wenigstens noch mit sicheren Ausgangsmaterialien zu tun: Luftdruck, Tagestemperaturen und Regenmengen sind objektiv mess- und feststellbar, Gedanken sind es nicht.
Gleichwohl gibt es die Demoskopie, und sie gedeiht prächtig. Wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich stellt sie für die Politik die sogenannte Sonntagsfrage. Die Ergebnisse nehmen Parteipolitiker mit angehaltenem Atem zur Hand. Die von der Umfrage Begünstigten triumphieren, während die Verlierer in Panik verfallen. Die Demoskopie beeinflusst Regierungsentscheidungen, Personalauswahl, Parteiprogramme. Sie beliefert Presse und elektronische Medien mit Schlagzeilen und Tortendiagrammen. Da es so ist, sieht sie keinen Grund, an sich selbst und ihrem Tun irgend zu zweifeln.
Es gibt die Demoskopie, weil es die Demoskopie gibt. Dies ist die Grundlage ihrer Existenz. Wenn wir sie ernst nehmen, haben wir es nicht besser verdient.
Rolf Schneider stammt aus Chemnitz. Er war Redakteur der kulturpolitischen Monatszeitschrift "Aufbau" in Berlin (Ost) und wurde dann freier Schriftsteller. Wegen ‘groben Verstoßes gegen das Statut’ wurde er im Juni 1979 aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen, nachdem er unter anderem zuvor mit elf Schriftstellerkollegen in einer Resolution gegen die Zwangsausbürgerung Wolf Biermanns protestiert hatte. Veröffentlichungen u. a. "November", "Volk ohne Trauer" und "Die Sprache des Geldes". Rolf Schneider schreibt gegenwärtig für eine Reihe angesehener Zeitungen und äußert sich insbesondere zu kultur- und gesellschaftspolitischen Themen.
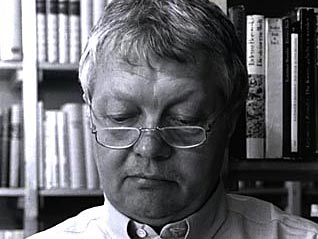
Rolf Schneider© Therese Schneider