Die Suche nach der Mitte
Die Mitte ist schwieriger zu definieren als die Extreme. Herfried Münkler stellt sich der Herausforderung in seinem neuen Werk. Dazu wählt er vier verschiedene Zugriffe, um Geschichte, Bedeutung und Metaphorik der Mitte darzustellen.
Die Mitte ist schwieriger zu definieren als die Extreme. Die Mitte als politische Metapher, als soziologische Beschreibung, als geografisches Schicksal, als strategische Ausgangsposition und als lebenskluge Position zwischen den Extremen kann eine dynamische und bewunderte Größe oder die Tristesse des Mittelmaßes sein. Man sagt ihr Qualitäten nach, die auch bei Herfried Münkler immer wieder aufscheinen:
"Die Mitte ist ein Stabilitätsanker der Gesellschaft – oder kann dies zumindest sein, wenn sie bestimmten Anforderungen genügt. Sie ist aber ebenso ein hochbewegliches Ruder, das der Gesellschaft Anpassungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft verschafft."
Unter Berufung auf Hans Magnus Enzensbergers Essay "Mittelmaß und Wahn" impliziert auch Münkler, eine Gesellschaft, in der Machthaber, Meinungen, Freuden, Ängste und Kunstwerke "mittelmäßig" sind, habe etwas "Erlösendes".
Die Mitte kann der ruhende Pol, das Kraftzentrum eines Gemeinwesens sein, der Schutz gegen brutalisierende Extreme, Ausgewogenheit im Urteil, oder aber Philistertum, Dekadenz und Untergang im Mittelmaß.
Mit Hegel gibt Münkler einleitend zu bedenken, dass die Perioden politischen Glücks die leeren Seiten der Weltgeschichte seien. Um nicht in Langeweile und Mittelmaß zu versinken, vor allem aber, um sich selbst zu definieren, ist die Mitte mit den Extremen dialektisch verbunden.
"Die Mitte ist (...) in weitaus höherem Maße auf die sie umgebenden Extreme angewiesen, als sie wahrhaben will. Sie zapft den notorischen Erregungszustand der Peripherie an, um die Ruhe zu bewahren. Das aber heißt, dass die Mitte beschränkt bleiben muss. Wo alles Mitte ist, ist es mit der Mitte schnell vorbei. In diesem Sinne ist sie nicht nur der Hüter des Maßes, sondern muss auch selbst maßhalten."
In den vier Kapiteln des Buches wählt Münkler vier verschiedene Zugriffe, um Geschichte, Bedeutung und Metaphorik der Mitte darzustellen. Der erste Abschnitt über "Mitte und Maß" leistet eine historische Einordnung und liefert eine pointierte Darstellung der in den letzten Jahren stark angeschwollenen Diskurse über eine Bedrohung der Mitte.
Das Zweite darstellerisch und analytisch wohl stärkste Kapitel, mit dem Titel "Mitte und Macht" ist eine philosophiegeschichtliche tour de force, die Münkler mit der Antike, vor allem mit Aristoteles als dem Philosophen der Mitte, beginnen und mit Karl Marx und seiner Stellung zwischen Französischer und Industrieller Revolution enden lässt.
Bis zur Französischen Revolution ging es vor allem um den Gegensatz zwischen wenigen Reichen und vielen Armen, jetzt taucht mit den Extremen links und rechts eine neue Sprache auf, die das 19. und 20. Jahrhundert prägen wird. Den Chor der Negativstimmen führt in diesem Kapitel Friedrich Nietzsche an, der die Mitte nicht mehr als Sprungbrett, sondern als tristes Grab der Außerordentlichen sah:
"Nietzsche begreift die Vermittelmäßigung als eine überlebensnotwendige Reaktion des Menschen auf die Herausforderungen der Moderne; die moderne Welt erzwingt die Vermittelmäßigung der Menschen und die Mittelmäßigen werden zum stabilisierenden Element der modernen Welt."
Im dritten Kapitel über "Mitte und Raum" werden geopolitische und geostrategische Vorstellungen analysiert, Deutschlands viel debattierte "Mittellage" mit ihren politischen und militärischen Konsequenzen, etwa im Falle eines Zweifrontenkrieges. Die politische Angstfigur der "Einkreisung" mit der militärischen Antwort der schnellen Umfassung des Gegners analysiert Münkler anhand des berühmten und im Sommer 1914 fatal scheiternden Schlieffen-Plans.
Der vierte und letzte Abschnitt über die "Republik der Mitte" ruft zunächst die Diskussionen um das Scheitern der Weimarer Republik als Resultat einer belagerten und schließlich zerbrochenen Mitte in Erinnerung. Der hier fatal zerriebenen Mitte wird die nivellierte Mittelstandsgesellschaft der frühen und auch der späten Bundesrepublik entgegengestellt.
Der schwindenden Mitte Weimars entspricht die hypertrophe Mitte der alten und neuen Bundesrepublik, wo selbst die aus linksradikalen Ursprüngen hervorgegangenen Grünen in der bürgerlichen Mitte angekommen und richtungweisende Fragen der deutschen Politik aus den Parlamentsreden verschwunden sind.
Der Text enthält weder Sensationen noch Neuentdeckungen. Allerdings besitzt Münkler die beneidenswerte Fähigkeit, das Altbackene neu und das Wohlbekannte originell erscheinen zu lassen. Ihm gelingt es, in vier Zeilen von Polybios bis Paul Nolte und auf 40 Seiten einmal durch die Menschheitsgeschichte zu führen. Hinzu tritt eine hohe Schlagzahl der Apercus und Zitate erlesener Qualität. Wie in einer Juke Box werden Dutzende Zitat-Leckerbissen aus 2500 Jahren europäischer Geistesgeschichte angespielt. Es spricht für die Ausnahmequalitäten des Autors, wenn ein so gebauter Text an keiner Stelle oberflächlich wirkt.
Der mit großer Präzision gedachte, meisterlich verdichtete und glänzend geschriebene Text bietet weder Wertung noch Urteil. Münkler verharrt in der Position des Beobachters und legt 2500 Jahre Geschichte in vier ordentlich gehefteten Stapeln vor. Ein komprimiertes Bildungserlebnis, das sich zudem lesen lässt als Gegengift zur alarmistischen Gebrauchspublizistik, in welcher der Mittelstand aufgeregt über sich selbst schreibt.
Herfried Münkler: Mitte und Maß. Der Kampf um die richtige Ordnung
Rowohlt Berlin, 2010
"Die Mitte ist ein Stabilitätsanker der Gesellschaft – oder kann dies zumindest sein, wenn sie bestimmten Anforderungen genügt. Sie ist aber ebenso ein hochbewegliches Ruder, das der Gesellschaft Anpassungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft verschafft."
Unter Berufung auf Hans Magnus Enzensbergers Essay "Mittelmaß und Wahn" impliziert auch Münkler, eine Gesellschaft, in der Machthaber, Meinungen, Freuden, Ängste und Kunstwerke "mittelmäßig" sind, habe etwas "Erlösendes".
Die Mitte kann der ruhende Pol, das Kraftzentrum eines Gemeinwesens sein, der Schutz gegen brutalisierende Extreme, Ausgewogenheit im Urteil, oder aber Philistertum, Dekadenz und Untergang im Mittelmaß.
Mit Hegel gibt Münkler einleitend zu bedenken, dass die Perioden politischen Glücks die leeren Seiten der Weltgeschichte seien. Um nicht in Langeweile und Mittelmaß zu versinken, vor allem aber, um sich selbst zu definieren, ist die Mitte mit den Extremen dialektisch verbunden.
"Die Mitte ist (...) in weitaus höherem Maße auf die sie umgebenden Extreme angewiesen, als sie wahrhaben will. Sie zapft den notorischen Erregungszustand der Peripherie an, um die Ruhe zu bewahren. Das aber heißt, dass die Mitte beschränkt bleiben muss. Wo alles Mitte ist, ist es mit der Mitte schnell vorbei. In diesem Sinne ist sie nicht nur der Hüter des Maßes, sondern muss auch selbst maßhalten."
In den vier Kapiteln des Buches wählt Münkler vier verschiedene Zugriffe, um Geschichte, Bedeutung und Metaphorik der Mitte darzustellen. Der erste Abschnitt über "Mitte und Maß" leistet eine historische Einordnung und liefert eine pointierte Darstellung der in den letzten Jahren stark angeschwollenen Diskurse über eine Bedrohung der Mitte.
Das Zweite darstellerisch und analytisch wohl stärkste Kapitel, mit dem Titel "Mitte und Macht" ist eine philosophiegeschichtliche tour de force, die Münkler mit der Antike, vor allem mit Aristoteles als dem Philosophen der Mitte, beginnen und mit Karl Marx und seiner Stellung zwischen Französischer und Industrieller Revolution enden lässt.
Bis zur Französischen Revolution ging es vor allem um den Gegensatz zwischen wenigen Reichen und vielen Armen, jetzt taucht mit den Extremen links und rechts eine neue Sprache auf, die das 19. und 20. Jahrhundert prägen wird. Den Chor der Negativstimmen führt in diesem Kapitel Friedrich Nietzsche an, der die Mitte nicht mehr als Sprungbrett, sondern als tristes Grab der Außerordentlichen sah:
"Nietzsche begreift die Vermittelmäßigung als eine überlebensnotwendige Reaktion des Menschen auf die Herausforderungen der Moderne; die moderne Welt erzwingt die Vermittelmäßigung der Menschen und die Mittelmäßigen werden zum stabilisierenden Element der modernen Welt."
Im dritten Kapitel über "Mitte und Raum" werden geopolitische und geostrategische Vorstellungen analysiert, Deutschlands viel debattierte "Mittellage" mit ihren politischen und militärischen Konsequenzen, etwa im Falle eines Zweifrontenkrieges. Die politische Angstfigur der "Einkreisung" mit der militärischen Antwort der schnellen Umfassung des Gegners analysiert Münkler anhand des berühmten und im Sommer 1914 fatal scheiternden Schlieffen-Plans.
Der vierte und letzte Abschnitt über die "Republik der Mitte" ruft zunächst die Diskussionen um das Scheitern der Weimarer Republik als Resultat einer belagerten und schließlich zerbrochenen Mitte in Erinnerung. Der hier fatal zerriebenen Mitte wird die nivellierte Mittelstandsgesellschaft der frühen und auch der späten Bundesrepublik entgegengestellt.
Der schwindenden Mitte Weimars entspricht die hypertrophe Mitte der alten und neuen Bundesrepublik, wo selbst die aus linksradikalen Ursprüngen hervorgegangenen Grünen in der bürgerlichen Mitte angekommen und richtungweisende Fragen der deutschen Politik aus den Parlamentsreden verschwunden sind.
Der Text enthält weder Sensationen noch Neuentdeckungen. Allerdings besitzt Münkler die beneidenswerte Fähigkeit, das Altbackene neu und das Wohlbekannte originell erscheinen zu lassen. Ihm gelingt es, in vier Zeilen von Polybios bis Paul Nolte und auf 40 Seiten einmal durch die Menschheitsgeschichte zu führen. Hinzu tritt eine hohe Schlagzahl der Apercus und Zitate erlesener Qualität. Wie in einer Juke Box werden Dutzende Zitat-Leckerbissen aus 2500 Jahren europäischer Geistesgeschichte angespielt. Es spricht für die Ausnahmequalitäten des Autors, wenn ein so gebauter Text an keiner Stelle oberflächlich wirkt.
Der mit großer Präzision gedachte, meisterlich verdichtete und glänzend geschriebene Text bietet weder Wertung noch Urteil. Münkler verharrt in der Position des Beobachters und legt 2500 Jahre Geschichte in vier ordentlich gehefteten Stapeln vor. Ein komprimiertes Bildungserlebnis, das sich zudem lesen lässt als Gegengift zur alarmistischen Gebrauchspublizistik, in welcher der Mittelstand aufgeregt über sich selbst schreibt.
Herfried Münkler: Mitte und Maß. Der Kampf um die richtige Ordnung
Rowohlt Berlin, 2010
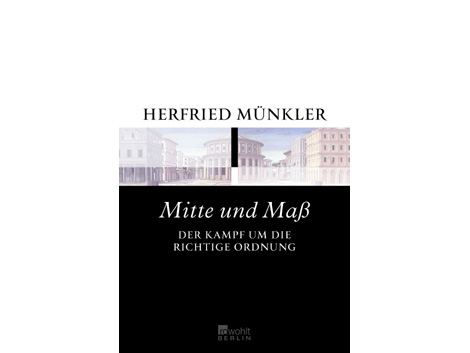
Cover: "Mitte und Maß. Der Kampf um die richtige Ordnung" von Herfried Münkler© Rowohlt Berlin
