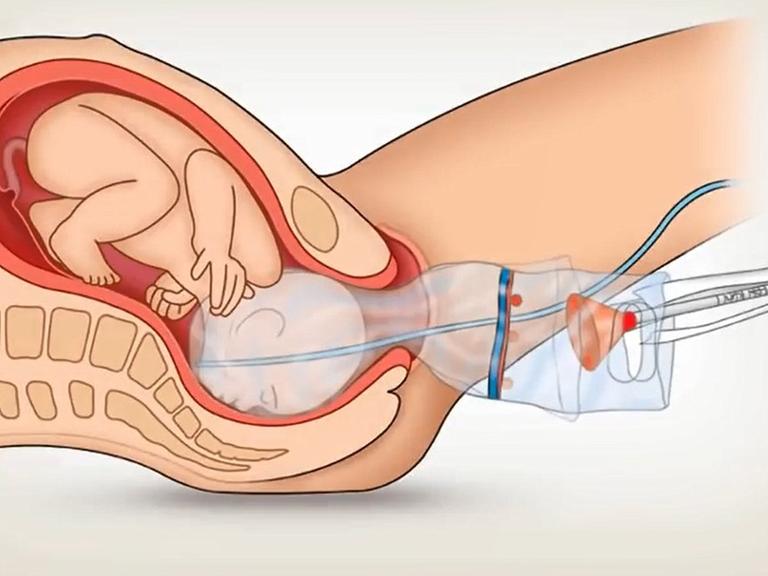Lebensretterin aus der Todeszelle
22:24 Minuten

Jährlich werden die "Alternativen Nobelpreise" verliehen. Geehrt werden Menschen, die Antworten liefern für die Gestaltung einer besseren Welt. Wir stellen drei Frauen vor, die Großes geleistet haben oder planen - eine sogar aus der Todeszelle.
Kapitel 1: Susan Kigula kämpft gegen Todesurteile in Uganda
Kampala – Hauptstadt Ugandas. Der Gefangenenchor im Luzira-Frauengefängnis ist gekleidet in rosa Kittel. Solistin ist Susan Kigula. Eine junge Frau mit traurigem Blick. Sie singt von der zweiten Chance, um die die Gefangenen ihr Land bitten. Eine berührende Szene - zu sehen in einem Dokumentarfilm des britischen Filmemachers Joe Sinclair – im Mai 2008. Weniger als ein Jahr später wird die Todeskandidatin zu einer Heldin in Uganda avancieren.
Anruf bei Susan Kigula. Ihr Weg durch die Hölle habe im Jahre 2000 begonnen, erzählt sie mir. Damals war sie gerade 20.
"Eines nachts wurden wir überfallen. Die Täter töteten meinen Freund. Ich kam mit einer Halsverletzung ins Krankenhaus. Trotzdem behaupteten die Polizei und Verwandte meines Freundes, ich hätte ihn umgebracht. Ich kam ins Gefängnis, hatte keinen Anwalt, niemanden, der mich unterstützte. Vor Gericht behaupteten dann Zeugen, die die Familie meines Freundes präsentierte, absurde Dinge über mich. Und meinen Pflichtverteidiger traf ich erst am Tag der Verhandlung. Ich wurde dann für schuldig erklärt und zum Tode verurteilt."
Das war seinerzeit die zwingend verhängte Strafe für Mord in Uganda. Im Todestrakt teilte sich Susan Kigula eine Zelle mit drei anderen Frauen. Sie schliefen auf einer Matte. Als Toilette diente ein Eimer. Morgen für Morgen drohte der Galgen. Und Kigulas kleine Tochter musste ohne die Mutter aufwachsen. Ihr Glaube an Gott, sagt sie, habe ihr geholfen, nicht zu verzweifeln. So wie eine andere Zellengenossin, die beim Blick in eine alte Zeitung der Schock traf.
"Plötzlich begann sie zu schreien: 'Mein Kind! Mein Kind!' In der Zeitung sah ich dann das Bild eines Kindes, das in einer Mülltonne wühlte. Es suchte wohl etwas zu essen. Die Frau schrie und schrie. Wir konnten sie nicht beruhigen. Eine Sozialarbeiterin fragte dann in der Stadt nach, ob man das Kind suchen könne. Und wir baten den Gefängnispfarrer um Hilfe. Vergebens. Die Frau versank in Depressionen. Und als ich entlassen wurde, wusste sie noch immer nichts über das Schicksal ihrer Kinder."
Die Todeskandidatin macht Abi und ein Jura-Studium
Sehr bald habe sich aus ihrer Wut ein Wille zu kämpfen entwickelt, berichtet Susan Kigula – zu kämpfen, um Gerechtigkeit für sich und andere. Und der einzige Weg zum Erfolg, das sah sie schnell, führte über juristisches Wissen und Unterstützer draußen. Kigula lehrte Mitgefangene Lesen und Schreiben, machte selbst das Abitur und setzte durch, dass sie in Haft und als Frau studieren durfte. Jura im Fernstudium an der University of London. Jede Woche erhielt sie Audiodateien mit Vorlesungen.
"Das Studium war schwer für mich. Ich studierte ja nicht in einem Seminar, sondern unter einem Baum. Allein, ohne Tutoren, ohne Zugang zum Internet musste ich juristische Theorien begreifen und dieselben Prüfungen absolvieren wie normale Studenten. Egal. Ich hatte die Herausforderung angenommen und tat alles, der Welt zu zeigen, dass auch Gefangene ihr Leben auf neue Füße stellen können. Und ich wollte mithilfe des Studiums meinen Mitgefangenen helfen bei ihrem Kampf mit dem Rechtssystem."
Susan Kigula begann, Anträge auf Bewährung zu schreiben für Mitgefangene. Dann Anträge auf Wiederaufnahmeverfahren. Und: Sie reichte eine Klage ein bei Ugandas Verfassungsgerichtshof. Im Namen aller 417 zum Tode Verurteilten in Uganda forderte sie, dass das Gericht die obligatorische Todesstrafe bei Mord für verfassungswidrig erklärte. Juristen der Hilfsorganisation "African Prisons Project" unterstützen die Klage. Und am 21. Januar 2009 verkündeten die Richter ihr Urteil.
Automatische Todesstrafe bei Mord ist verfassungswidrig
"Die automatische Verhängung der Todesstrafe bei Mord wurde als verfassungswidrig verworfen. Und wir alle im Todestrakt hatten plötzlich neue Hoffnung. Keine von uns konnten sie jetzt mehr hängen. Wir alle konnten neue Prozesse anstrengen, bei denen die genauen Umstände unserer angeblichen Morde ermittelt werden mussten. Und diejenigen, die bereits die Höchststrafe von 20 Jahren verbüßt hatten, wurden freigelassen."
Susan Kigula hat als Gefangene ihr Land verändert. Heute sitzen in Ugandas Todeszellen nicht mehr 60 Frauen wie vor dem Urteil des Verfassungsgerichts, sondern nur noch fünf – und rund 130 Männer. Die Vollstreckung von Todesurteilen ist sehr unwahrscheinlich geworden. Und die Entscheidung hatte Signal-Wirkung: Auch das Oberste Gerichts Kenias hat das ugandische Urteil übernommen.
Susan Kigula saß danach weitere sieben Jahre im Luzira-Gefängnis. Sie baute dort eine Gefangenenschule auf, bis sie 2016 freigelassen wurde. Eine Frau mit kaum fassbarem Glauben an das Gute und fast übermenschlicher Willenskraft – meint Roland Ebole. Er arbeitet für die Menschenrechtsorganisation "Amnesty International" in Kampala:
"Susan Kigula hat vielen Gefangenen den Weg gebahnt, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen – insbesondere Frauen. So viele von ihnen machen jetzt einen Schulabschluss. Manche studieren auch die Gesetze, um vielleicht ihren Fall neu aufrollen zu lassen. Und sie helfen anderen Frauen, für sich Gerechtigkeit zu erkämpfen."
Als Botschafterin des "African Prison Project", das sich für Gefangene in ganz Afrika einsetzt, hält Susan Kigula heute Vorträge im In- und Ausland.
Zentrum für Kinder von inhaftierten Frauen
Und sie hat ein Zentrum für Kinder gefangener Frauen gegründet, über das auch der Fernsehsender Al Jazeera berichtet. Kigula ist in einer Traube von Kindern zu sehen. Mir erzählt sie über ihre jahrelange Sorge um die eigene Tochter, die bei Verwandten aufwuchs und über die Verzweiflung anderer gefangener Frauen, deren Kinder auf der Straße leben oder von Angehörigen sexuell missbraucht werden. Das habe sich tief eingegraben in ihre Seele.

Die Juristin Susan Kigula (hinten, mit Sonnenbrille) gründete in Uganda ein Zentrum für Kinder von inhaftierten Frauen.© Susan Kigula
Mit einigen Freundinnen holt Kigula Kinder von der Straße und besorgt ihnen, zumindest vorläufig, Unterkunft bei älteren Frauen, finanziert mit Spenden.
"Wir sorgen dafür, dass die Kinder wieder zur Schule gehen und eine Chance im Leben haben. Schließlich sind sie nicht verantwortlich für Fehler, die ihre Eltern begangen haben. Zurzeit sammeln wir Geld für ein Heim. Nur wenn die Kinder unter einem festen Dach leben, zur Schule gehen, genug zu essen haben und behandelt werden, wenn sie krank sind – nur dann können sie heranwachsen wie Kinder, um die sich die Eltern kümmern."
Die Juristin Susan Kigula, die 16 Jahre im Gefängnis saß, würde gern auch als Anwältin arbeiten. Das aber darf sie nicht als offiziell Vorbestrafte. Und so kämpft diese schier unermüdliche Frau einen weiteren Kampf: Sie sucht neue Beweise und Zeugen für eine Wiederaufnahme ihres Mordprozesses. Denen, die sie beinahe an den Galgen brachten, habe sie allerdings längst verziehen, sagt sie mir zum Abschied.
Kapitel 2: Margarita Monforte trotzt der Metro in Lima
Es ist gemütlich im Wohnzimmer von Margarita Monforte: das braune Sofa, der Esstisch, auf dem in den Tassen Tee dampft. Die Bilder der Enkel auf dem Geschirrschrank. Einmal mehr schenkt Margarita mir ein – fürsorglich lächelnd, ihre Bewegungen schnell und energisch. Den jahrelangen, zermürbenden Kampf für dieses Wohnzimmer, für ihr Haus und die ganze Siedlung sieht man ihr nicht an. Dieser Kampf jedoch hat Margarita Monforte zu einer lokalen Berühmtheit gemacht in Perus Hauptstadt Lima.

Margarita Monforte mit Bildern in ihrem Wohnzimmer vom Bau ihrer neuen Siedlung.© Deutschlandradio / Thomas Kruchem
Margarita, eine 50-jährige Krankenschwester, hat dafür gesorgt, dass 42 Familien aus einer informellen Siedlung Limas – mit Wellblech- und Lehmhütten – nicht an den Stadtrand zwangsumgesiedelt wurden, sondern gleich hier neue, ordentliche Häuser bekamen.
Alles beginnt 2007 – als Margarita in Gesetzestexten herausfindet, dass den Bewohnern ihrer Siedlung nach 50 Jahren längst Wasser-, Abwasser- und Stromanschlüsse zustehen – und Eigentumstitel für die Grundstücke. Also mobilisiert die energiegeladene Frau alle Nachbarn für Demonstrationen, mit "gebotenen Lautstärke", wie sie sagt. Das Fernsehen berichtet über den Präzedenzfall. Und sogar der damalige Präsident Alan García kommt zu den Baracken im Zentrum Limas.
Der Schock von der Zwangsumsiedlung
"Der Präsident versprach uns, dafür zu sorgen, dass wir unsere Grundstücke kaufen könnten. Alan Garcia hatte da ein Programm aufgelegt – mit dem Titel ‚Ich bin Eigentümer‘. Wenig später aber hörten wir plötzlich, dass genau dort, wo unsere Grundstücke lagen, die neue Metro verlaufen sollte."
Ein Schock für die Asociación Virgen del Carmen, wie sich die Siedlergemeinschaft nennt. Sie sollen verschwinden für die Metrostation Cercado. Der Bahn-Ausbau soll das Chaos auf Limas Straßen verringern.
Lima ist mit fast zehn Millionen Einwohnern nach Kairo die zweitgrößte Wüstenstadt der Welt. Die Infrastruktur konnte mit dem Wachstum nie mithalten. Und die Hälfte der Einwohner lebt in schäbigen Unterkünften – feucht, dunkel, schlecht belüftet, ohne Wasseranschluss. Wie heute das Coronavirus grassiert dort schon immer die Tuberkulose. Verständlich, dass Margarita Monforte und ihre Nachbarn alles taten, um endlich richtige Wohnungen zu erhalten. Doch die Metro-Behörde wollte sie nach Lomas de Carabayllo umsiedeln.
"Wir können Euch in ordentliche Häuser umsiedeln, sagten sie, in Häuser mit Wasser und Strom. Die Häuser lagen aber zwei Autostunden entfernt von der Innenstadt. Nein, haben wir gesagt. Wir wollen in der Gegend bleiben, wo wir schon immer leben."
Kein Wunder: Lomas de Carabayllo ist ein Elendsviertel, gelegen im äußersten Norden Limas, an Steilhängen mitten in der Wüste, weitab von jedem Arbeitsplatz. Soweit das Auge reicht, kein bisschen Grün. Nur öde Hütten auf grau-braunem Geröll. Und überall Staub. Hier wollten die 42 Familien der Asociación Virgen del Carmen auf gar keinen Fall hin.
Also habe die Metro-Behörde versucht nachzuhelfen, berichten die Frauen in Margarita Monfortes Wohnzimmer. Sie schickte Bauarbeiter. Und die hätten mit Wasserschläuchen auf die Hüttendächer der Siedler gezielt, erzählt mir Margaritas Freundin Marilú Camacho. Tage später erreichte der Konflikt einen Höhepunkt:
"Ich weiß es noch, als ob es heute geschehen wäre: Die Bagger für die Metro fuhren ganz nah an das Haus meines Bruders heran und gruben dort, bis die Decke seines Hauses einstürzte. Meine Schwägerin war damals gerade schwanger. Es gab einen großen Aufruhr. Und Nachbarn riefen die Polizei. Ein Gericht entschied dann, dass, solange wir in den Häusern lebten, keine Bauarbeiten mehr stattfinden dürften."
Ein Desaster für Limas Metro-Behörde. Und die Siedler verschärften einmal mehr ihren Protest: Frauen und Kinder blockierten die Metro-Baustelle und veranstalteten Sit-ins vor dem Büro der Behörde.
Die Verbündete in der Metro-Behörde
Sie machten Radau mit Trillerpfeifen und Kochtöpfen und schafften es einmal mehr ins Fernsehen. Zwei Jahre tobte der Zermürbungskampf. Dann hatte Margarita Glück. Sie fand eine Verbündete in der Metro-Behörde: die Juristin Patricia Gonzales, mit der sie heute befreundet ist.
"In der Metro-Behörde arbeiten fast nur Bürokraten, die Angst um ihren Job im öffentlichen Dienst haben. Auf keinen Fall wollten diese Bürokraten den Familien der Asociación Virgen del Carmen neue Häuser in der Nähe ihres alten Zuhauses geben. Nein, sagten die von der Rechtsabteilung immer wieder. Nein, das tun wir nicht. Ich bin dann direkt zum Minister gegangen – und zu den anderen wichtigen Bossen. Wir müssen es tun, habe ich gesagt. Nur das ist fair und gerecht."

Die 42 Familien der Siedlergemeinschaft Asociación Virgen del Carmen wohnen nun in neuen, gelben Häusern nahe der neuen Bahn-Linie von Lima.© Deutschlandradio / Thomas Kruchem
Unterstützt von Patricia Gonzalez setzten die Siedler durch, dass die Metro-Behörde ihnen ein Grundstück kaufte: 8000 Quadratmeter direkt neben der Metrostation. Und sie setzten durch, dass die Behörde 42 neue Häuser baute – in leuchtendem Gelb – mit je 75 Quadratmetern Wohnfläche im Erdgeschoss, aufstockbar um zwei Geschosse. Dazu: ein Spielplatz und Grünanlagen. Im Juli 2014 übergab Patricia Gonzales Margarita die Schlüssel. Am 19. April 2019 wurden die Siedlerfamilien offiziell Eigentümer auch der Grundstücke.
Der Erfolg der Siedlergemeinschaft Virgen del Carmen zeige, was Menschen auch in Peru erreichen können, wenn sie straff organisiert und solidarisch zusammenstehen, sagt mir schließlich – im Schatten junger Bäume am Spielplatz ihrer Siedlung – Margarita Monforte. 2016 erhielt sie eine Auszeichnung des UN-Siedlungsprogramms HABITAT. Und inzwischen berät sie in ganz Peru informelle Siedler, vermittelt auch ihnen Hoffnung und Know-how.
"Wir empfehlen den Leuten immer, strategisch vorzugehen. Sie müssen sich ordentlich organisieren und auch außerhalb ihres Wohnquartiers Unterstützung suchen. Als wir damals demonstrierten, hätten wir nichts erreicht, wenn nicht so viele Leute mitgemacht hätten."
Kapitel 3 - Leslie Field will die Eisschmelze bremsen
Reykjavík, Island, im Oktober 2019. Leslie Field spricht vor der Hauptversammlung des Arctic Circle, des weltweit größten Kooperationsnetzwerks zur Arktis. Lebendig und humorvoll skizziert die Ingenieurin und Professorin der kalifornischen Stanford-Universität ein Projekt, mit dem sie den Klimawandel bremsen will. Ein Projekt, das Kritiker für eine gefährliche Utopie halten. Als ich mit Leslie Field telefoniere, frage ich sie gleich, wie ausgerechnet sie auf die Idee kam, den Klimawandel zu bekämpfen – als Chemieingenieurin, die für den Ölkonzern Chevron gearbeitet hat; als Elektroingenieurin, die zahlreiche Patente zu elektromechanischen Sensoren hält. Da sei ein Schlüsselerlebnis gewesen, antwortet Leslie Field.
"Als ich 2006 Al Gores Film 'Eine unbequeme Wahrheit' sah, blickte ich auf meine Kinder, die damals sechs und zehn Jahre alt waren. Und ich dachte: Sie werden diese Wahrheit zu spüren bekommen im Laufe ihres Lebens. Was können wir tun, um ihnen zu helfen?"
Klimafreundliches Verhalten im Alltag war der ehrgeizigen Ingenieurin nicht genug. Sie wollte Messbares bewirken und kam so auf die Arktis. Deren Meereseis reflektiere große Mengen Sonnenlicht und kühle so die Erde. In den letzten 40 Jahren jedoch habe die Arktis drei Viertel ihres Eisvolumens verloren. Der Meeresspiegel steige auch deshalb. Und so werde es wiederum noch wärmer, und noch mehr Eis schmelze.
Eisschmelze stoppen mit Glaskörnchen aus Kieselsäure
"Eine Statistik die mich sehr beeindruckte, war: 20 Prozent des globalen Temperaturanstiegs werden verursacht durch das Abschmelzen von Eis, dass ja enorm viel Sonnenstrahlung reflektiert. Und als Ingenieurin fragte ich mich: Gibt es ein ökologisch sicheres Material, dass wir in Schlüsselregionen ausbringen könnten? Ein Material, das dann die Eisschmelze bremst und einen Teil des verlorenen Reflexionspotenzials wiederherstellt. Mit dieser Frage fing alles an."
Weiße Plastikplane, mit denen schon Schweizer Gletscher abgedeckt wurden, wollte die Ingenieurin schon aus ökologischen Gründen nicht benutzen. Irgendwann stieß sie auf ein weißes Pulver – luftgefüllte Mikroglaskugeln, die zur Isolierung von Häusern benutzt werden und als höchst umweltverträglich gelten.
"Diese Glaskörnchen bestehen größtenteils aus amorpher Kieselsäure – also nicht aus kristallinem Glas, das bei Mensch und Tier Lungenprobleme verursachen kann. Außerdem sind die Körnchen so groß, dass man sie normalerweise nicht einatmet. Und: Es gibt den Rohstoff Kieselsäure überall auf der Erde, in fast jedem Gestein."

US-Chemie-Ingenieurin Leslie Field in der Arktis bei Tests für ihr "Arctic ICE Project", das die Reflektion der Sonnenstrahlung erhöhen soll.© Leslie Field
2008 gründete Leslie Field mit einigen Kollegen eine gemeinnützige Organisation, die sich heute "Arctic ICE Project" nennt. Und sie begann zu experimentieren – auf kleinen zugefrorenen Süß- und Salzwasserseen in Alaska. Mit behördlicher Genehmigung brachte sie ihr Pulver mittels einer Sämaschine aus – angehängt an ein Schneemobil. Vom Erfolg was sie selbst überrascht. Das hydrophile Pulver verband sich hervorragend mit dem Eis. Und die Eisflächen reflektierten 50 Prozent mehr Sonnenlicht als zuvor. Die nächste Stufe wäre nun der großräumige Einsatz der Technologie – möglichst in arktischen Schlüsselregionen, was die Wirksamkeit multiplizieren könnte. Von Eisbrechern aus könnte man solche Flächen besprühen, meint Leslie Field. Weil die Glaskörnchen mit der Zeit im Ozean versinken oder sich auflösen, müsse dies Jahr für Jahr wiederholt werden.
"Für 100.000 Quadratkilometer inklusive Transportkosten und Überwachung von Wirksamkeit und ökologischer Sicherheit der Maßnahmen brauchen wir zwischen einer und fünf Milliarden US-Dollar pro Saison."
Kritik am Geo-Engineering von Heinrich-Böll-Stiftung
So viel Geld für technische Großprojekte gegen den Klimawandel auszugeben, halten Kritiker des sogenannten Geo-Engineering für Wahnsinn. Ich telefoniere mit Lili Fuhr. Die Geo-Engineering-Expertin der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung hält das "Arctic Ice Project" für höchst gefährlich.
"Grundsätzlich bei all diesen Geo-Engineering-Projekten ist überhaupt nicht absehbar, was da eigentlich passieren wird. Denn das Klima ist ja ein total komplexes System mit ganz vielen Faktoren, die da beeinflusst werden, und wenn man jetzt an einer Stelle eingreift und da einen Fremdstoff einbringt, können wir überhaupt nicht vorhersehen, was dann letztendlich lokal und regional, ökologisch, aber auch global gesehen mit dem Klima passiert."
Das stimme, sagt Leslie Field. Vor dem Versprühen von Glaspulver auf arktisches Eis müssten natürlich unabhängige Experten die Auswirkungen prüfen.
"Wir brauchen externe Instanzen, die wissenschaftlich analysieren, welche Maßnahmen im Interesse der Menschheit liegen. Instanzen, die dann auch über die Genehmigung und Finanzierung solcher Maßnahmen entscheiden."
Nein, auch das helfe nicht, entgegnet die deutsche Kritikerin.
"Solche Geo-Engineering-Technologien sind letztlich nicht testbar in ihrem eigentlichen Klimaeffekt. Denn jeglicher Test, der tatsächlich einen Klima-Effekt hätte, würde einer kompletten Anwendung gleichkommen. Und da wiederum sind die Folgen tatsächlich überhaupt nicht absehbar."
Kein weißes Pulver also gegen den Klimawandel – weil nicht alle Folgen absehbar sind? "Nein", sagt Leslie Field entschlossen. Nachhaltige Maßnahmen, die nur sehr allmählich Wirkung zeigten, reichten nicht angesichts eines Klimawandels, der immer rascher an Tempo gewinne. Mit dem scheinbar utopischen Arctic Ice Project könne die Menschheit möglicherweise viel Zeit gewinnen.