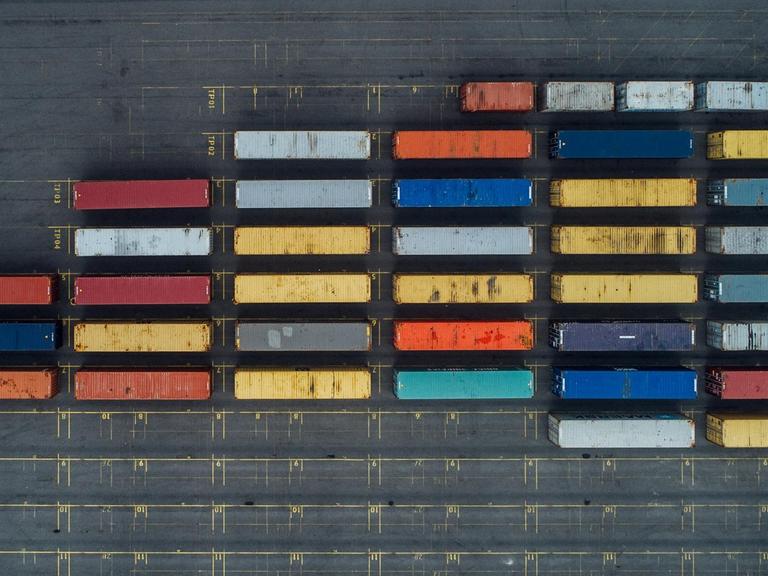Aus den Fehlern der Finanzkrise lernen
08:05 Minuten

Einen Abgesang auf den Kapitalismus anzustimmen, hält der Grünen-Politiker Gerhard Schick für verfrüht. Die Vergangenheit zeige: Nach dramatischen Wirtschaftskrisen sind die alten Kräfteverhältnisse schnell wiederhergestellt.
Ute Welty: Die Krise als Anstoß zum Wandel, in Zeiten von Corona erleben wir, wie alte Gewissheiten ins Wanken geraten: Das Dogma vom ewigen Wachstum und der Profitmaximierung steht infrage. Wir haben in dieser Woche vielfältig darüber gesprochen, über die neuen Möglichkeiten, das Wirtschaftsleben flexibler, ökologischer, gemeinwirtschaftlicher zu gestalten. Heute vor zehn Jahren war zum Beispiel das Rettungsprogramm für Griechenland gestartet, und schon damals stellen viele die Frage nach Finanzmarktreform und Systemwechsel. Ich spreche heute mit Gerhard Schick, Grünen-Politiker und geschäftsführender Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende.
Die Weltwirtschaft steht zu großen Teilen seit Wochen still, die Börsen sind abgestürzt, in vielen Ländern steigt die Arbeitslosigkeit rapide. Ist das das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen?
Schick: Ich glaube schon, dass diese Krise sehr tiefe Auswirkungen haben wird, auch langfristig, selbst, wenn dann mal die Virusfrage vorbei sein sollte. Trotzdem würde ich den Abgesang auf den Kapitalismus noch nicht anstimmen. Ich erinnere mich, wie vor zwölf Jahren, also im Herbst 2008, als das Weltfinanzsystem am Abgrund stand, auch viele gedacht haben, jetzt wird es eine grundlegende Änderung geben. Und kaum waren die Banken einigermaßen stabilisiert, waren eigentlich die alten Kräfteverhältnisse wieder hergestellt und es war extrem schwierig, Gesetze durchzusetzen, die die Geschäftsmodelle der Banken verändert hätten. Es ging eigentlich in großen Stücken weiter wie vorher. Deswegen: Da ist schon auch eine große Beharrungskraft, und es wird viel Anstrengung kosten, das System besser aufzustellen.
Welty: Der EU-Gipfel vergangene Woche hat ja ein gigantisches Rettungspaket beschlossen. Geht das aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung?
Schick: Da sind schon viele richtige Sachen auch beschlossen worden, also zum Beispiel dieser gemeinsame Wiederaufbau-Fonds. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Man kann nicht meinen, dass in dem Moment, wo der Lockdown zu Ende ist, plötzlich dann die Wirtschaft wieder auf normal springt, sondern da wird es eine Anschubfinanzierung brauchen. Aber ich sehe die Gefahr einer neuen Euro-Krise nicht gebannt. Im Moment puffert die Europäische Zentralbank da sehr viel ab, aber das ist nicht sicher, ob das langfristig so bleiben wird. Und deswegen glaube ich: Es geht kein Weg daran vorbei, die Krisenlasten auch wirklich gemeinsam zu finanzieren und auch das europäische Haus der Währungsunion stabiler zu machen. Leider sind da einige Reformen auch nach der Euro-Krise steckengeblieben.
Es reicht nicht, einfach Geld reinzugeben
Welty: Rettungspakete sind für die EU ja nichts Neues, eben heute vor genau zehn Jahren wird das für Griechenland gestartet – verbunden mit harten Auflagen. Müssen wir darauf nicht auch in Zukunft achten?
Schick: Natürlich muss immer, das gilt bei Unternehmen wie bei Staaten, auch geschaut werden, dass man nicht einfach nur wo Geld rein gibt, sondern dass auch gute Strukturen da sind. Im Fall von Griechenland muss man sagen, dass diejenigen, die damals die Programme geschrieben haben, zum Beispiel der Internationale Währungsfonds, selber inzwischen sehen, dass man da zu hart gewesen ist bei den makroökonomischen Vorgaben, und damit die Wirtschaftskrise in Griechenland und die Stabilisierung angesichts der Schuldenthematik sogar verschlimmert hat, also herausgezögert hat. Da hat man schon auch massive Fehler gemacht bei der Rettung Griechenlands, das geben die Akteure selber zu.
Welty: Am Ende der Finanzkrise konnte man dann oft beobachten, dass Gewinne privatisiert werden, Verluste sozialisiert. Wie lässt sich das jetzt verhindern?
Schick: Ich glaube, man muss da aus den Fehlern lernen, die 2008 gemacht worden sind, und das gilt zum Beispiel jetzt, wenn es darum geht, Unternehmen zu retten. Wenn die Informationen, die wir jetzt über die Lufthansa-Rettung haben, stimmen, ist es allerdings nicht der Fall, dass aus den Fehlern gelernt wird, sondern man wiederholt genau den Fehler, den man bei der Commerzbank gemacht hat. Auch damals war der Staat sehr großzügig zu den Aktionären und hat praktisch die Aktien übernommen zu dem aktuellen Marktpreis, in dem ja aber schon die Erwartung drin war, dass der Staat helfen würde. Und so ist das jetzt auch. So richtig es ist, die Beschäftigung zu sichern, so richtig es ist, auch das Unternehmen zu sichern – wir dürfen nicht zulassen, dass in der Krise jetzt alle unternehmerischen Strukturen kaputtgehen, die brauchen wir ja langfristig –, so falsch ist es, die Aktionäre, die in den letzten Jahren insgesamt sehr gute Kursentwicklungen hatten, jetzt mit einem guten Geschenk dabei zu belohnen. Man müsste hier eigentlich so vorgehen, dass die Aktionäre auch relevante Teile der Lasten tragen müssen.
Auch die Aktionäre müssen ran
Welty: Das heißt also, man müsste auch die Verluste von den Aktionären mittragen lassen?
Schick: Ja. Also diese Schutzschirminsolvenz, die es ja auch gibt, die würde eben die Aktionäre voll heranziehen, oder man könnte, wenn man nah an der jetzt gewählten Konstruktion bleiben will, eben dafür sorgen, dass der Aktienkurs deutlich niedriger ist. Bei der Commerzbank ist 2008, 2009 der Staat zu einem so hohen Kurs eingestiegen, wie er nachher nie wieder erreicht worden ist, und deswegen hat diese Rettung für den deutschen Steuerzahler Milliarden gekostet. Das wäre vermeidbar gewesen. Ich finde, es ist ein unfaires und auch unnötiges Geschenk an die Altaktionäre, wenn man die Sicherung der Beschäftigung mit einer großzügigen Offerte für die Aktionäre verbindet. Wer in guten Zeiten Gewinne einnehmen kann, muss auch in schlechten Zeiten für die Verluste geradestehen, sonst sind die Regeln schief.
Welty: Wie lange kann der Staat denn überhaupt in die Pflicht genommen werden in Zusammenhängen mit Lufthansa oder Commerzbank zum Beispiel?
Schick: Wir sehen an der Commerzbank, dass es sehr lange dauern kann, bis der Staat rausgeht. Das hat bei der Commerzbank auch mit dem falschen Einstieg zu tun. Man hat immer gehofft, dass die Aktie irgendwann wieder den Kurs erreicht, sodass der Staat zumindest mit einer Null rauskommt. Das ist aber nie passiert. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, beim Einstieg richtig hinzugucken, das erleichtert dann auch den Ausstieg, denn es sollte ja vielleicht kein Dauerzustand sein, dass der Staat dann an Unternehmen beteiligt ist, die er in der Krise stabilisieren wollte.
Der Staat muss etwas tun
Welty: Auf der anderen Seite sind ja schon wieder jede Menge Finanzinvestments unterwegs, um sich die besten Unternehmensfiletstücke unter den Nagel zu reißen. Lässt sich der Ausverkauf da noch verhindern?
Schick: Deswegen finde ich es nicht falsch, dass der Staat auch etwas tut in der Krise und jetzt nicht wartet, dass irgendwelche Finanzinvestoren die Unternehmen, die in Schwierigkeiten kommen, aufkaufen. Und da haben wir schon auch Interesse, langfristig zu schauen, dass gute Strukturen entstehen. Ich finde, es ist insgesamt eine Aufgabe, die der Staat jetzt ernstnehmen muss in der Krise, zu schauen, dass es nicht unberechtigte Krisengewinne gibt. Wir haben gesehen, dass einige Hedgefonds mit Leerverkäufen kräftig Geld gemacht haben, also sozusagen von der Krise noch richtig profitiert haben, während andere Angst um ihren Arbeitsplatz gehabt haben oder gesehen haben, wie ihr Unternehmen pleite geht in der Krise. Das wird dann ja richtig unfair.
Das muss man auf jeden Fall vermeiden. Und was es auch zu vermeiden gilt, ist, dass die Gelder, die der Staat gibt, dann in Schattenfinanzzentren fließen und Unternehmen, die in Schattenfinanzzentren, also Steueroasen aktiv sind, sozusagen den Staat noch schädigen, während er sie rettet. Auch das haben wir bei den Banken gesehen, dass manche Bank, die Geld vom Staat bekommen hat, gleichzeitig mit den CumEx-Geschäften Geschäfte zu Lasten des Steuerzahlers gemacht hat. Also da gibt es schon Aufgaben, genau hinzuschauen, Auflagen zu machen, damit die ganze Sache nicht richtig unfair wird.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.