Streifzüge durch die vereinigte Republik
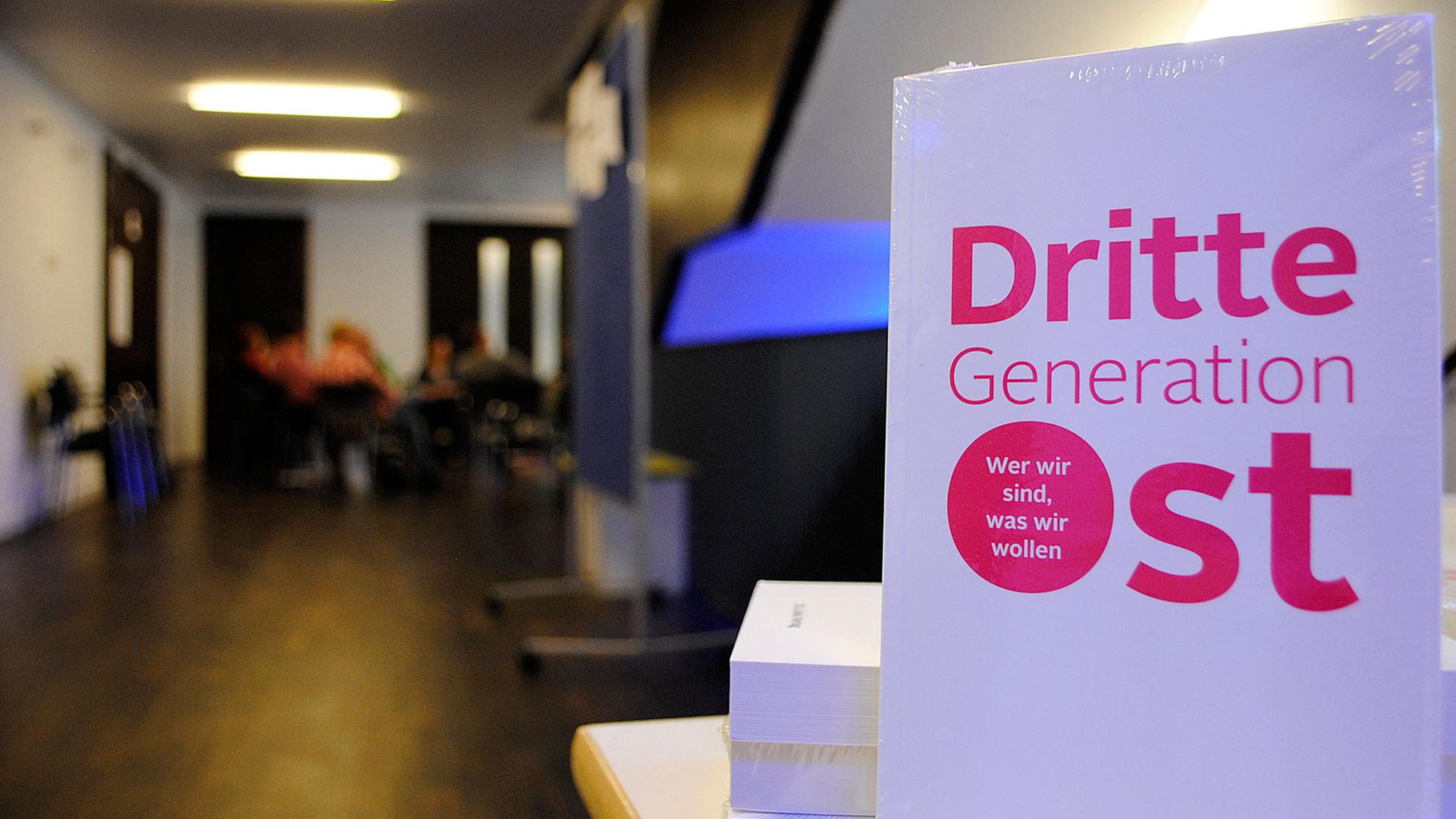
Die von Anfang der 70er-Jahre bis 1985 Geborenen gehören zur Dritten Generation Ost. Viele von ihnen fühlen sich noch immer ostdeutsch. Manche sind in speziellen Initiativen unterwegs, wollen mitgestalten und ihre Stimme zu Gehör bringen.
Ihre Eltern gehören zur DDR-Generation, die Großeltern zur Kriegsgeneration. Viele der Generation Ost fühlen sich noch immer ostdeutsch. Manche sind in Initiativen wie in der Generation Ost aktiv und unterwegs. Sie wollen mitgestalten, wollen ihre Stimme zu Gehör bringen.
A. B.*): "Dass es etwas Besonderes ist, aus der DDR zu kommen, haben mir die Spanier mit ihren Fragen gezeigt. Die waren wahnsinnig interessiert – und haben gesagt: Was, du kommst aus dem Osten? Du hast den Mauerfall erlebt? Und das ist ja eine unglaubliche Freiheit, die du jetzt hast! Und ich konnte diese Begeisterung und dieses Freiheitsgefühl nur bedingt teilen."
Tilmann Löser: "Ich sehe es schon so, dass wir hier im Osten eine existenzielle Umbrucherfahrung erlebt haben. Egal, welchen Alters. Es hat sich das System grundlegend verändert. Und wir haben uns daran irgendwie ausrichten müssen, wir haben uns darauf eingestellt."
Stephanie Maiwald: "Die DDR war bei uns immer ganz präsent. Ich erinnere mich auch, dass mir vermittelt worden ist, dass wir froh sein müssen, in Westdeutschland zu leben und das ist ein großes Glück."
Alexander Fromm: "Bin ich wirklich Ostalgiker? Nein, bin ich nicht! Es geht einfach darum, dass man in einem Land groß geworden ist, das nicht mehr existiert, aber das ja trotzdem sich irgendwie in den Körper eingeschrieben hat – und man kann nicht einfach so eine Identität austauschen."
Ostdeutsch ist eine Erfahrung für diejenigen, die in der DDR nur ihre Kindheit verlebt haben und im vereinigten Deutschland erwachsen geworden sind. Die von Anfang der 70er-Jahre bis 1985 Geborenen gehören zur Dritten Generation Ost. Ihre Eltern erblickten in den 50er- und 60er-Jahren als zweite DDR-Generation das Licht der begrenzten Welt. Die Großeltern, die erste Generation, haben noch den Krieg erlebt.
A.B.: "Es ist ein großer Unterschied, ob man 1950 in der DDR geboren wurde oder so wie ich 1973."
Die Angehörigen der Dritten Generation Ost erleben die Wende als Kinder oder Jugendliche. Viele ihrer Eltern verlieren die Arbeit und wechseln den Wohnort. Ehen zerbrechen und Lebensfäden werden neu geknüpft. Die Erwachsenen können in dieser Zeit nicht wie üblich die Richtung vorgeben.
Die Kinder von einst sind heute zwischen 30 und 40 Jahren alt und fühlen sich noch immer ostdeutsch. Einige von ihnen haben eine Zeitlang im Ausland gelebt und sind an ihre alten oder an neue Wohnorte in Deutschland zurückgekehrt. Sie haben Initiativen gegründet, um sich über ihre Identität zu verständigen. Sie wollen weder die DDR noch die Mauer wiederhaben. Aber sie sagen laut: Hier sind wir! Wir wollen mit unseren besonderen Erfahrungen die wiedervereinigte Republik mitgestalten. Wir wollen, dass Ihr unsere Stimme hört.
Zwischen 1990 und 1991 verloren rund 2,5 Millionen Ostdeutsche ihre Arbeit. Einmalig in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Über Nacht wurden Lebensentwürfe entwertet und über den Haufen geworfen, Menschen nicht mehr gebraucht. Die Eltern suchten eine neue Identität. Ihren Kindern konnten sie in dieser Zeit nur wenig helfen. Diese Orientierungslosigkeit der Eltern und die eigene Identitätssuche holen viele DDR-Kinder jetzt um die 30 wieder ein. Obwohl der 31-jährige Tilmann Löser als Musiker erfolgreich ist und die Welt gesehen hat, stellt er sich immer mehr Fragen – Fragen nach der eigenen Herkunft.
"Es gibt ja diesen Term ´East German Depression`. Ich glaube, ich habe davon etwas mitgekriegt."
Nach einer Krise entschließt sich Tilmann Löser, eine Psychotherapie zu machen. Er nimmt später auch an Biografieworkshops teil, wie A.B. sie anbietet, um seinen Fragen auf den Grund zu gehen.
"Ich hatte dann erst einmal studiert, und ich hatte 2006 Kopfschmerzen, wo ich nicht mehr weiter studieren konnte. Wo mein Körper gesagt hat, irgendetwas stimmt hier nicht. Mach mal Pause. Und dann habe ich angefangen, viel nach innen zu gehen. Auch in der Familie. Mal zu gucken, was ist da eigentlich so alles passiert. Und da habe ich ganz viele Zusammenhänge besser verstanden."
Diese schwierige Zeit hat Tilmann Löser überwunden. Heute ist er sich seiner selbst bewusst und zeigt mit großer Freude seine Stadt Leipzig – die Stadt der Helden, wie sie nach der Wende genannt wurde.
Dem Wessi auf Augenhöhe begegnen
Ortstermin Neustrelitz. Im ehemaligen Residenzstädtchen gibt es ein Schloss und eine Orangerie, Seen und einen Jachthafen. In dem Ort in Mecklenburg-Vorpommern leben rund 20.000 Menschen. Aber es fehlen hier die Jungen um die 30, eine IC-Anbindung an Berlin und ständig kämpft das Handy irgendwo mit einem Funkloch, sagt Adriana Lettrari, als sie aus dem Zug steigt. Sie wurde hier 1979 geboren und macht heute als Vortragende Station.
"Ich war hier hunderte Mal. (Im Hintergrund knattert ein Motorrad) Guck mal hier! So eine alte MZ! Ist ja geil! Hat schon bald Oldtimerwert, oder? Aber tip-top in Schuss."
Als Mitbegründerin der Initiative 3te Generation Ostdeutschland ist sie im Kunstverein Feldberg eingeladen. Im Publikum sitzen fast ausschließlich die Eltern dieser Kinder, die hier vorrangig in die alten Bundesländer oder ins Ausland abgewandert sind.

Adriana Lettrari, Mitbegründerin der Initiative 3te Generation Ost© Jana Demnitz
"Liebe Feldbergerinnen und Feldberger! Haben wir jemanden von nach ’75? Kein Wendekind? Ich darf Ihnen verraten, egal, in welche Stadt in Ostdeutschland ich komme, es gibt immer ein ähnliches Bild wie das, was Sie hier gerade zeichnen. "
Die jungen Frauen und Männer, die zwischen 1970 und 1985 in der DDR geboren wurden, fehlen vor Ort, wie allein der Blick in die Stuhlreihen zeigt. Inzwischen gibt es Anlaufstellen der "Dritten Generation Ostdeutschland" in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Sachsen, in der Schweiz und sogar in den USA.
Nach der Wende studierte Lettrari Politikwissenschaften. Sie arbeitete im Bundestag und in einer Versicherung. "Mehr Macht für Ossis" könnte man ihr Motto zusammenfassen. Dem negativen Bild des schüchternen, zurückhaltenden und resignierten Ostdeutschen möchte sie den selbst- und machtbewussten Ossi entgegensetzen, der dem Wessi auf Augenhöhe begegnet. Die beiden sollen sich zuhören, die unterschiedlichen Erfahrungen nicht bewerten und gemeinsam etwas bewegen. In Feldberg wird am Ende der Veranstaltung nach ihrer Vision gefragt:
"… dass wir es schaffen, da wirklich ein Netzwerk zu kreieren, dass sich eben alle, die so verstreut sind auf der ganzen Welt eingeladen fühlen, einmal im Jahr nach Hause zu kommen und in ihrer Generation zu spüren, dass Leute einen ähnlichen Weg hinter sich gebracht haben. Es sind ja laut Kohorte 2,4 Millionen Menschen. Insofern wird das Olympiastadion nicht reichen. "
In Berlin eröffnete die Initiative Anfang 2014 ihr Hauptstadtbüro. Es kommen keine Millionen, sondern gerade mal 50 Leute. Es ist ein bescheidener Ort an einer unbescheidenen Adresse: Unter den Linden, Ecke Friedrichstraße.
"Unter den Linden, direkt im Regierungsviertel, haben wir natürlich die Gelegenheit, das, was uns immer von Anfang an wichtig war, auch richtig symbolisch zu zeigen."
Die Politik hat die Initiative längst wahrgenommen. Anfangs gab es Geld von der Stiftung Aufarbeitung und später einen gut dotierten Bürgerpreis. Lettrari betont, dass das Netzwerk noch immer rein ehrenamtlich organisiert sei. Einige ihrer ehemaligen Wegbegleiter sehen das anders. Die Initiative 3te Generation Ost gehört inzwischen der auf Lettraris Namen eingetragenen haftungsbeschränkten Kapitalgesellschaft Wendekind gUG. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass sie den Generationszusammenhang auch als Geschäftsidee versteht.
An diesem Eröffnungsabend in Berlin sieht auf den ersten Blick alles nach heiler Welt aus. Am Büffet gibt es Berlinerisch bodenständig Kartoffelsuppe und Hackepeter. Tilmann Löser spielt mit seiner Klezmer-Band "Rozhinkes"– und wird von Lettrari als Sachsen-Koordinator für das Netzwerk angeworben.
"Danke, großes Kino! Was wir jetzt alle gerade erleben konnten, war das, was aus unserer Perspektive das Potenzial der dritten Generation ist, nämlich den Zwischenraum zu besetzen. In einem Ohr hören wir das Flüstern der DDR, in dem anderen Ohr das Flüstern der BRD. Und jetzt geht’s darum (klatscht in die Hände): Okay, what is the nice mixture, was ist die Mischung, wo liegt der Pfeffer!"
Im Oktober 2014 fand das vierte Generationstreffen unter Schirmherrschaft von Bundespräsident Gauck in der Berliner Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern statt. Der Titel "Point Zero" legt einen Neuanfang nahe. Damit öffnete man sich auch für die gleichaltrigen Westdeutschen und die Gleichaltrigen mit Migrationshintergrund. Für die Diskussion über die Neuausrichtung nahm man sich gerade einen Abend Zeit.
Der Abriss einer frisch erbauten Utopie
Ortstermin Eisenhüttenstadt. Stalinstadt - so hieß Eisenhüttenstadt Anfang der 50er-Jahre, als Wohnungen und Geschäfte um das Stahl-Kombinat auf dem märkischen Sand entstanden. Die DDR-Regierung gab ihr den Titel "erste sozialistische Stadt Deutschlands" und im Zuge der Entstalinisierung den Namen Eisenhüttenstadt. Die Einwohnerzahl ist seit der Wende knapp um die Hälfte gesunken auf rund 27.000. Die Stadt liegt im Bundesland Brandenburg. Alexander Fromm, Jahrgang ’73, ist hier aufgewachsen. Diese Stadt hat ihn nicht mehr losgelassen.
"Das Werk ist in sogenannten Sichtachsen noch präsent. Die Hauptverkehrsstraße, die Lindenallee, die Leninallee beziehen sich auf das Werk. Man sieht am Horizont einen Hochofen. So ist die Stadt halt ausgerichtet - nicht so quadratisch, sondern mehr so wie eine barocke Stadt mit geschwungenen Straßen."
Am meisten ist auf der Hauptverkehrsstraße los, der sogenannten Magistrale. Sie heißt heute Lindenallee, früher Leninallee, und läuft direkt auf das Werk zu, in dem immer noch Stahl produziert wird. Wie sah es früher hier aus?
"In Eisenhüttenstadt sieht man das ganz gut, dass da statt kapitalistischer Marktwirtschaft eben sozialistischer Wettbewerb herrschte und wir von allem mit einer Ausgabe uns zufrieden geben konnten: Es gab ein Möbelkaufhaus, ein Hotel, eine Apotheke. Es war für alles gesorgt, aber ohne Konkurrenz."
Als Teenager wollte er Architekt werden. Dann kam die Wende mit ihren Montagsdemonstrationen auch in seine Eisenhüttenstadt.
Obwohl er sich für Kulturwissenschaften und gegen Architektur als Studienfach entschied, fährt er noch immer mit ost- und westdeutschen, polnischen und italienischen Freunden in seine Heimat, um ihnen seine Stadt zu erklären: das Werk, die Magistrale, seine Schule und den Abriss der frisch erbauten Utopie:
"Hier in Eisenhüttenstadt wurde ein ganzer Wohnkomplex abgerissen und zwar der VII. Wohnkomplex ist fast vollständig beseitigt. So geht’s halt weiter. Viele Häuser werden zurückgebaut. Und ich kenne das auch aus anderen Wohnorten, in denen ich mich später aufgehalten habe, dass da ganz viel zurückgebaut wird. Und auch in Dialogen mit Angehörigen der so genannten 3. Generation Ost, also meine Altersgruppe, die können nicht mal mehr an die Orte ihrer Kindheit zurückgehen, weil die gar nicht mehr existieren."
Mit der Kamera hielt Alexander Fromm die Veränderungen in einem Eisenhüttenstadt-Blog fest. So wie die Stadt seiner Kindheit mit dem Abriss ganzer Straßenzüge zu verschwinden beginnt, so verschwinden für ihn auch die Erinnerungen der Ostdeutschen in der vereinten Republik:
"Wenn man zum Beispiel heutzutage die Medien liest, dann steht da immer: Ja, die liebe Alice Schwarzer hat halt für unsere Frauen, für die Frauen in Deutschland, sehr viel getan. Im Osten nicht, es ist nicht meine Alice Schwarzer! Oder unser großer Bundespräsident, der kettenrauchende Helmut Schmidt – ach, was war das für ein toller Bundespräsident – ja, mag ja sein, aber nicht für Ostdeutsche! Wir kennen ihn aus dem Fernsehen. Und ich merke, dass das für mich nicht stimmt. Ich fall da einfach irgendwie weg."
Auch wenn Helmut Schmidt Bundeskanzler und nicht Bundespräsident war, bleibt das schale Gefühl, nicht mehr vorzukommen. Seit zehn Jahren lebt Alexander Fromm als Kulturvermittler und Comiczeichner in Berlin. Die Gründungskonferenz der 3.ten Generation Ostdeutschland 2011 verbindet er mit einem großen Aufbruchsgefühl. Nach seiner Hochstimmung setzte bald der Kater ein. Öffentliche Fördermittel und das Geld eines Preises seien in die Taschen nur weniger Aktiver geflossen, die die Initiative immer stärker an sich rissen, fand Alexander Fromm. Mit Bedauern blickt der 41-Jährige auf die in seinen Augen gescheiterte Initiative:
"In der dritten Generation war für mich das Schöne, dass es keine feste Partei war: Es gab kein Parteiprogramm. Es waren Leute mit unterschiedlichen Ansichten. Aber es gab eine Gemeinsamkeit: Wir wollten den Osten voranbringen. Wir wollten nicht als schweigende Mehrheit zu Hause auf dem Sofa sitzen. Wir wollten alte Ungerechtigkeiten beseitigen und einfach mit Klischees brechen, die den Osten betreffen. Immer nur Rechtsradikalismus oder Plattenbauten. Es gibt ja immer diese ganz stereotypen Bilder, die es im Osten gibt, die aber für den Osten als Allgemeinbild missbraucht werden."
Inzwischen hat sich Alexander Fromm von der Initiative 3te Generation Ostdeutschland zurückgezogen. Er hat an einem Buch über alte Apfelsorten in Brandenburg mitgeschrieben und ein "Alexikon" über berühmte Männer verfasst, die wie er Alexander heißen.
Frankfurt an der Oder hat sich gen Polen geöffnet
Ortstermin Frankfurt/Oder. Im DDR-Schulunterricht war die Stadt mit dem Begriff der Oder-Neiße-Friedensgrenze verbunden. Frankfurt/Oder liegt in Brandenburg an der polnischen Grenze und hat rund 60.000 Einwohner. Plattenbausiedlungen prägen das Bild der im Zweiten Weltkrieg stark zerstörten Stadt. Stephanie Maiwald, Jahrgang 1979, aufgewachsen in Hessen und in der Schweiz, zog von Frankfurt am Main nach Frankfurt an der Oder, um hier an der Universität Viadrina zu studieren. Bei ihrem Umzug 1999 galt sie unter ihren Westfreunden als Exotin.
"Für mich war der Osten irgendwie ein Teil Deutschlands und ich bin etwas naiv nach Frankfurt/Oder zum Studieren gegangen und war wirklich erstaunt, wie viele Vorurteile die Menschen haben – also auf beiden Seiten! Zum Abschied hat mir mein Schwimmverein eine Taschenlampe geschenkt, weil es ja angeblich so dunkel sei im Osten, und es hat mich auch niemand in meiner ganzen Studienzeit in Frankfurt/Oder besucht, was ich total traurig fand. Und auf der anderen Seite wollte man in Frankfurt/Oder aber auch nicht, dass man da einfach lebt, dass man sich dort engagiert. Und wir haben dort für einen Kulturklub gearbeitet. Und immer wenn’s Konflikte gab, wurden die runtergebrochen auf: Du Laberwessi oder … (schmunzelt) – also es kam immer wieder auf diese Ost-West-Sache zurück. Und das fand ich schrecklich!"
Obwohl die Maueröffnung während ihrer Studienzeit bereits zehn Jahre zurücklag, waren viele der Jugendlichen, mit denen sie im Kulturklub zusammenarbeitete, noch nie im Westen gewesen. An der Universität Viadrina verstanden sich die westdeutschen Studierenden besser mit ihren polnischen Kommilitonen als mit den ostdeutschen. Vor einem Jahr hat Stephanie Maiwald, die inzwischen als Kulturreferentin an der Schweizer Botschaft in Berlin arbeitet, ihre Studienstadt noch einmal besucht.
"Die Stadt hat einen komplett anderen Eindruck auf mich gemacht – einen viel aufgeräumteren und viel freundlicheren – obwohl’s Dezember war und schlechtes Wetter. Aber die Stimmung war anders und die ganze Stadt - auch mit der Osterweiterung - hat sich einfach gen Polen geöffnet, gegen die Oder. Es gibt jetzt eine Promenade, die es ’99 noch nicht gab, wo wir alle gedacht haben: Eigentlich müsste man hier mal eine Promenade haben, schön am Wasser mit Cafés – und das gibt es jetzt alles!"
Als die Initiative 3te Generation Ost in Berlin entstand, war Stephanie Maiwald unter den neun Gründungsmitgliedern eine der drei Westdeutschen. Ihre Motivation erklärt sie so:
"Dieses Hin und Her und zwei Pässe zu haben, das zeigt eigentlich auch schon, warum ich mich für dieses Thema interessiere. Ich selbst habe auch die Erfahrung, dass Identität nicht Stromlinienförmig ist, sondern dass man mehrere Erfahrungen im Rucksack hat und sich das nicht runterkürzen lässt. Und dass man lernen muss, mit der eigenen Erfahrung und den eigenen Brüchen auch umzugehen."
Aus einer ähnlichen Enttäuschung wie Alexander Fromm hat Stephanie Maiwald der Initiative 3te Generation Ost inzwischen den Rücken gekehrt. Gemeinsam mit anderen gründete sie den Verein Perspektive hoch drei, der vor allem kulturelle Projekte junger Ostdeutscher auf den Weg bringt.
"Ich hatte einfach nur Angst und dachte: Was wird das jetzt?"
Ortstermin Templin. Das mittelalterliche Städtchen liegt in einer Seenlandschaft. Es wird die "Perle der Uckermark" genannt. Hier ist A.B., Jahrgang 1973, aufgewachsen. Ihr Vater, Lehrer für Staatsbürgerkunde und Geschichte, war Schuldirektor und Parteigenosse. Die Wende erlebte die 16-Jährige mit gemischten Gefühlen:
"Ich hatte als allererstes mal Angst. Ich war überhaupt nicht froh. Es hat nichts in mir gegeben, das sich gefreut hat. Ich hatte einfach nur Angst und dachte: Was wird das jetzt? Und ich erinnere mich sehr gut an den Moment, das war ja dann schon am 3.Oktober 90, als die bundesdeutsche Flagge gehisst wurde, da hatte ich wirklich noch mal ein ganz flaues Gefühl im Magen."
Eine Freundin schenkte ihr den ersten Hippierock, der für die Teenagerin der ganze Stolz war. Sie versteckte ihn im Keller und zog ihn nur heimlich an. Den Mauerfall erlebte sie in ihrem ersten Ausbildungsjahr zur Krankenschwester. Erst einen Monat nach Maueröffnung reiste sie mit der Freundin von Brandenburg das erste Mal gen Westen – nach Berlin-Kreuzberg:
"Deshalb war die Fahrt nach Kreuzberg der Schlüsselmoment. Für uns war das total cool – wir suchten ja das alternative Leben. Wir wollten ja nicht mehr wie in der Jugendmode gekleidet gehen. Und wir entdeckten dann auf der Bergmannstraße sofort einen Shop, da konnte man für 25 Mark das Kilo Secondhandklamotten kaufen. Und da haben wir uns eingedeckt. Das haben wir sofort entdeckt. Und dann war klar: Hier will ich leben, das finde ich cool – diese Art von Leben gefällt mir!"
In einem Biografieworkshop der Initiative 3te Generation Ostdeutschland konnte sie das erste Mal in größerer Runde über ihre Geschichte sprechen. Sie fand Zuhörer und Verständnis. Inspiriert durch diese Erfahrung entwickelte sie ein eigenes Konzept, Erinnerungsräume für die in der DDR Geborenen ihrer Generation anzubieten.
"In Biografieworkshops wird ein biografischer Erinnerungsraum geschaffen und es liegt in meinen Augen in der Hand des Workshopanbieters und der Teilnehmer gemeinsam, wie dieser Raum aussieht."
In dem Biografieworkshop, den die heute 41-Jährige zum Beispiel mit Unterstützung der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen veranstaltet, ist auch der Musiker Tilmann Löser aus Leipzig. Nach dem intensiven Wochenende wollen sie vor allem mit ihren Eltern neu über die DDR ins Gespräch kommen. A.B. hätte auch Lust, den Workshop Ost-West-übergreifend anzubieten.
"Mein Eindruck ist aber bisher, dass es in der dritten Generation West dieses Bedürfnis nach einem biografischen Austausch gar nicht gibt, weil es eben diese Ruptur nicht gibt, weil es diese Erfahrung eines Systemwechsels nicht gibt. Und am Ende ist es aber diese Erfahrung, die einen so stark auf einen selber zurückwirft, dass man anfängt, sich Fragen zu stellen."
A.B. hat selbst noch offene Fragen an ihren Vater, für die die Zeit noch nicht reif ist. Sie hat ihr Faible für die spanische Sprache zum Beruf gemacht und lebt als Kulturforscherin mit dem Schwerpunkt Mexiko in Berlin.
Zurück in Leipzig. Die kleine Klezmer-Kapelle von Tilmann Löser trifft sich in ihrem Probenraum in der Nähe der Leipziger Musikhochschule. Zuletzt waren die "Rozhinkes" in Polen unterwegs. Es war eine besondere Konzertreise, die sie in den einst schlesischen Ort Neurode führte. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Familie der Sängerin Karolina Trybala, die manchmal mit ihnen auftritt, aus der Ukraine dorthin vertrieben. Die deutschen Großeltern von Geiger Samuel Seifert mussten 1945 umkehrt ihre Heimat Neurode verlassen. 70 Jahre später musizieren die Enkelkinder zusammen an diesem historischen Ort.
Seit wenigen Monaten ist Tilmann Löser auch Sachsenkoordinator der Initiative 3te Generation Ostdeutschland. Er will auch weiterhin über seine Stadt, seine Vergangenheit, die DDR-Geschichte und die Zukunft sprechen – vielleicht sogar in einem eigenen Salon. Denn eines hat er in den Jahren auf seinen Reisen in die USA, nach Brüssel oder Israel gelernt: Miteinander reden und sich gegenseitig zuhören, macht neugierig und schafft Verständnis.
"Ich habe einfach gemerkt, ich habe Lust, nachdem ich so viel in der Welt war, jetzt auch hier die Welt zu empfangen und denen auch diese Geschichte hier zu erzählen. Diese Erfahrungen haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. War nicht immer ganz einfach. Aber Umwege erhöhen die Ortskenntnis."
*) Anm. d. Red.: Der Name wurde anonymisiert.




