Düsteres Zukunftsbild und provokante Thesen
Der Historiker Michael Stürmer beschreibt in "Welt ohne Weltordnung" die diffusen Konstellationen der Weltpolitik seit Ende des Kalten Krieges. Der ehemalige Berater Helmut Kohls zeichnet ein düsteres Bild für die Zukunft Europas und stellt provokante Thesen auf, an denen sich der Leser reiben kann.
Die Sorgen und Befürchtungen hinsichtlich der weltpolitischen Entwicklung sind seit dem Ende des Ost-West-Konflikts nicht weniger geworden. Im Gegenteil: Die Überschaubarkeit einer bipolaren Konfliktlage ist mit dem Untergang der Sowjetunion verschwunden, und was geblieben ist, sind diffuse Konstellationen, die keine eindeutigen Prognosen zulassen.
Schlimmer noch: Sie lassen nicht bloß den Beobachter ratlos zurück, sondern auch die politischen Akteure immer wieder ins Ungewisse tappen. Michael Stürmer nennt dies eine "Welt ohne Weltordnung". Das Bild, das er von der politischen Zukunft entwirft, ist düster, vor allem für die Europäer, die er durchweg auf dem absteigenden Ast sieht: Gesellschaften, die in Folge von Kindermangel überaltern, die bei der weltpolitischen Durchsetzung ihrer Interessen unentschlossen und zögerlich sind und die schließlich in Folge von Produktionskosten und Lebenshaltung der aufstrebenden Konkurrenz aus Asien hoffnungslos unterlegen sind. Mit Europa ist nicht mehr zu rechnen. Jedenfalls spielt es in Stürmers Antwort auf die Frage, wer die Erde erben werde, keine Rolle.
Michael Stürmer ist, und war schon immer, ein Freund klarer Positionen, und diese vertritt er in markigen Formulierungen. Wo andere zögern und von unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten sprechen, weiß Stürmer genau, was der Fall ist und wohin das führen wird. Das Zutrauen zu seinen von keiner skeptischen Bedenklichkeit angekränkelten Urteilen gewinnt er aus drei Quellen: Von Ausbildung und Profession her ist Stürmer Historiker, der sich zutraut, aus der Betrachtung der Vergangenheit zuverlässige Anhaltspunkte für die Zukunft gewinnen zu können. Sodann war er lange Zeit Chef der Stiftung Wissenschaft und Politik, des einzigen deutschen Think Tanks, der Regierung und Parlament in außenpolitischen Fragen berät, und in dieser Funktion ein enger Vertrauter des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Und schließlich ist Stürmer inzwischen Kolumnist einer großen deutschen Tageszeitung und in dieser Funktion gewohnt, klare Positionen zu beziehen. Zusammengenommen ist dies eine vorzügliche Voraussetzung für das Schreiben von Büchern, an denen der Leser sich reiben und abarbeiten kann.
Provokativer Ausgangspunkt für Stürmers Überlegungen ist die zu Beginn der 1990er Jahre aufgestellte These des amerikanischen Politikwissenschaftlers Fukuyama, wonach mit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes auch die Geschichte zu Ende sei: Es werde zwar weiterhin Ereignisse und Konflikte geben, aber ein die Entwicklung strukturierender Gegensatz der politischen und sozialen Ideen sei nicht mehr vorhanden. Dagegen ruft Stürmer die Geschichte selbst an:
"Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989, in der Mitte Europas Inbegriff des Kalten Krieges, und der Angriff vom 11. September 2001 auf World Trade Center und Pentagon waren Ergebnisse lange zuvor angestoßener Ereignisketten und Entwicklungen. Der Vulkanausbruch ist nicht seine eigene Ursache, sondern Ergebnis tektonischer Verschiebungen in unsichtbaren Tiefen.
Das alles zwingt zu der Frage, seit wann die Geschichte schwanger ging mit ihrem eigenen Gegenteil. Damit verbunden geht der Blick unweigerlich in die Zukunft und will wissen, wie die Welt sich nach den Erschütterungen der vergangenen drei Jahrzehnte neu zusammensetzen wird, und ob überhaupt. Die großen Bewegungskräfte, wer wird sich von ihnen tragen lassen, wer wird sich ihnen entgegenstellen?"
Für Stürmer ist Fukuyamas These vom Ende der Geschichte bloß lächerlich. Immer wieder macht er sich mit Blick auf die dramatischen Entwicklungen der jüngsten Zeit darüber lustig. Aber ein Prinzip oder einen Gegensatz, der Gegenwart und Zukunft eine Struktur geben würde, vermag auch er nicht ausfindig zu machen. Was er beobachtet, ist das Wirken von Kräften und der Aufstieg und Niedergang von Regionen.
Danach werden zwei Fragen die weltpolitische Agenda der nächsten Jahre und Jahrzehnte bestimmen: das Problem der Energieversorgung und die Gefahr einer sich beschleunigenden Proliferation von Nuklearwaffen. Aus beidem können, so Stürmer, Konflikte entstehen, die nicht mehr regional zu begrenzen sind und schließlich die ganze Erde in Brand setzen. Dann hat sich die Frage, wer die Erde erben wird, erledigt. Also geht es darum, nach Mechanismen zu suchen, die das Problem der Energieversorgung regeln und die Gefahr der Nuklearproliferation bannen.
"Öl verändert alles: das Wetter, die Geografie, die Grenzen. Öl ist zu einer just in time-commodity geworden. Was zur Folge hat, dass geringe Verstärkungen der Nachfrage die Preise weit überproportional in die Höhe treiben, umgekehrt geringe Schwächungen der Nachfrage die Preise stürzen lassen. […] Steigende Ölpreise verteilen Gewinn und Verlust neu. Nicht nur in Begriffen des Marktes, der den Ölverkäufern Ströme von Petrodollars zulenkte und weiter zulenkt, sondern auch in Begriffen der Macht. […]
Nirgendwo zeigt sich Globalisierung so schicksalhaft und eingreifend, wie in der kritischen Infrastruktur des Öls – den Pipelines, Raffinerien, Verladeeinrichtungen, Schifffahrtswegen und Engpässen zwischen Erzeugung und Verbrauch. Die Ölindustrie hat ein weltweites Netz gesponnen, das indessen durch Terrorangriffe so verwundbar ist wie lebenswichtig für die Industriewirtschaften des Westens – und die soziale Stabilität der Erzeugerländer."
Es ist bemerkenswert, dass Stürmer in diesem Zusammenhang die USA nur als den größten Energieverbraucher erwähnt, aber deren Rolle als Garant eines nach kapitalistischen Prinzipien funktionierenden Weltmarkts nicht anspricht. Sicherlich bringt ein solcher Markt die beschriebenen Probleme hervor, aber er ist, solange er als Markt funktioniert, auch in der Lage, diese Probleme zu bearbeiten und zu lösen.
Aber werden die Marktmechanismen bei wachsender Nachfrage, schrumpfenden Vorräten und in Folge dessen explosionsartig steigenden Preisen in Kraft bleiben? Oder wird gewaltsame Aneignung in Form von Feldzügen und Kriegen an ihre Stelle treten? Wer sichert die gewaltfreie Verteilung des Öls nach Marktprinzipien gegen Akteure, die sich von einem gewaltsamen Zugriff mehr versprechen?
Es ist keine Frage, dass dies gegenwärtig und in der nächsten Zukunft die USA sind, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Rolle eines Garanten der kapitalistischen Weltordnung übernommen haben. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat dies globale Dimension erlangt.
Aber Stürmer sieht diese globale Ordnungsaufgabe der USA nicht, weil er, historisch geschult an den konkurrentiellen Konstellationen der europäischen Geschichte und theoretisch geprägt durch die Annahmen der realistischen Schule der internationalen Politik, die USA immer nur als Konkurrenten um knappe Güter und größeren Einfluss sieht, aber nicht als denjenigen, der zugleich die Regeln garantieren und durchsetzen muss, nach denen diese Konkurrenz ausgetragen wird.
Das hat zur Folge, dass Stürmer zwar mehrfach vom imperial overstretch spricht, dem die USA ausgesetzt seien, aber nie davon, wie denn das amerikanische empire beschaffen sei, das sich in gefährlicher Form überdehnt habe. Die Folge dessen ist weiterhin, dass Stürmer keine Ordnung in der Welt zu erkennen vermag und vom Fehlen einer jeglichen Weltordnung spricht. So verwendet er zwar immer wieder den Begriff der Asymmetrie, aber es bleibt unklar, was er damit eigentlich meint.
Im Prinzip bezeichnet auch Asymmetrie eine Ordnung, die freilich komplexer und undurchsichtiger ist als eine symmetrische Ordnung. In Stürmers Begriffsgebrauch dagegen ist Asymmetrie ungefähr dasselbe wie Unordnung.
Das neben den Fragen der Energieversorgung zweite große Thema in Stürmers Analyse ist die Verbreitung von Nuklearwaffen und entsprechenden Trägersystemen. Ausführlich rekonstruiert er die Konstellationen des nuklearen Patt zwischen den einstigen Supermächten USA und Sowjetunion. Sie haben sich nach den Grundsätzen der Symmetrie gegenseitig in Schach gehalten.
Das war der Kern der klassischen nuklearen Ordnung, und die weiteren offiziellen Atommächte, Großbritannien, Frankreich und China, bildeten darum einen äußeren Ring, wobei sie eifersüchtig auf die damit verbundenen Privilegien achteten. Einen weiteren Ring stellten die inoffiziellen Atommächte Israel, Indien und Pakistan dar, deren Existenz zwar mit den Atomwaffensperrvertrag nicht vereinbar war, die aber die Ordnung des nuklearen Patt nicht in Frage stellten. Das ist bei dem iranischen Streben nach Atomwaffen anders:
"Der Iran will durch Raketen und nukleare Gefechtsköpfe ein Interventionsverbot für die USA durchsetzen. Im Kriegsfall müssten amerikanische Flugzeugträgergruppen außerhalb der – wachsenden – Reichweite iranischer Fernwaffen operieren. Intervention im Persischen Golf zugunsten der Saudis und der Emirate wäre dann kaum noch möglich. Diese müssten die Amerikaner bitten, ihre Luftwaffen- und Marinebasen zu halten, um durch deren Präsenz jeden Angriff abzuschrecken. Das wiederum würde, quer über alle Staatsgrenzen hinweg, die Islamisten mobilisieren. […] Eine Regierung, die es mit Amerika hält, wäre dann zwischen den Hammer des Terrors und dem Amboss des Iran. Der Sieg, der den Amerikanern im Irak entglitt, wäre dann der Sieg des Iran."
Was Stürmer zeigt, ist das Dilemma der Golfstaaten nach dem Aufstieg des Iran zur Atommacht. Was er hingegen nur am Rande streift, sind die weitreichenden Folgen, die ein gegen die USA gerichtetes faktisches Interventionsverbot für die Weltwirtschaft und die Weltordnung hätte. Es käme einer Suspendierung der USA als globaler Garant der kapitalistischen Weltordnung gleich. Man wird darum davon ausgehen müssen, dass die USA die nukleare Aufrüstung des Iran mit allen Mitteln verhindern werden.
Stürmer ist darin zuzustimmen, dass der Nahe und Mittlere Osten auf unabsehbare Zeit die krisenträchtigste und gefährlichste Ecke der Weltpolitik bleiben wird. Ob sich dagegen der Aufstieg Indiens und insbesondere Chinas in jener unaufhaltsamen Dynamik vollziehen wird, wie Stürmer dies annimmt, lässt sich bezweifeln.
Er hat seiner Prognose nämlich nur die begünstigenden, nicht die blockierenden Faktoren zugrunde gelegt. So ist bei China bloß von der wirtschaftlichen Dynamik, aber kaum von den sozialen Verwerfungen und den Umweltkatastrophen die Rede. Doch das ändert nichts daran, dass Stürmer mit seiner Fähigkeit zu markanten und provozierenden Urteilen über die weltpolitischen Konstellationen in Deutschland ziemlich alleine dasteht. Schon deswegen lohnt sich die Lektüre seines Buches.
Michael Stürmer: Welt ohne Weltordnung. Wer wird die Welt erben?
Murmann Verlag, Hamburg 2006
Schlimmer noch: Sie lassen nicht bloß den Beobachter ratlos zurück, sondern auch die politischen Akteure immer wieder ins Ungewisse tappen. Michael Stürmer nennt dies eine "Welt ohne Weltordnung". Das Bild, das er von der politischen Zukunft entwirft, ist düster, vor allem für die Europäer, die er durchweg auf dem absteigenden Ast sieht: Gesellschaften, die in Folge von Kindermangel überaltern, die bei der weltpolitischen Durchsetzung ihrer Interessen unentschlossen und zögerlich sind und die schließlich in Folge von Produktionskosten und Lebenshaltung der aufstrebenden Konkurrenz aus Asien hoffnungslos unterlegen sind. Mit Europa ist nicht mehr zu rechnen. Jedenfalls spielt es in Stürmers Antwort auf die Frage, wer die Erde erben werde, keine Rolle.
Michael Stürmer ist, und war schon immer, ein Freund klarer Positionen, und diese vertritt er in markigen Formulierungen. Wo andere zögern und von unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten sprechen, weiß Stürmer genau, was der Fall ist und wohin das führen wird. Das Zutrauen zu seinen von keiner skeptischen Bedenklichkeit angekränkelten Urteilen gewinnt er aus drei Quellen: Von Ausbildung und Profession her ist Stürmer Historiker, der sich zutraut, aus der Betrachtung der Vergangenheit zuverlässige Anhaltspunkte für die Zukunft gewinnen zu können. Sodann war er lange Zeit Chef der Stiftung Wissenschaft und Politik, des einzigen deutschen Think Tanks, der Regierung und Parlament in außenpolitischen Fragen berät, und in dieser Funktion ein enger Vertrauter des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Und schließlich ist Stürmer inzwischen Kolumnist einer großen deutschen Tageszeitung und in dieser Funktion gewohnt, klare Positionen zu beziehen. Zusammengenommen ist dies eine vorzügliche Voraussetzung für das Schreiben von Büchern, an denen der Leser sich reiben und abarbeiten kann.
Provokativer Ausgangspunkt für Stürmers Überlegungen ist die zu Beginn der 1990er Jahre aufgestellte These des amerikanischen Politikwissenschaftlers Fukuyama, wonach mit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes auch die Geschichte zu Ende sei: Es werde zwar weiterhin Ereignisse und Konflikte geben, aber ein die Entwicklung strukturierender Gegensatz der politischen und sozialen Ideen sei nicht mehr vorhanden. Dagegen ruft Stürmer die Geschichte selbst an:
"Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989, in der Mitte Europas Inbegriff des Kalten Krieges, und der Angriff vom 11. September 2001 auf World Trade Center und Pentagon waren Ergebnisse lange zuvor angestoßener Ereignisketten und Entwicklungen. Der Vulkanausbruch ist nicht seine eigene Ursache, sondern Ergebnis tektonischer Verschiebungen in unsichtbaren Tiefen.
Das alles zwingt zu der Frage, seit wann die Geschichte schwanger ging mit ihrem eigenen Gegenteil. Damit verbunden geht der Blick unweigerlich in die Zukunft und will wissen, wie die Welt sich nach den Erschütterungen der vergangenen drei Jahrzehnte neu zusammensetzen wird, und ob überhaupt. Die großen Bewegungskräfte, wer wird sich von ihnen tragen lassen, wer wird sich ihnen entgegenstellen?"
Für Stürmer ist Fukuyamas These vom Ende der Geschichte bloß lächerlich. Immer wieder macht er sich mit Blick auf die dramatischen Entwicklungen der jüngsten Zeit darüber lustig. Aber ein Prinzip oder einen Gegensatz, der Gegenwart und Zukunft eine Struktur geben würde, vermag auch er nicht ausfindig zu machen. Was er beobachtet, ist das Wirken von Kräften und der Aufstieg und Niedergang von Regionen.
Danach werden zwei Fragen die weltpolitische Agenda der nächsten Jahre und Jahrzehnte bestimmen: das Problem der Energieversorgung und die Gefahr einer sich beschleunigenden Proliferation von Nuklearwaffen. Aus beidem können, so Stürmer, Konflikte entstehen, die nicht mehr regional zu begrenzen sind und schließlich die ganze Erde in Brand setzen. Dann hat sich die Frage, wer die Erde erben wird, erledigt. Also geht es darum, nach Mechanismen zu suchen, die das Problem der Energieversorgung regeln und die Gefahr der Nuklearproliferation bannen.
"Öl verändert alles: das Wetter, die Geografie, die Grenzen. Öl ist zu einer just in time-commodity geworden. Was zur Folge hat, dass geringe Verstärkungen der Nachfrage die Preise weit überproportional in die Höhe treiben, umgekehrt geringe Schwächungen der Nachfrage die Preise stürzen lassen. […] Steigende Ölpreise verteilen Gewinn und Verlust neu. Nicht nur in Begriffen des Marktes, der den Ölverkäufern Ströme von Petrodollars zulenkte und weiter zulenkt, sondern auch in Begriffen der Macht. […]
Nirgendwo zeigt sich Globalisierung so schicksalhaft und eingreifend, wie in der kritischen Infrastruktur des Öls – den Pipelines, Raffinerien, Verladeeinrichtungen, Schifffahrtswegen und Engpässen zwischen Erzeugung und Verbrauch. Die Ölindustrie hat ein weltweites Netz gesponnen, das indessen durch Terrorangriffe so verwundbar ist wie lebenswichtig für die Industriewirtschaften des Westens – und die soziale Stabilität der Erzeugerländer."
Es ist bemerkenswert, dass Stürmer in diesem Zusammenhang die USA nur als den größten Energieverbraucher erwähnt, aber deren Rolle als Garant eines nach kapitalistischen Prinzipien funktionierenden Weltmarkts nicht anspricht. Sicherlich bringt ein solcher Markt die beschriebenen Probleme hervor, aber er ist, solange er als Markt funktioniert, auch in der Lage, diese Probleme zu bearbeiten und zu lösen.
Aber werden die Marktmechanismen bei wachsender Nachfrage, schrumpfenden Vorräten und in Folge dessen explosionsartig steigenden Preisen in Kraft bleiben? Oder wird gewaltsame Aneignung in Form von Feldzügen und Kriegen an ihre Stelle treten? Wer sichert die gewaltfreie Verteilung des Öls nach Marktprinzipien gegen Akteure, die sich von einem gewaltsamen Zugriff mehr versprechen?
Es ist keine Frage, dass dies gegenwärtig und in der nächsten Zukunft die USA sind, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Rolle eines Garanten der kapitalistischen Weltordnung übernommen haben. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat dies globale Dimension erlangt.
Aber Stürmer sieht diese globale Ordnungsaufgabe der USA nicht, weil er, historisch geschult an den konkurrentiellen Konstellationen der europäischen Geschichte und theoretisch geprägt durch die Annahmen der realistischen Schule der internationalen Politik, die USA immer nur als Konkurrenten um knappe Güter und größeren Einfluss sieht, aber nicht als denjenigen, der zugleich die Regeln garantieren und durchsetzen muss, nach denen diese Konkurrenz ausgetragen wird.
Das hat zur Folge, dass Stürmer zwar mehrfach vom imperial overstretch spricht, dem die USA ausgesetzt seien, aber nie davon, wie denn das amerikanische empire beschaffen sei, das sich in gefährlicher Form überdehnt habe. Die Folge dessen ist weiterhin, dass Stürmer keine Ordnung in der Welt zu erkennen vermag und vom Fehlen einer jeglichen Weltordnung spricht. So verwendet er zwar immer wieder den Begriff der Asymmetrie, aber es bleibt unklar, was er damit eigentlich meint.
Im Prinzip bezeichnet auch Asymmetrie eine Ordnung, die freilich komplexer und undurchsichtiger ist als eine symmetrische Ordnung. In Stürmers Begriffsgebrauch dagegen ist Asymmetrie ungefähr dasselbe wie Unordnung.
Das neben den Fragen der Energieversorgung zweite große Thema in Stürmers Analyse ist die Verbreitung von Nuklearwaffen und entsprechenden Trägersystemen. Ausführlich rekonstruiert er die Konstellationen des nuklearen Patt zwischen den einstigen Supermächten USA und Sowjetunion. Sie haben sich nach den Grundsätzen der Symmetrie gegenseitig in Schach gehalten.
Das war der Kern der klassischen nuklearen Ordnung, und die weiteren offiziellen Atommächte, Großbritannien, Frankreich und China, bildeten darum einen äußeren Ring, wobei sie eifersüchtig auf die damit verbundenen Privilegien achteten. Einen weiteren Ring stellten die inoffiziellen Atommächte Israel, Indien und Pakistan dar, deren Existenz zwar mit den Atomwaffensperrvertrag nicht vereinbar war, die aber die Ordnung des nuklearen Patt nicht in Frage stellten. Das ist bei dem iranischen Streben nach Atomwaffen anders:
"Der Iran will durch Raketen und nukleare Gefechtsköpfe ein Interventionsverbot für die USA durchsetzen. Im Kriegsfall müssten amerikanische Flugzeugträgergruppen außerhalb der – wachsenden – Reichweite iranischer Fernwaffen operieren. Intervention im Persischen Golf zugunsten der Saudis und der Emirate wäre dann kaum noch möglich. Diese müssten die Amerikaner bitten, ihre Luftwaffen- und Marinebasen zu halten, um durch deren Präsenz jeden Angriff abzuschrecken. Das wiederum würde, quer über alle Staatsgrenzen hinweg, die Islamisten mobilisieren. […] Eine Regierung, die es mit Amerika hält, wäre dann zwischen den Hammer des Terrors und dem Amboss des Iran. Der Sieg, der den Amerikanern im Irak entglitt, wäre dann der Sieg des Iran."
Was Stürmer zeigt, ist das Dilemma der Golfstaaten nach dem Aufstieg des Iran zur Atommacht. Was er hingegen nur am Rande streift, sind die weitreichenden Folgen, die ein gegen die USA gerichtetes faktisches Interventionsverbot für die Weltwirtschaft und die Weltordnung hätte. Es käme einer Suspendierung der USA als globaler Garant der kapitalistischen Weltordnung gleich. Man wird darum davon ausgehen müssen, dass die USA die nukleare Aufrüstung des Iran mit allen Mitteln verhindern werden.
Stürmer ist darin zuzustimmen, dass der Nahe und Mittlere Osten auf unabsehbare Zeit die krisenträchtigste und gefährlichste Ecke der Weltpolitik bleiben wird. Ob sich dagegen der Aufstieg Indiens und insbesondere Chinas in jener unaufhaltsamen Dynamik vollziehen wird, wie Stürmer dies annimmt, lässt sich bezweifeln.
Er hat seiner Prognose nämlich nur die begünstigenden, nicht die blockierenden Faktoren zugrunde gelegt. So ist bei China bloß von der wirtschaftlichen Dynamik, aber kaum von den sozialen Verwerfungen und den Umweltkatastrophen die Rede. Doch das ändert nichts daran, dass Stürmer mit seiner Fähigkeit zu markanten und provozierenden Urteilen über die weltpolitischen Konstellationen in Deutschland ziemlich alleine dasteht. Schon deswegen lohnt sich die Lektüre seines Buches.
Michael Stürmer: Welt ohne Weltordnung. Wer wird die Welt erben?
Murmann Verlag, Hamburg 2006
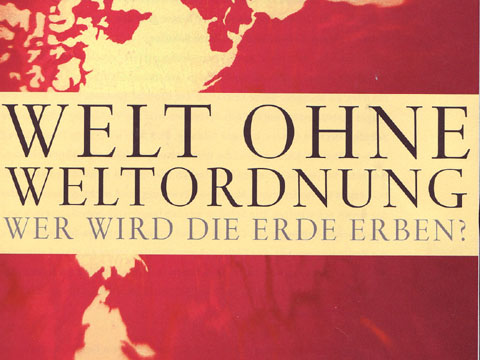
Coverausschnitt: "Welt und Weltordnung"© Murmann Verlag