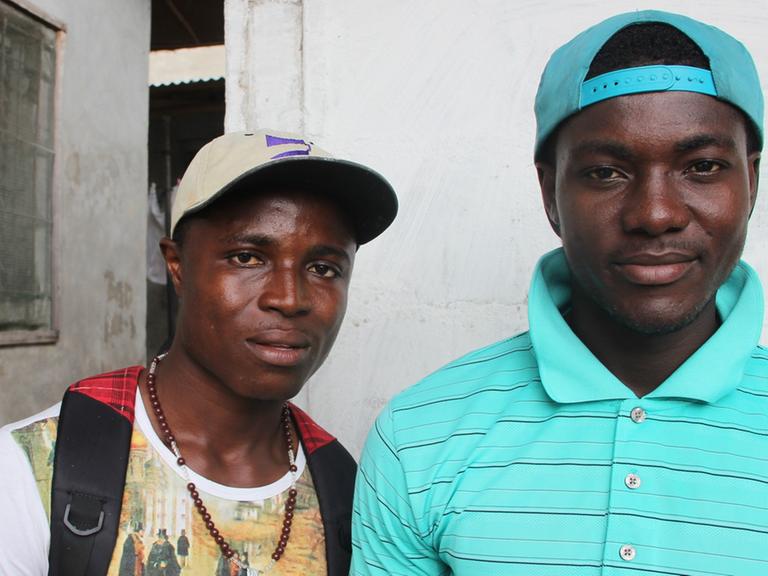"Man lässt keine Kranken allein"

Regierungen und auch die internationale Helfer müssten sich auf Diskussionen über Rituale und Traditionen einlassen. Dies sei in der Regel nur über Vermittler möglich, unterstrich Schroven, die zuletzt vor allem in Guinea geforscht hat. Um Vertrauen zu schaffen, brauche es Mittelsleute.
Dieter Kassel: Es gibt mutige Menschen, die gehen von Europa aus, von Nordamerika, Australien, aus vielen anderen Regionen nach Westafrika, die am stärksten von der Ebola-Epidemie betroffenen Gebiete und wollen dort helfen. Es sind Ärzte, Krankenpfleger, Angehörige von Hilfsorganisationen aller Art, manchmal Angehörige des Militärs. Die meisten von ihnen waren allerdings vorher noch nie in diesem Teil Afrikas – auf Englisch oder Französisch versuchen Sie deshalb dort zu erklären, wie Ebola sich verbreitet, wie man infizierte Menschen behandelt und wie man sich vor Ansteckung schützen kann. Nicht selten scheitern sie damit. Die Ethnologin Anita Schroven war schon oft in Liberia, Sierra Leone, und Guinea – das ist quasi eines ihrer Hauptforschungsgebiete. Sie hat dort Feldforschung betrieben, ist aber im Moment wieder in Berlin und kann deshalb jetzt bei mir im Studio sein. Schönen guten Morgen, Frau Schroven!
Anita Schroven: Guten Morgen!
Kassel: Fangen wir doch mal ganz einfach an – wenn ich jetzt gesagt habe, Französisch in Guinea, Englisch in den beiden anderen Ländern, das sind die Amtssprachen – versteht nicht jeder. Wäre das Problem schon gelöst, wenn man sich quasi einen Zettel drucken lässt, in dem all die Anweisungen in möglichst vielen Landessprachen stehen?
Niedrige Alphabetisierungsrate als Hindernis
Schroven: Es wäre vielleicht hilfreich, wenn wir annehmen können, dass die Leute das lesen können. Das ist eine Herausforderung, dass die Alphabetisierungsrate in der formalen Sprache, in der formalen Amtssprache nicht sehr hoch ist. Die nächste Frage wäre die Verbreitung. Die Infrastruktur in diesen Ländern ist sehr schwach, das heißt auch, die Verbreitung dieser Zettel wäre schwierig. Der nächste Punkt wäre aber auch das Vertrauen, dass man der Herkunft dieser Informationen entgegenbringt. Das sind also Herausforderungen, die man auch bewältigen muss und an denen auch gearbeitet wird.
Kassel: Aber wie kann man zum Beispiel dieses Vertrauen – Vertrauen klingt immer nach Zeit, und die Zeit hat man ja im Moment nicht im Kampf gegen diese Seuche –, wie kann man denn dieses Vertrauen aufbauen?
Schroven: Die Zeit hat man leider nicht, weil man sehr schnell handeln muss. Aufgrund der Erfahrungen, die die Bevölkerung mit den Regierungen in der Region gemacht hat, aber auch zum Teil mit Hilfsorganisationen der internationalen Gemeinschaft, ist das Vertrauen da nicht unbedingt vorhanden. Das heißt, was man benutzen könnte, um Vertrauen zu schaffen, sind Mittelsleute, und das sind die regionalen oder auch lokalen Würdenträger, Amtsinhaber von ob nun kirchlichen oder anderen religiösen Posten. Die Gemeindeältesten zum Beispiel, die lokalen Nichtregierungsorganisationen, die wirklich sehr lokal sind, in der Gemeinschaft vor Ort verwurzelt sind – diese Leute kann man als Mittler benutzen.
Kassel: Sie haben ja schon als eine Erklärung für Probleme, für Zwischenfälle genannt diesen Mangel an Vertrauen. Aber machen wir es mal am konkreten Beispiel: Es hat ja solche Fälle gegeben, in Sierra Leone unter anderem, wo Menschen, die schon im Krankenhaus waren oder zumindest in einer Art Krankenstation, die aber noch nicht wieder gesund waren, einfach gegangen sind. Was steckt aus Ihrer Sicht dahinter? Ist das nur dieses mangelnde Vertrauen?
Mangelndes Vertrauen in Helfer
Schroven: Es ist sicherlich ein Stück mangelndes Vertrauen, aber auch eine Art von Hilflosigkeit dem gegenüber, was da passiert. Es wird nämlich mit den Patienten, mit den Patientinnen nicht unbedingt viel kommuniziert. Es kann zum Teil nicht kommuniziert werden, denn wenn Sie als Helfer hinter so einer Maske stehen und in einem Ganzkörperkostüm, können Sie nicht viel kommunizieren. Es bleibt auch nicht viel Zeit für jeden einzelnen Patienten, um da Gespräche einzugehen. Des Weiteren fehlt häufig die Sprachkompetenz. Ein nächstes großes Problem ist aber auch die Infrastruktur. Das heißt, die Leute bekommen nicht unbedingt die Fürsorge auf der ganz grundsätzlichen Basis von Wasser und Essen, Nahrung, die sie brauchen. Das heißt, da fehlt auch einfach die Kapazität in manchen dieser Versorgungszentren, die Patienten gut zu versorgen.
Kassel: Wie wird denn überhaupt, vielleicht gerade auch außerhalb der großen Städte, mit dieser Krankheit umgegangen in der Bevölkerung? Reden wir mal zunächst nicht über die Infektionsgefahr, aber wenn da gesehen wird, in meiner Umgebung werden Leute krank und ein Teil davon stirbt sogar – wie wird damit umgegangen?
Schroven: Krankheit an sich und auch ansteckende Krankheiten sind ja nicht neu in dieser Region. Das heißt, es wird versucht, mit den lokalen Mitteln, die man kennt, dagegen vorzugehen, und das beinhaltet auch zum Teil eine Distanzierung, eine Anpassung der Hygienemaßnahmen, so wie man sie in den moderaten Kontexten, die vorhanden sind, kennt. Gleichzeitig aber auch natürlich die Versorgung mit besonders guter Nahrung, besonders gutem Wasser. Traditionelle, sogenannte traditionelle Heiler werden hinzugezogen, die versuchen, mit Kräutern, Tinkturen oder auch lokal auf dem Markt vorhandenen Medikamenten diese Krankheit, dem Kranken eben zu helfen. Als Konsequenz dessen müssen wir aber auch sehen, dass der Umgang mit den meisten Kranken so ist, dass man sich ihnen annähert, das heißt, körperlich auch annähert. Der Kontakt, d.h. die Hände zu berühren oder den Kopf zu berühren, Füße zu berühren, ist sehr wichtig. Man lässt eigentlich einen Kranken nicht allein.
Kassel: Das heißt aber auch, man muss sozusagen vermitteln, dass das nicht herzlos ist, nicht kalt, wenn man Leuten sagt, ihr dürft den nicht mehr berühren?
Schroven: Das müsste man vermitteln, dass die Gefahr eben genau darin besteht, den Kranken zu berühren, aber genau das ist eine Herausforderung, weil es aus emotionalen und psychologischen Gründen grausam erscheint, den Kranken allein zu lassen.
Kassel: Aber könnte man nicht – ich habe jetzt den Eindruck, man muss gar nicht bei Null anfangen. Sie haben schon klar gemacht, ein Grundverständnis dafür, dass es eine Krankheit ist, die sich irgendwie verbreitet, ist ja da. Sie haben ja von diesen Versuchen, besonders sauberes Wasser einzusetzen und Ähnliches, gesprochen. Das heißt, man kann – es gibt diese moderne Zeitgeistformulierung – die Leute ja irgendwo abholen, wo sie sind und sagen, ihr habt im Prinzip recht, aber das Ganze muss noch weitergehen.
Sozialen Kontext im Auge behalten
Schroven: Genau. Das könnte man tun. Dazu braucht es aber wiederum Zeit, Empathie und auch die Energie der Helfer, die ja zum Teil wirklich über das Maß schon strapaziert sind, sich auf diese Diskussionen einzulassen, die Leute eben da abzuholen, wo sie sind, denn diese Diskussion ist möglich, wenn man mit einem Vermittler zum Beispiel kommt und diese Informationen in kleinen Paketen, die wirklich auch verdaulich sind, rüberbringt und dann auch diskutiert und auch fragt, wie können wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir eine Variante der Pflege finden, die für alle akzeptabel ist. Das heißt, die Hygiene und die virologischen, epidemiologischen Standards, die notwendig sind, berücksichtigt, aber auch den sozialen Kontext vor Ort nicht aus den Augen lässt.
Kassel: 5.000 Menschen sind schon gestorben an dieser Krankheit, und in den Kulturen der Region gehört auch das Berühren von Leichen eigentlich mit zum Abschied von den Toten. Das ist ja zum Teil eine Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende alte Tradition. Kann man auch darüber diskutieren? Kann man quasi aus medizinischer Notwendigkeit diese Tradition beenden?
Schroven: Man muss sie, glaube ich, nicht beenden, denn viele Traditionen, das möchte ich als Hintergrund noch sagen, sind gar nicht so alt beziehungsweise stehen ja auch unter stetiger Veränderung. Das kann man ganz gut beobachten, dass heutzutage die sogenannten traditionellen Rituale ganz anders aussehen als vor hundert Jahren, die uns dokumentiert wurden von Reisenden oder frühen Forschern zum Beispiel. Oder die auch in der Erinnerung der Leute noch vorhanden sind, gerade der alten Leute. Also, man kann da sehr viel diskutieren, aber, wie gesagt, es setzt voraus, dass man die Information, die man bekommt, ernst nimmt, dass man den Leuten gegenüber auch respektvoll handelt. Und dann kann man Anpassungen im Dialog durchaus erreichen. Es gibt auch gute Beispiele von Fällen, in denen sowohl Krankheit, also Betreuung der Kranken, als auch Beerdigungen im lokalen Kontext angepasst werden konnten. Aber das sind gerade nicht die Gegenden, wo wir die höchsten Ansteckungsraten und die höchsten Todesfallzahlen finden, sondern das sind meistens eher ländliche Gebiete, in denen die Infektionsraten nicht so hoch sind, wo die Kapazitäten der Teams eben höher sind.
Kassel: Es gibt viele Probleme im Zusammenhang mit der Ebola-Epidemie in Westafrika. Medizinische, wirtschaftliche, logistische, aber eben auch Probleme der interkulturellen Kommunikation. Anita Schroven hat aber bei uns gesagt, dass auch die durchaus lösbar sind. Frau Schroven, ich danke Ihnen sehr für den Besuch!
Schroven: Herzlichen Dank!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.