Anne Applebaum: Der Eiserne Vorhang – Die Unterdrückung Osteuropas 1944–1956
aus dem Englischen von Martin Richter
Verlag Siedler München, 2013
640 Seiten, € 29,99, auch als E-Book erhältlich
Reflexion über den Totalitarismus
Das Konzept "Totalitarismus" sei reif für eine Renaissance, meint Anne Applebaum, Historikerin und ehemalige Warschau-Korrespondentin des "Economist". Sie präsentiert einen informativen Überblick über die frühe Nachkriegsgeschichte der zentralen Ostblockstaaten.
"Wer hat den Weißmeer-Kanal gebaut?
– Die, die politische Witze erzählt haben!
Und wer hat den Wolga-Don-Kanal gebaut?
– Die, die zugehört haben."
– Die, die politische Witze erzählt haben!
Und wer hat den Wolga-Don-Kanal gebaut?
– Die, die zugehört haben."
Dieser Witz, der wahrscheinlich aus der Sowjetunion stammt, ist für Anne Applebaum ein Beleg der speziellen Form von passiver Opposition in den Ländern des ehemaligen Ostblocks. Es habe keine aktiven Widerständigen gegeben, sondern passive Gegner, "widerwillige Kollaborateure", die nach einem Ventil für ihren Unmut suchten:
"Viele schämten sich für das, was sie tun mussten, um ihre Arbeit zu behalten, ihre Familie zu schützen und nicht ins Gefängnis zu kommen. Andere waren von der Heuchelei des öffentlichen Lebens angewidert und von den Friedensdemonstrationen und Paraden gelangweilt. (…) Sie fühlten sich von den langweiligen Versammlungen und leeren Parolen verdummt und hatten kein Interesse an den Reden des Parteichefs und den endlosen Vorträgen. Da sie offen nichts dagegen tun konnten, rächten sie sich hinter dem Rücken der Partei."
Vorgeschichte erhält hohes Gewicht
Im ersten Teil des Buches rekapituliert Applebaum die Vorgeschichte. Die Kriegszeit und die Expansion des Deutschen Reiches nach Osten, die Kapitulation und als Folge davon den Aufbau des sowjetisch beherrschten Osteuropa.
"Insgesamt verlor rund ein Fünftel der polnischen Bevölkerung ihr Leben. Jugoslawien verlor 1,5 Millionen Menschen oder 10 Prozent der Bevölkerung. Auch 6,2 Prozent der ungarischen und 3,9 Prozent der tschechoslowakischen Vorkriegsbevölkerung starben. (…) Es wäre 1945 schwierig gewesen, in Osteuropa eine Familie zu finden, die niemanden verloren hatte."
Natürlich ist es wichtig, ausführlich darzustellen, welche dramatischen Zerstörungen und Verluste die Länder, die später im Westen "Ostblock" heißen sollten, erlitten haben. In Applebaums Buch jedoch nimmt die Vorgeschichte mehr als die Hälfte des Raums ein. Diese Gewichtung wirkt insgesamt nicht stimmig.
Zentral: Begriff des Totalitarismus
Theoretisch bezieht sich die Autorin auf den Begriff des "Totalitarismus", den sie für eine nützliche und notwendige Kategorie hält, um das Osteuropa der Nachkriegszeit zu beschreiben. Das Konzept "Totalitarismus" sei reif für eine Renaissance.
"Obwohl aber die Idee einer 'totalen Kontrolle' heute grotesk, lächerlich, übertrieben oder töricht erscheinen mag und obwohl das Wort selbst vielleicht seine Fähigkeit zu schockieren verloren hat, muss man in Erinnerung behalten, dass 'Totalitarismus' mehr ist, als eine vage definierte Beleidigung. Es hat wirklich Regime gegeben, die eine totale Kontrolle anstrebten. Wenn wir sie verstehen wollen – wenn wir die Geschichte des 20. Jahrhunderts verstehen wollen –, müssen wir verstehen, wie der Totalitarismus funktionierte, in der Theorie wie in der Praxis."
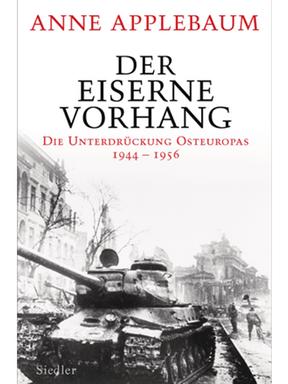
Buchcover: "Der Eiserne Vorhang" von Anne Applebaum© Siedler Verlag
Dieses Versprechen löst Anne Applebaum aber an keiner Stelle ein. Von "Theorie" ist in der Folge keine Rede mehr. Sie skizziert allenfalls die Entwicklung unterschiedlicher "totalitaristischer" Regime, wobei deutlich wird, wie verschieden diese trotz zahlreicher Ähnlichkeiten waren.
Ob der Begriff des "Totalitarismus" heute noch tauglich ist, erörtert die Autorin nicht. Hannah Arendt verstand darunter Diktaturen, die sich wie Nazi-Deutschland und Stalins Sowjetunion des Systems der Konzentrations- und Vernichtungslager beziehungsweise des Gulags bedienten, um ihre Terrorherrschaft zu festigen. Doch auch wenn die Satellitenstaaten der Sowjetunion Polizeistaaten waren, so verfügten sie jedoch nicht über eine flächendeckende Lagerstruktur.
Zwar existierten in Ostdeutschland die Lager Buchenwald und Sachsenhausen nach dem Krieg als sogenannte "Speziallager" zunächst weiter. Mit der Gründung der DDR wurden sie jedoch aufgelöst.
Historische Vergleiche der ehemaligen Ostblock-Staaten
Besser gelingen der Autorin die historischen Vergleiche zwischen den einzelnen Ländern. Beispielsweise verhielt sich der Primas der katholischen Bischöfe Polens anders als jener Ungarns – und doch wurden beide Kardinäle, der Erzbischof von Warschau wie sein Amtsbruder in Budapest zu Symbolgestalten.
"Wyszýnskis nachgiebigere Taktik hatte den Vorteil der Flexibilität. Er versuchte die Konfrontation zu vermeiden, Priester aus dem Gefängnis herauszuhalten und so viele kirchliche Einrichtungen wie möglich offen zu halten. Seine Position hatte nicht dieselbe moralische Klarheit wie die Mindszentys, nicht dieselbe inspirierende Qualität, (…) Aber sein kompromissbereiter Stil erklärt vielleicht, warum Wyszyński erst relativ spät verhaftet wurde, 1953 statt 1949; warum er nie vor Gericht gestellt wurde, und warum die polnische Kirche den Stalinismus relativ intakt überstand, zumindest im Vergleich mit der ungarischen, tschechoslowakischen und ostdeutschen."
"Wyszýnskis nachgiebigere Taktik hatte den Vorteil der Flexibilität. Er versuchte die Konfrontation zu vermeiden, Priester aus dem Gefängnis herauszuhalten und so viele kirchliche Einrichtungen wie möglich offen zu halten. Seine Position hatte nicht dieselbe moralische Klarheit wie die Mindszentys, nicht dieselbe inspirierende Qualität, (…) Aber sein kompromissbereiter Stil erklärt vielleicht, warum Wyszyński erst relativ spät verhaftet wurde, 1953 statt 1949; warum er nie vor Gericht gestellt wurde, und warum die polnische Kirche den Stalinismus relativ intakt überstand, zumindest im Vergleich mit der ungarischen, tschechoslowakischen und ostdeutschen."
Ausführlich – wenn auch mit etlichen Fehlern im Detail - geht Anne Applebaum in ihrem Buch über die Unterdrückung Osteuropas auf die Rolle der Schriftsteller, Bildenden Künstler und Architekten ein. Viele waren aus dem Exil zurückgekehrt und viele wandelten sich zu "sozialistischen Realisten", während sie in der Heimat Arbeit und Anerkennung suchten.
"Nach und nach hatten die osteuropäischen Länder immer weniger gemeinsam. In den achtziger Jahren hatte die DDR den größten Polizeistaat, Polen die meisten Kirchgänger, Rumänien die dramatischste Lebensmittelknappheit, Ungarn den höchsten Lebensstandard und Jugoslawien das entspannteste Verhältnis zum Westen."
Wie lassen sich solche Unterschiede erklären? Das wäre eine interessante Frage gewesen, der Anne Applebaum jedoch nicht nachgeht. Trotz aller methodischen und theoretischen Mängel gibt sie jedoch einen informativen und vor allem leicht zu lesenden Überblick über die frühe Nachkriegsgeschichte der zentralen Ostblockstaaten.




