Ein Denker in freier Luft
Wortgewaltig und faszinierend: Als Buchautor und Kolumnist zählte Sebastian Haffner zu den populärsten und streitbarsten Zeithistorikern Deutschlands. Jürgen Peter Schmied widmet ihm nun eine faktenreiche Biografie.
Er war ein großer, zu seiner Zeit faszinierender Kolumnist, der aus der Geschichte der alten Bundesrepublik kaum wegzudenken ist. Mit ihm messen konnte sich allenfalls der frühe Rudolf Augstein, als er unter seinem Pseudonym Jens Daniel gegen Adenauer und Strauß zu Felde zog. Aber Augsteins Meinungen blieben eher konstant, indessen es im Rückblick viele und sehr verschiedene Sebastian Haffners gab, die nacheinander in Springers konservativer "Welt", im linksliberalen "Stern" und gelegentlich auch in der Linkaußenpostille "Konkret" sich wortgewaltig zum Zeitgeschehen meldeten.
Es gab einen Haffner, der Deutschland in acht Teilstaaten zu zerlegen empfahl und einen, der für die deutsche Einheit plädierte; einen, der die Wiederaufrüstung und Adenauers Politik der Stärke verfocht und einen, der ein neutrales Gesamtdeutschland wollte; einen, der Walter Ulbricht für den ersten deutschen Realpolitiker seit Bismarck hielt, mit dem der Westen Kompromisse suchen müsse, aber auch einen, der ihn als Gauleiter von Ostdeutschland verächtlich machte und seine DDR mit dem Dritten Reich der Nazis verglich.
Haffners Journalismus war durch und durch englisch geprägt, nichts fürchtete er so sehr wie die im traditionellen deutschen Leitartikel gepflegte Langeweile. Als hochbegabt, aber "wild", also extrem unberechenbar, hatte schon das britische Foreign-Office den Deutschen Emigranten eingeschätzt, der sich mit David Astor anfreundete und in dessen renommierter Wochenzeitung "Observer" bald die außenpolitischen Weichen stellte.
"Haffners Analysen beruhten häufig auf skeptisch-pessimistischen Einschätzungen, aus denen er ebenso drastische wie spektakuläre Schlussfolgerungen zu ziehen liebte. Sein Leser zu sein, war eine aufregende Angelegenheit. Schon (die) Artikelüberschriften wie 'Caution that Kills’ – Vorsicht tötet – oder 'Some Truths are Dangerous’ - gefährliche Wahrheiten - ...verhießen Unheil und Gefahr, und tatsächlich lauerte an der nächsten Ecke des Weltgeschehens meistens ein Krieg, mindestens aber eine bedrohliche Krise, die nur mit heldenhaftem Mut oder äußerster Entschlossenheit verhindert beziehungsweise entschärft werden konnten…"
So urteilt sein Biograf Jürgen Peter Schmied über den Engländer Haffner im Kalten Krieg. Die vielen Kurven und oft abrupten Meinungsänderungen des Kolumnisten zeichnet er getreulich nach - Rochaden oder Kehrtwendungen, die sich meist als Reaktionen auf eine veränderte Lage erklären - und immer auch aus Haffners Lust an der Provokation und an dem, was man im Angelsächsischen 'selling-promotion', also Verkaufsförderung nennt.
Aber so wechselnd, ja so schillernd seine Meinungen im Rückblick auch waren, gab es doch immer nur den einen Haffner: den thesenfreudigen, brillant formulierenden Schreiber, Erzähler oder Kommentator, der seinen Stoff beherrschte und zugleich über das Können der Vereinfachung, über die Kraft des Zuspitzens verfügte. Wie ein Staatsanwalt breitete der promovierte Volljurist seine Causa aus, alles weglassend, was gegen seine Anklage, jedes Argument bemühend, was für sie sprechen könnte. Und oft genug folgte der Leser als Richter dem Plädoyer des Kolumnisten, das meist im Ton eines ernüchterten Pessimisten vorgebracht wurde.
Würze und Wirkung vom Haffners Kommentaren beruhten auf der Kunst der Verkürzung, und wenn er seine Kolumnen-Logik als gesunden Menschenverstand umschrieb, waren oft auch jene Leser gefangen, die der Sache, die er empfahl, von Hause aus kritisch gegenüberstanden. Gelegentlich kleidete er sich wie ein konservativer Dandy, und seine hohe, näselnde Stimme in Hörfunk oder Fernsehen machte ihn selbst für Blinde unverwechselbar.
Der sich Sebastian Haffner nannte, hieß eigentlich Raimund Pretzel, war Sohn eines Volksschullehrers aus Pommern, der es in Berlin bis zum preußischen Ministerialrat gebracht hatte und erzielte seinen ersten großen Erfolg im englischen Exil. Er emigrierte 1938, weil er, in eine Deutsche jüdischer Herkunft verliebt, nach nationalsozialistischen Wahnbegriffen in Rassenschande lebte und sie ohne Komplikationen nur im Ausland heiraten konnte.
Seinen ersten Bucherfolg erzielte Haffner 1939 in England, als er den Versuch unternahm, den Briten die ihnen völlig fremde Binnenwelt des Dritten Reiches zu erklären. Der Titel 'Germany: Jekyll and Hyde', sollte eine fast schizophrene Gespaltenheit der Deutschen suggerieren. Seine Landsleute, die er darin beschrieb, waren ...
"...weltfremd und träumerisch und unpolitisch, ja viele seiner Landsleute würden das politische Geschäft sogar mit grundsätzlicher Abneigung betrachten,...was sie seltsamerweise nicht daran hindere, zu einzelnen Staatsmännern hochgradig emotionale Bindungen zu entwickeln. Nicht selten ähnelten diese Beziehungen jenem obskuren Verhältnis, das 'primitive Völker ihren Göttern gegenüber haben, welche sie schützen, ihnen den Sieg bescheren und gleichzeitig alle Schuld auf sich nehmen".
Jürgen Peter Schmied folgert zu Recht, dass Politikervergötterung und Untertanengeist für Haffner der Schlüssel zum Verständnis dafür waren, dass so viele Deutsche Hitler Gefolgschaft leisteten. Seine umfassende, gut geschriebenen Biografie stützt sich nicht nur auf eine viele Jahre währende Beschäftigung mit Haffner und auf Archive und Quellen, die jedermann zugänglich sind, sondern auch auf Haffners Privatarchiv, das ihm seine Kinder zugänglich machten.
So fehlt es nicht an neuen Fakten, Einsichten und Deutungen, aber der private Haffner bleibt dabei merkwürdig blass. Und zu fragen wäre wohl auch, ob die Balance stimmt – ob nicht der Haffner, der mit historischen Büchern Furore machte, uns heute näher steht als jener Haffner, der dem stets flüchtigen Geschäft des Journalismus nachging – so sehr er damit auch seine Zeitgenossen faszinieren, beeindrucken und mit ihm Wirkung erzielen mochte.
Auch in seinen Büchern war Haffner streitbar, lieferte zugespitzte Thesen, die oft genug von Fachhistorikern hinterfragt oder angegriffen wurden. Etwa "Preußen ohne Legende", das sich als Ehrenrettung Preußens verstand. Auch der journalistische Historiker Haffner leistete sich Missgriffe – etwa mit dem Buch vom "Verrat", das die Schuld am Scheitern der Weimarer Republik praktisch auf ihre Geburtsstunde und das biedermännische Handeln der Ebert und Genossen vorverlegt.
Haffner, so urteilte Joachim Fest einmal, hatte eine Vorliebe für das Denken in freier Luft und ohne die "Kettengewichte der Realität an den Füßen". In "Anmerkungen zu Hitler", die 1978 erschienen und bald zum Bestseller wurden, löckte er wider den Zeitgeist, weil er – geradezu provozierend kühl und nüchtern-rational, also unter Verzicht auf die übliche moralische Empörung, erst Hitlers Erfolge schildert, um dann dessen tödliche Fehler zu analysieren. Zum Schluss bezichtigt er Hitler darin des Verrats an seinen Deutschen: Weil sie das unterlegene Volk waren, hatten sie aus seiner sozialdarwinistischen Sicht nicht das Recht, weiter zu existieren. Mit seinem Nero-Befehl zur Zerstörung aller Infrastruktur wollte er ihnen die Möglichkeit zum Überleben nehmen.
Es ist dieser Haffner, der bleiben wird, und sich einen Platz in der ersten Reihe der Zeithistoriker verdient hat.
Jürgen Peter Schmied: Sebastian Haffner. Eine Biografie
Verlag C.H. Beck, München 2010
Es gab einen Haffner, der Deutschland in acht Teilstaaten zu zerlegen empfahl und einen, der für die deutsche Einheit plädierte; einen, der die Wiederaufrüstung und Adenauers Politik der Stärke verfocht und einen, der ein neutrales Gesamtdeutschland wollte; einen, der Walter Ulbricht für den ersten deutschen Realpolitiker seit Bismarck hielt, mit dem der Westen Kompromisse suchen müsse, aber auch einen, der ihn als Gauleiter von Ostdeutschland verächtlich machte und seine DDR mit dem Dritten Reich der Nazis verglich.
Haffners Journalismus war durch und durch englisch geprägt, nichts fürchtete er so sehr wie die im traditionellen deutschen Leitartikel gepflegte Langeweile. Als hochbegabt, aber "wild", also extrem unberechenbar, hatte schon das britische Foreign-Office den Deutschen Emigranten eingeschätzt, der sich mit David Astor anfreundete und in dessen renommierter Wochenzeitung "Observer" bald die außenpolitischen Weichen stellte.
"Haffners Analysen beruhten häufig auf skeptisch-pessimistischen Einschätzungen, aus denen er ebenso drastische wie spektakuläre Schlussfolgerungen zu ziehen liebte. Sein Leser zu sein, war eine aufregende Angelegenheit. Schon (die) Artikelüberschriften wie 'Caution that Kills’ – Vorsicht tötet – oder 'Some Truths are Dangerous’ - gefährliche Wahrheiten - ...verhießen Unheil und Gefahr, und tatsächlich lauerte an der nächsten Ecke des Weltgeschehens meistens ein Krieg, mindestens aber eine bedrohliche Krise, die nur mit heldenhaftem Mut oder äußerster Entschlossenheit verhindert beziehungsweise entschärft werden konnten…"
So urteilt sein Biograf Jürgen Peter Schmied über den Engländer Haffner im Kalten Krieg. Die vielen Kurven und oft abrupten Meinungsänderungen des Kolumnisten zeichnet er getreulich nach - Rochaden oder Kehrtwendungen, die sich meist als Reaktionen auf eine veränderte Lage erklären - und immer auch aus Haffners Lust an der Provokation und an dem, was man im Angelsächsischen 'selling-promotion', also Verkaufsförderung nennt.
Aber so wechselnd, ja so schillernd seine Meinungen im Rückblick auch waren, gab es doch immer nur den einen Haffner: den thesenfreudigen, brillant formulierenden Schreiber, Erzähler oder Kommentator, der seinen Stoff beherrschte und zugleich über das Können der Vereinfachung, über die Kraft des Zuspitzens verfügte. Wie ein Staatsanwalt breitete der promovierte Volljurist seine Causa aus, alles weglassend, was gegen seine Anklage, jedes Argument bemühend, was für sie sprechen könnte. Und oft genug folgte der Leser als Richter dem Plädoyer des Kolumnisten, das meist im Ton eines ernüchterten Pessimisten vorgebracht wurde.
Würze und Wirkung vom Haffners Kommentaren beruhten auf der Kunst der Verkürzung, und wenn er seine Kolumnen-Logik als gesunden Menschenverstand umschrieb, waren oft auch jene Leser gefangen, die der Sache, die er empfahl, von Hause aus kritisch gegenüberstanden. Gelegentlich kleidete er sich wie ein konservativer Dandy, und seine hohe, näselnde Stimme in Hörfunk oder Fernsehen machte ihn selbst für Blinde unverwechselbar.
Der sich Sebastian Haffner nannte, hieß eigentlich Raimund Pretzel, war Sohn eines Volksschullehrers aus Pommern, der es in Berlin bis zum preußischen Ministerialrat gebracht hatte und erzielte seinen ersten großen Erfolg im englischen Exil. Er emigrierte 1938, weil er, in eine Deutsche jüdischer Herkunft verliebt, nach nationalsozialistischen Wahnbegriffen in Rassenschande lebte und sie ohne Komplikationen nur im Ausland heiraten konnte.
Seinen ersten Bucherfolg erzielte Haffner 1939 in England, als er den Versuch unternahm, den Briten die ihnen völlig fremde Binnenwelt des Dritten Reiches zu erklären. Der Titel 'Germany: Jekyll and Hyde', sollte eine fast schizophrene Gespaltenheit der Deutschen suggerieren. Seine Landsleute, die er darin beschrieb, waren ...
"...weltfremd und träumerisch und unpolitisch, ja viele seiner Landsleute würden das politische Geschäft sogar mit grundsätzlicher Abneigung betrachten,...was sie seltsamerweise nicht daran hindere, zu einzelnen Staatsmännern hochgradig emotionale Bindungen zu entwickeln. Nicht selten ähnelten diese Beziehungen jenem obskuren Verhältnis, das 'primitive Völker ihren Göttern gegenüber haben, welche sie schützen, ihnen den Sieg bescheren und gleichzeitig alle Schuld auf sich nehmen".
Jürgen Peter Schmied folgert zu Recht, dass Politikervergötterung und Untertanengeist für Haffner der Schlüssel zum Verständnis dafür waren, dass so viele Deutsche Hitler Gefolgschaft leisteten. Seine umfassende, gut geschriebenen Biografie stützt sich nicht nur auf eine viele Jahre währende Beschäftigung mit Haffner und auf Archive und Quellen, die jedermann zugänglich sind, sondern auch auf Haffners Privatarchiv, das ihm seine Kinder zugänglich machten.
So fehlt es nicht an neuen Fakten, Einsichten und Deutungen, aber der private Haffner bleibt dabei merkwürdig blass. Und zu fragen wäre wohl auch, ob die Balance stimmt – ob nicht der Haffner, der mit historischen Büchern Furore machte, uns heute näher steht als jener Haffner, der dem stets flüchtigen Geschäft des Journalismus nachging – so sehr er damit auch seine Zeitgenossen faszinieren, beeindrucken und mit ihm Wirkung erzielen mochte.
Auch in seinen Büchern war Haffner streitbar, lieferte zugespitzte Thesen, die oft genug von Fachhistorikern hinterfragt oder angegriffen wurden. Etwa "Preußen ohne Legende", das sich als Ehrenrettung Preußens verstand. Auch der journalistische Historiker Haffner leistete sich Missgriffe – etwa mit dem Buch vom "Verrat", das die Schuld am Scheitern der Weimarer Republik praktisch auf ihre Geburtsstunde und das biedermännische Handeln der Ebert und Genossen vorverlegt.
Haffner, so urteilte Joachim Fest einmal, hatte eine Vorliebe für das Denken in freier Luft und ohne die "Kettengewichte der Realität an den Füßen". In "Anmerkungen zu Hitler", die 1978 erschienen und bald zum Bestseller wurden, löckte er wider den Zeitgeist, weil er – geradezu provozierend kühl und nüchtern-rational, also unter Verzicht auf die übliche moralische Empörung, erst Hitlers Erfolge schildert, um dann dessen tödliche Fehler zu analysieren. Zum Schluss bezichtigt er Hitler darin des Verrats an seinen Deutschen: Weil sie das unterlegene Volk waren, hatten sie aus seiner sozialdarwinistischen Sicht nicht das Recht, weiter zu existieren. Mit seinem Nero-Befehl zur Zerstörung aller Infrastruktur wollte er ihnen die Möglichkeit zum Überleben nehmen.
Es ist dieser Haffner, der bleiben wird, und sich einen Platz in der ersten Reihe der Zeithistoriker verdient hat.
Jürgen Peter Schmied: Sebastian Haffner. Eine Biografie
Verlag C.H. Beck, München 2010
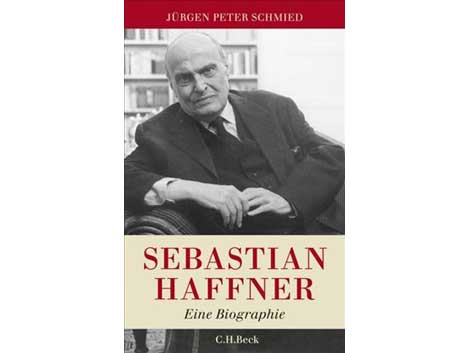
Buchcover: "Sebastian Haffner" von Jürgen Peter Schmied© C.H. Beck
