Ein düsteres Zukunftsszenario
Ging im 19. Jahrhundert das Gespenst des Kommunismus um, so ist es heute, nach einem Jahrhundert einzigartiger Wohlstandsmehrung, das Gespenst des Niedergangs. Nein, optimistisch sieht dieser Autor unsere Zukunft nicht, aber er gibt uns und den Westen - ein Begriff, unter dem er die früh industrialisierten Länder Europas und die USA versteht - auch nicht hoffnungslos verloren; jedenfalls nicht, wenn wir unsere Lebensweise änderten und lernten, Verzicht zu üben.
Wohlstand sei nicht mehr nur materiell zu bemessen, nicht nach der Zahl von Automobilen, Mobiltelefonen oder Videokameras; künftiger Wohlstand, das sei vor allem mitmenschlicher Zusammenhalt, ohne den rapide alternde, zahlenmäßig schwindende und abnehmend dynamische Gesellschaften wie die unsere trotz materiellen Reichtums arm seien.
Meinhard Miegel erregte vor Jahren Aufsehen mit seinem Buch "Die deformierte Gesellschaft", in dem er die Deutschen erbarmungslos mit ihren Mängeln, vor allem ihren sozial- und wirtschaftspolitischen Irrtümern konfrontierte. In seinem neuen Werk "Epochenwende" entwirft er das zutiefst beunruhigende Szenario eines Westens, der sich einem schmerzhaften Lernprozess stellen und Abschied nehmen muss: Sein strahlendes, goldenes Zeitalter habe er hinter sich, nach Jahrhunderten technisch-industrieller, weltweiter Dominanz sieht er die führenden Industrieländer ihren Vorsprung einbüßen. Die unfrohe Botschaft für die Völker des Westens laute:
"Ihr wart einmal etwas Besonderes. Ihr seid es nicht mehr. Was ihr könnt, können hunderte von Millionen auf der ganzen Welt ... Die einstmals großen Unterschiede in Wissen und Können nehmen ab. In ihrem Wissen und Können werden die arbeitenden Menschen dieser Welt einander immer ähnlicher. "
Weil dies so sei, meint Miegel, müsse auch die weltweite Arbeitsteilung radikal neu definiert werden. Es gehe nicht mehr darum, ob jemand etwas besser könne oder eine höhere Leistung erbringe. Entscheidend sei, dass er es billiger könne, und zwar einzig und allein weil er genügsamer, bescheidener, kurz: weil er mit einem niedrigeren Lebensstandard zufrieden sei.
Der große Realist Miegel entwirft da eine düstere Zukunftsvision, und weite Teile lesen sich wie eine Philippika gegen Schönredner, die noch immer auf einer rosaroten Wolke schweben. Im Visier hat er vor allem Politiker, welche die wahre Lage verschleiern und so das Volk in die Irre führen. Stattdessen sollten sie endlich den Mut zur Wahrheit finden und bekennen:
"Ja, die Wiege der Deutschen wird sich nicht so bald wieder füllen; ja, die Völker des Westens werden alt und älter; ja, es wird weder jetzt noch in absehbarer Zeit für jeden Arbeitswilligen einen interessanten und ertragreichen Arbeitsplatz geben; ja, andere Volkswirtschaften haben aufgeholt, und die eine oder andere könnte uns demnächst überholen. Ja, der Staat kann seine im Rahmen der sozialen Sicherungssysteme gegebenen Zusagen auf Dauer nicht einhalten:... Ja, wir müssen nicht nur die Ärmel hochkrempeln, sondern auch noch den Gürtel enger schnallen. "
Miegels "Epochenwende" enthält eine Menge unangenehmer Wahrheiten und unbequemer Einsichten - etwa die, dass die Abwanderung der Arbeitsplätze in Billiglohnländer, weil sie der Logik der Globalisierung entspricht, auch nicht vor Unternehmensspitzen halt machen muss. Warum soll eine deutsche Firma, die 70 Prozent ihres Umsatzes in Asien macht und dort 90 Prozent ihrer Gewinne erzielt, nicht ihr Unternehmen dorthin verlagern, wo die Märkte sind? Es wird, meint Miegel, mehr und mehr Fälle geben, in denen die Geschäfte nicht mehr aus Deutschland geleitet werden können. Solche Unternehmen würden langsam, aber sicher chinesisch oder was auch immer, und zwar vom Pförtner bis zum Chef. Zwar könnte ein Großteil des Firmenkapitals in deutschen Händen bleiben. Aber:
"Diese Hände haben großes Interesse an einer profitablen Unternehmensführung. Wenn diese in China besser als in Deutschland gewährleistet ist, gibt es für die Kapitaleigner keinen Grund, das Unternehmen in seinem Ursprungsland zu belassen. "
Zur Liste seiner unangenehmen Wahrheiten - und diese Liste ist lang! - zählt vor allem, dass Arbeitsplätze in Hochlohnländern wie dem unseren nur dann nicht verloren gehen, wenn die Arbeitskräfte hochmobil und flexibel, vor allem aber wenn sie bereit sind, Einkommenseinbußen hinzunehmen. Das aber heißt im Prinzip: Die Erwerbstätigen müssen sich langfristig - und auch bei uns! - den Bedingungen eines Weltarbeitsmarktes unterwerfen, der mit der fortschreitenden Globalisierung im Entstehen ist und morgen Wirklichkeit sein kann. Wer dies, so Miegel, nicht oder nicht ausreichend tue, werde gnadenlos vom Markt gefegt. Für den deutschen industriellen Arbeitnehmer bedeutet dies lange Zeiten des Lohnverzichts. Selbst wenn im Westen jahrzehntelang Nullrunden gedreht würden, um Arbeitsplätze zu sicher, und selbst wenn sich in den Niedriglohnländern die Arbeit stetig verteuere, würde Arbeit dort auch in dreißig Jahren nur halb soviel kosten wie in den USA oder Deutschland. Zur Wahrheit gehöre, dass es bei uns für Arbeit nur dann nicht weniger Geld geben werde, wenn der Westen gegenüber der übrigen Welt wieder jenen Vorsprung erlange, welche die Generationen der Groß- und Urgroßeltern hatten. Dass sie dazu fähig wären, hält er für ausgeschlossen, denn sie wollten Sicherheit, Behaglichkeit und Vergnügen. Kämpfe und Wettbewerb - das sähen sie sich lieber von der Zuschauertribüne an
In der globalisierten Wirtschaft sieht Miegel einen Ausgleichs- oder Angleichungsprozess am Werk, der für die Inder natürlich Aufstieg, für die Deutschen notwendig Abstieg bedeute, ohne dass man sich in der Mitte treffen müsste - das Niveau des Gleichstands könne nach einem jahrzehntelangen Holperprozess auch weit über der Mitte zwischen Indern und Deutschen liegen. Allerdings hält er für uns Deutsche, die oft als kranker Mann Europas bezeichnet werden, einen winzigen Trost bereit: Wer so von uns spreche, kenne nicht die Krankheiten der anderen. Gemessen an Franzosen und Italienern seien wir Deutschen geradezu reformfreudig. Und selbst die Briten und Iren, die mit hohen Wachstums- und niedrigen Arbeitslosenquoten glänzten, wiesen bei Licht besehen empfindliche Schwächen auf.
Miegel denkt in Wellenbewegungen, die sich geschichtlich ebenso erbarmungslos wie konsequent vollziehen - und das mag eine Schwäche dieses sonst sehr verdienstvollen Buches sein. Die historischen Auf- und Abstiege erinnern ein an Spenglers Untergang des Abendlands: Der nächste, der falle, heißt es da ein wenig zu schlicht, sei unfehlbar der Platzhirsch - das sei das eherne weltgeschichtliches Gesetz seit Assyrern und Ägyptern, Griechen und Römern. Sind also jetzt wir, ist der gesamte Westen an der Reihe?
Mutmaßlich ja; und weil es durch den globalen Wettkampf bei uns nicht genug Erwerbsarbeit geben wird, empfiehlt Miegel, hier ganz der Sozialphilosoph, der auf Ethik und überkommene Werte setzt, unsere Einstellung zur Arbeit zu entkrampfen. Die Ansicht, dass erst durch Arbeit der Mensch zum Menschen werde, nennt er schlicht eine grobe Verkennung der menschlichen Natur. Auch der spielende, der kontemplative Mensch sei Mensch, - "und zwar ohne jede Einschränkung". Die Deutschen müssten aufhören damit, sich mit Minilöhnen schwer zu tun. Überhaupt: Eine Gesellschaft, in der Menschen in den Erwerb drängten, nur um von ihren Mitmenschen anerkannt zu werden, gehe in die Irre. Gegen die gängige Wertung, die bezahlter Arbeit einen gesellschaftlich höheren Rang einräumt, setzt er seine Maxime: "Wenn Arbeit zu adeln ist, dann die unentgeltliche oder die schlecht bezahlte". Man hört die Botschaft, die da Wandel der Werteskala, Rückgriff auf Ethik und überkommenes sittliches Verhalten fordert. Und sicher wäre es nur zu schön, wenn Miegel Recht hätte und die Gesellschaft des materiellen Verzichts, der wir entgegengehen, zu einer humaneren würde als die jetzige, in der wir leben. Doch wird am Ende seiner Epochenenwende aus dem Realisten Miegel hier nicht ein Utopist? Dennoch sehr, sehr lesenswert.
Meinhard Miegel erregte vor Jahren Aufsehen mit seinem Buch "Die deformierte Gesellschaft", in dem er die Deutschen erbarmungslos mit ihren Mängeln, vor allem ihren sozial- und wirtschaftspolitischen Irrtümern konfrontierte. In seinem neuen Werk "Epochenwende" entwirft er das zutiefst beunruhigende Szenario eines Westens, der sich einem schmerzhaften Lernprozess stellen und Abschied nehmen muss: Sein strahlendes, goldenes Zeitalter habe er hinter sich, nach Jahrhunderten technisch-industrieller, weltweiter Dominanz sieht er die führenden Industrieländer ihren Vorsprung einbüßen. Die unfrohe Botschaft für die Völker des Westens laute:
"Ihr wart einmal etwas Besonderes. Ihr seid es nicht mehr. Was ihr könnt, können hunderte von Millionen auf der ganzen Welt ... Die einstmals großen Unterschiede in Wissen und Können nehmen ab. In ihrem Wissen und Können werden die arbeitenden Menschen dieser Welt einander immer ähnlicher. "
Weil dies so sei, meint Miegel, müsse auch die weltweite Arbeitsteilung radikal neu definiert werden. Es gehe nicht mehr darum, ob jemand etwas besser könne oder eine höhere Leistung erbringe. Entscheidend sei, dass er es billiger könne, und zwar einzig und allein weil er genügsamer, bescheidener, kurz: weil er mit einem niedrigeren Lebensstandard zufrieden sei.
Der große Realist Miegel entwirft da eine düstere Zukunftsvision, und weite Teile lesen sich wie eine Philippika gegen Schönredner, die noch immer auf einer rosaroten Wolke schweben. Im Visier hat er vor allem Politiker, welche die wahre Lage verschleiern und so das Volk in die Irre führen. Stattdessen sollten sie endlich den Mut zur Wahrheit finden und bekennen:
"Ja, die Wiege der Deutschen wird sich nicht so bald wieder füllen; ja, die Völker des Westens werden alt und älter; ja, es wird weder jetzt noch in absehbarer Zeit für jeden Arbeitswilligen einen interessanten und ertragreichen Arbeitsplatz geben; ja, andere Volkswirtschaften haben aufgeholt, und die eine oder andere könnte uns demnächst überholen. Ja, der Staat kann seine im Rahmen der sozialen Sicherungssysteme gegebenen Zusagen auf Dauer nicht einhalten:... Ja, wir müssen nicht nur die Ärmel hochkrempeln, sondern auch noch den Gürtel enger schnallen. "
Miegels "Epochenwende" enthält eine Menge unangenehmer Wahrheiten und unbequemer Einsichten - etwa die, dass die Abwanderung der Arbeitsplätze in Billiglohnländer, weil sie der Logik der Globalisierung entspricht, auch nicht vor Unternehmensspitzen halt machen muss. Warum soll eine deutsche Firma, die 70 Prozent ihres Umsatzes in Asien macht und dort 90 Prozent ihrer Gewinne erzielt, nicht ihr Unternehmen dorthin verlagern, wo die Märkte sind? Es wird, meint Miegel, mehr und mehr Fälle geben, in denen die Geschäfte nicht mehr aus Deutschland geleitet werden können. Solche Unternehmen würden langsam, aber sicher chinesisch oder was auch immer, und zwar vom Pförtner bis zum Chef. Zwar könnte ein Großteil des Firmenkapitals in deutschen Händen bleiben. Aber:
"Diese Hände haben großes Interesse an einer profitablen Unternehmensführung. Wenn diese in China besser als in Deutschland gewährleistet ist, gibt es für die Kapitaleigner keinen Grund, das Unternehmen in seinem Ursprungsland zu belassen. "
Zur Liste seiner unangenehmen Wahrheiten - und diese Liste ist lang! - zählt vor allem, dass Arbeitsplätze in Hochlohnländern wie dem unseren nur dann nicht verloren gehen, wenn die Arbeitskräfte hochmobil und flexibel, vor allem aber wenn sie bereit sind, Einkommenseinbußen hinzunehmen. Das aber heißt im Prinzip: Die Erwerbstätigen müssen sich langfristig - und auch bei uns! - den Bedingungen eines Weltarbeitsmarktes unterwerfen, der mit der fortschreitenden Globalisierung im Entstehen ist und morgen Wirklichkeit sein kann. Wer dies, so Miegel, nicht oder nicht ausreichend tue, werde gnadenlos vom Markt gefegt. Für den deutschen industriellen Arbeitnehmer bedeutet dies lange Zeiten des Lohnverzichts. Selbst wenn im Westen jahrzehntelang Nullrunden gedreht würden, um Arbeitsplätze zu sicher, und selbst wenn sich in den Niedriglohnländern die Arbeit stetig verteuere, würde Arbeit dort auch in dreißig Jahren nur halb soviel kosten wie in den USA oder Deutschland. Zur Wahrheit gehöre, dass es bei uns für Arbeit nur dann nicht weniger Geld geben werde, wenn der Westen gegenüber der übrigen Welt wieder jenen Vorsprung erlange, welche die Generationen der Groß- und Urgroßeltern hatten. Dass sie dazu fähig wären, hält er für ausgeschlossen, denn sie wollten Sicherheit, Behaglichkeit und Vergnügen. Kämpfe und Wettbewerb - das sähen sie sich lieber von der Zuschauertribüne an
In der globalisierten Wirtschaft sieht Miegel einen Ausgleichs- oder Angleichungsprozess am Werk, der für die Inder natürlich Aufstieg, für die Deutschen notwendig Abstieg bedeute, ohne dass man sich in der Mitte treffen müsste - das Niveau des Gleichstands könne nach einem jahrzehntelangen Holperprozess auch weit über der Mitte zwischen Indern und Deutschen liegen. Allerdings hält er für uns Deutsche, die oft als kranker Mann Europas bezeichnet werden, einen winzigen Trost bereit: Wer so von uns spreche, kenne nicht die Krankheiten der anderen. Gemessen an Franzosen und Italienern seien wir Deutschen geradezu reformfreudig. Und selbst die Briten und Iren, die mit hohen Wachstums- und niedrigen Arbeitslosenquoten glänzten, wiesen bei Licht besehen empfindliche Schwächen auf.
Miegel denkt in Wellenbewegungen, die sich geschichtlich ebenso erbarmungslos wie konsequent vollziehen - und das mag eine Schwäche dieses sonst sehr verdienstvollen Buches sein. Die historischen Auf- und Abstiege erinnern ein an Spenglers Untergang des Abendlands: Der nächste, der falle, heißt es da ein wenig zu schlicht, sei unfehlbar der Platzhirsch - das sei das eherne weltgeschichtliches Gesetz seit Assyrern und Ägyptern, Griechen und Römern. Sind also jetzt wir, ist der gesamte Westen an der Reihe?
Mutmaßlich ja; und weil es durch den globalen Wettkampf bei uns nicht genug Erwerbsarbeit geben wird, empfiehlt Miegel, hier ganz der Sozialphilosoph, der auf Ethik und überkommene Werte setzt, unsere Einstellung zur Arbeit zu entkrampfen. Die Ansicht, dass erst durch Arbeit der Mensch zum Menschen werde, nennt er schlicht eine grobe Verkennung der menschlichen Natur. Auch der spielende, der kontemplative Mensch sei Mensch, - "und zwar ohne jede Einschränkung". Die Deutschen müssten aufhören damit, sich mit Minilöhnen schwer zu tun. Überhaupt: Eine Gesellschaft, in der Menschen in den Erwerb drängten, nur um von ihren Mitmenschen anerkannt zu werden, gehe in die Irre. Gegen die gängige Wertung, die bezahlter Arbeit einen gesellschaftlich höheren Rang einräumt, setzt er seine Maxime: "Wenn Arbeit zu adeln ist, dann die unentgeltliche oder die schlecht bezahlte". Man hört die Botschaft, die da Wandel der Werteskala, Rückgriff auf Ethik und überkommenes sittliches Verhalten fordert. Und sicher wäre es nur zu schön, wenn Miegel Recht hätte und die Gesellschaft des materiellen Verzichts, der wir entgegengehen, zu einer humaneren würde als die jetzige, in der wir leben. Doch wird am Ende seiner Epochenenwende aus dem Realisten Miegel hier nicht ein Utopist? Dennoch sehr, sehr lesenswert.
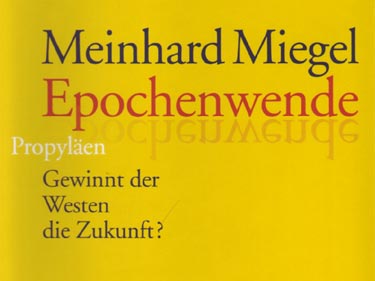
Meinhard Miegel: Epochenwende© Propyläen-Verlag