"Ein Gelehrtenkopf der Widersprüche"
In "Friedrich Schlegel oder Die Sehnsucht nach Deutschland" nähert sich der Journalist Harro Zimmermann dem frühromantischen Dichter vor allem durch seine Denkweisen. Herausgekommen ist eine Monographie unter intellektuell-politischen Aspekten.
Friedrich Schlegel ist heute selbst für den leidlich Gebildeten nicht viel mehr als ein Name. Gern wird er mit seinem älteren Bruder August Wilhelm verwechselt, der gemeinsam mit Ludwig Tieck die immer noch meistgespielten deutschen Fassungen der Stücke William Shakespeares schuf. Die Brüder kooperierten lange Zeit miteinander, ehe sie sich entzweiten, was durch die weltanschauliche Konversion des Jüngeren bedingt wurde. Friedrich Schlegel war von den Geschwistern der entschieden brillantere und begabtere.
Friedrich Schlegel kam aus einem niedersächsischen Pfarrhaus. Der Protestantismus hat seine ersten intellektuellen Schritte bestimmt derart, dass er sich rasch davon zu emanzipieren versuchte.
"Die Religion ist meistens nur ein Supplement oder gar ein Surrogat der Bildung… Man kann also sagen: Je … mehr Bildung, je weniger Religion."
Zusammen mit seinem Bruder, zusammen mit Novalis, Brentano, Tieck und Fichte bildete er in Jena den frühromantischen Kreis, mit dem eine maßgebliche Stilrichtung deutscher Literaturentwicklung ihren Anfang nahm. Er begründete und praktizierte die Ironie, als Stilmittel wie als Lebenshaltung.
"Ironie ist die Form des Paradoxen. Paradox ist alles, was zugleich gut und groß ist."
Er schuf mit seinem Roman "Lucinde" das erste bedeutende erotische Prosabuch unserer Literaturgeschichte, in Niveau und Bedeutung vergleichbar den "Gefährlichen Liebschaften" des Choderlos de la Clos. Er war ein begnadeter Aphoristiker, Essayist und Kulturkritiker, in dessen Tradition sowohl Heine wie Nietzsche, Karl Kraus wie Adorno, Walter Benjamin wie Friedrich Sieburg stehen.
Er hat die orientalistische Forschung inspiriert. Er hat gesehen und gesagt, dass der Roman zur wichtigsten Literaturform des bürgerlichen Zeitalters würde, und seine religionsgeschichtlichen Überlegungen wirkten fort bis hin zu Karl Rahner und Joseph Ratzinger.
Er war belesen und beherrschte mehrere Sprachen, darunter Sanskrit. Probiert hat er sich in sämtlichen literarischen Formen. Als Theaterautor taugte er nichts, und auch seine Lyrik, zu seinen Lebzeiten beachtet und formal durchaus von einiger Qualität, ist inzwischen vergessen.
Er promovierte und lehrte an der Universität. Unter Geldnot litt er sein Leben lang. Er hielt Vorträge. Er belieferte Zeitungen und Zeitschriften und gab selber welche heraus, insgesamt vier, das gemeinsam mit dem Bruder redigierte "Athenäum" war die wichtigste.
Er war ein Genussmensch. Im Alter wurde er zu einem berüchtigten Fresssack. Franz Grillparzer:
"Wie er fraß und soff, und nachdem er getrunken hatte, gern mit dem Gespräch ins Sinnliche jeder Art hinüberging…"
Er hatte Amouren. Jene mit Brendel Veit, Tochter von Moses Mendelssohn, war die spektakulärste; er schrieb darüber den Roman "Lucinde", der einen gesellschaftlichen Skandal verursachte. Später hat er Brendel geheiratet; als Dorothea Schlegel brachte sie es zu einiger Prominenz und war ihrerseits literarisch nicht unbegabt. Der junge Schlegel stand unter dem Eindruck der Ereignisse nach dem Bastillesturm 1789.
"Die Französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre und Goethes ‚Meister’ sind die größten Tendenzen des Zeitalters."
Er bekannte sich zu dem deutschen Jakobiner Georg Forster. Er lebte ein paar Jahre in Paris. Dann, zurückgekehrt, konvertierte er zum Katholizismus.
"Die Religion ist nicht bloß ein Teil der Bildung, ein Glied der Menschheit, sondern das Zentrum aller übrigen, überall das Erste und Höchste, das schlechthin Ursprüngliche."
Er war in solcher Hinwendung nicht der einzige in seiner Zeit und in seiner Zunft, Brentano und Görres verfuhren ähnlich. Der Katholizismus wurde zur prägenden Ideologie der deutschen Spätromantik. Zuletzt war er Beamter im Dienst der reaktionären Administration des österreichischen Kanzlers Klemens Wenzel von Metternich.
Dies haben ihm manche seiner früheren Gefährten gründlich verübelt, darunter der Bruder, und die Sache verdunkelt sein Bild bis heute. Vergleichbar dem Fall Brentanos, dessen späte Bemühungen um die stigmatisierte Therese von Konnersreuth ästhetisch als wenig belangvoll gelten, werden die religionsgeschichtlichen Schriften Schlegels nur wenig geschätzt.
Brentano konvertierte 1817. Da war die politische Restauration in Europa in vollem Gange. Schlegel konvertierte bereits 1804. Seine Entscheidung hatte nichts mit Mode oder Opportunismus zu tun, sondern mit Überzeugung - sie erfolgte, wie Heinrich Heine zugestand, ehrlichen Herzens. So sehr Schlegel danach ausdrücklich von seinen früheren Ideen abrücken mochte, insgeheim blieb er ihnen weiterhin attachiert, irgendwie. Es ist das, was seine späten Arbeiten aufschlussreich macht.
Genau dies bildet einen der Ansätze zu einer neuen, jetzt erschienen Friedrich-Schlegel-Monografie. Verfasst hat sie der Bremer Radio-Journalist Harro Zimmermann. Ihm ging es nicht um eine umfassende Lebensbeschreibung, sondern um die intellektuell-politischen Aspekte des Autors, er nennt es dessen "biographische Geistesphysiognomie".
Damit macht er es sich nicht eben leicht. Die äußeren Lebensumstände des Protagonisten finden nur am Rande oder gar nicht statt. Es geht vornehmlich um die Schriften, um die Überzeugungen, um die Politik. Es findet eine Analyse, Kommentierung und geistesgeschichtliche Einordnung des Schriftstellers Friedrich Schlegel statt, die in solcher Stringenz ihresgleichen sucht.
"Schlegels liberal gesinnte Kritiker verwarfen in ihm oft genug den Parteigänger der katholischen Restauration und Erbverweigerung des aufgeklärten Geistes. Seine konservativen Gegner beargwöhnten ihn als verkappten Renegaten…"
Es spricht für das Vermögen Zimmermanns, dass seine mit ausführlichen Zitaten versehenen Exkurse niemals langweilig oder ermüdend, sondern immer aufschlussreich und höchst spannend zu lesen sind. Vorgeführt wird eine intellektuelle Existenz, die in ihren Wandlungen zwischen Revolution und Reaktion, zwischen Aufklärung und Gegenaufklärung nicht bloß aussagekräftig für die Zeit um 1800 ist, sondern ebenso für die Gegenwart. Dass dem Rezensenten bei seiner Lektüre gelegentlich Namen wie Enzensberger, Habermas und Mosebach beikamen, spricht für Harro Zimmermanns Arbeit gleichermaßen.
Dessen Resümee lautet:
"Friedrich Schlegel ist und bleibt auch nach seinem Tod ein Intellektueller im Zeitbruch, ein Gelehrtenkopf der Widersprüche und Unwägbarkeiten, an dem jede einsinnige Erklärung, Vereinnahmung oder Verdammung, auch die meisten Domestizierungsversuche der Nekrologen, zu Bruch gehen... Der ... oft als entschiedener Verfechter einer katholisch gestützten Restaurationshaltung gescholten worden ist, bleibt noch in seinen späten Aufzeichnungen zu Philosophie und Theologie, Geschichte und Politik, ein hellwacher und kritischer Zeitgenosse."
Nun trägt Zimmermanns Buch den Untertitel "Die Sehnsucht nach Deutschland". Das mag angesichts dieses ubiquitären, zuletzt in Wien beschäftigten Schöngeistes erstaunen; dessen deutsch-patriotischen Äußerungen während der napoleonischen Kriege blieben ein Zwischenspiel ebenso wie die von Metternich bestellten Beobachtungen des Bundestags in Frankfurt. Deutschland war um 1800 eher eine Kulturidee, keine staatliche Wirklichkeit. In Kulturdingen kannte Schlegel sich aus. Ein wirkliches Vaterland sei ihm zu keiner Zeit vergönnt gewesen, sagt Zimmermann und zitiert aus einem Brief an Dorothea:
"Du sprichst von Deutschland; ach, wenn ich dort wäre..."
Zimmermann schließt:
"Friedrich Schlegel ist vielen ein Begriff, und doch war er unter den Deutschen nie wirklich erwünscht, seine Heimat lag immer nur hinter oder vor ihm. Dabei wollte er nur eines – zu Hause sein."
Harro Zimmermann: Friedrich Schlegel oder Die Sehnsucht nach Deutschland
Schöningh Verlag, Paderborn 2009
Friedrich Schlegel kam aus einem niedersächsischen Pfarrhaus. Der Protestantismus hat seine ersten intellektuellen Schritte bestimmt derart, dass er sich rasch davon zu emanzipieren versuchte.
"Die Religion ist meistens nur ein Supplement oder gar ein Surrogat der Bildung… Man kann also sagen: Je … mehr Bildung, je weniger Religion."
Zusammen mit seinem Bruder, zusammen mit Novalis, Brentano, Tieck und Fichte bildete er in Jena den frühromantischen Kreis, mit dem eine maßgebliche Stilrichtung deutscher Literaturentwicklung ihren Anfang nahm. Er begründete und praktizierte die Ironie, als Stilmittel wie als Lebenshaltung.
"Ironie ist die Form des Paradoxen. Paradox ist alles, was zugleich gut und groß ist."
Er schuf mit seinem Roman "Lucinde" das erste bedeutende erotische Prosabuch unserer Literaturgeschichte, in Niveau und Bedeutung vergleichbar den "Gefährlichen Liebschaften" des Choderlos de la Clos. Er war ein begnadeter Aphoristiker, Essayist und Kulturkritiker, in dessen Tradition sowohl Heine wie Nietzsche, Karl Kraus wie Adorno, Walter Benjamin wie Friedrich Sieburg stehen.
Er hat die orientalistische Forschung inspiriert. Er hat gesehen und gesagt, dass der Roman zur wichtigsten Literaturform des bürgerlichen Zeitalters würde, und seine religionsgeschichtlichen Überlegungen wirkten fort bis hin zu Karl Rahner und Joseph Ratzinger.
Er war belesen und beherrschte mehrere Sprachen, darunter Sanskrit. Probiert hat er sich in sämtlichen literarischen Formen. Als Theaterautor taugte er nichts, und auch seine Lyrik, zu seinen Lebzeiten beachtet und formal durchaus von einiger Qualität, ist inzwischen vergessen.
Er promovierte und lehrte an der Universität. Unter Geldnot litt er sein Leben lang. Er hielt Vorträge. Er belieferte Zeitungen und Zeitschriften und gab selber welche heraus, insgesamt vier, das gemeinsam mit dem Bruder redigierte "Athenäum" war die wichtigste.
Er war ein Genussmensch. Im Alter wurde er zu einem berüchtigten Fresssack. Franz Grillparzer:
"Wie er fraß und soff, und nachdem er getrunken hatte, gern mit dem Gespräch ins Sinnliche jeder Art hinüberging…"
Er hatte Amouren. Jene mit Brendel Veit, Tochter von Moses Mendelssohn, war die spektakulärste; er schrieb darüber den Roman "Lucinde", der einen gesellschaftlichen Skandal verursachte. Später hat er Brendel geheiratet; als Dorothea Schlegel brachte sie es zu einiger Prominenz und war ihrerseits literarisch nicht unbegabt. Der junge Schlegel stand unter dem Eindruck der Ereignisse nach dem Bastillesturm 1789.
"Die Französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre und Goethes ‚Meister’ sind die größten Tendenzen des Zeitalters."
Er bekannte sich zu dem deutschen Jakobiner Georg Forster. Er lebte ein paar Jahre in Paris. Dann, zurückgekehrt, konvertierte er zum Katholizismus.
"Die Religion ist nicht bloß ein Teil der Bildung, ein Glied der Menschheit, sondern das Zentrum aller übrigen, überall das Erste und Höchste, das schlechthin Ursprüngliche."
Er war in solcher Hinwendung nicht der einzige in seiner Zeit und in seiner Zunft, Brentano und Görres verfuhren ähnlich. Der Katholizismus wurde zur prägenden Ideologie der deutschen Spätromantik. Zuletzt war er Beamter im Dienst der reaktionären Administration des österreichischen Kanzlers Klemens Wenzel von Metternich.
Dies haben ihm manche seiner früheren Gefährten gründlich verübelt, darunter der Bruder, und die Sache verdunkelt sein Bild bis heute. Vergleichbar dem Fall Brentanos, dessen späte Bemühungen um die stigmatisierte Therese von Konnersreuth ästhetisch als wenig belangvoll gelten, werden die religionsgeschichtlichen Schriften Schlegels nur wenig geschätzt.
Brentano konvertierte 1817. Da war die politische Restauration in Europa in vollem Gange. Schlegel konvertierte bereits 1804. Seine Entscheidung hatte nichts mit Mode oder Opportunismus zu tun, sondern mit Überzeugung - sie erfolgte, wie Heinrich Heine zugestand, ehrlichen Herzens. So sehr Schlegel danach ausdrücklich von seinen früheren Ideen abrücken mochte, insgeheim blieb er ihnen weiterhin attachiert, irgendwie. Es ist das, was seine späten Arbeiten aufschlussreich macht.
Genau dies bildet einen der Ansätze zu einer neuen, jetzt erschienen Friedrich-Schlegel-Monografie. Verfasst hat sie der Bremer Radio-Journalist Harro Zimmermann. Ihm ging es nicht um eine umfassende Lebensbeschreibung, sondern um die intellektuell-politischen Aspekte des Autors, er nennt es dessen "biographische Geistesphysiognomie".
Damit macht er es sich nicht eben leicht. Die äußeren Lebensumstände des Protagonisten finden nur am Rande oder gar nicht statt. Es geht vornehmlich um die Schriften, um die Überzeugungen, um die Politik. Es findet eine Analyse, Kommentierung und geistesgeschichtliche Einordnung des Schriftstellers Friedrich Schlegel statt, die in solcher Stringenz ihresgleichen sucht.
"Schlegels liberal gesinnte Kritiker verwarfen in ihm oft genug den Parteigänger der katholischen Restauration und Erbverweigerung des aufgeklärten Geistes. Seine konservativen Gegner beargwöhnten ihn als verkappten Renegaten…"
Es spricht für das Vermögen Zimmermanns, dass seine mit ausführlichen Zitaten versehenen Exkurse niemals langweilig oder ermüdend, sondern immer aufschlussreich und höchst spannend zu lesen sind. Vorgeführt wird eine intellektuelle Existenz, die in ihren Wandlungen zwischen Revolution und Reaktion, zwischen Aufklärung und Gegenaufklärung nicht bloß aussagekräftig für die Zeit um 1800 ist, sondern ebenso für die Gegenwart. Dass dem Rezensenten bei seiner Lektüre gelegentlich Namen wie Enzensberger, Habermas und Mosebach beikamen, spricht für Harro Zimmermanns Arbeit gleichermaßen.
Dessen Resümee lautet:
"Friedrich Schlegel ist und bleibt auch nach seinem Tod ein Intellektueller im Zeitbruch, ein Gelehrtenkopf der Widersprüche und Unwägbarkeiten, an dem jede einsinnige Erklärung, Vereinnahmung oder Verdammung, auch die meisten Domestizierungsversuche der Nekrologen, zu Bruch gehen... Der ... oft als entschiedener Verfechter einer katholisch gestützten Restaurationshaltung gescholten worden ist, bleibt noch in seinen späten Aufzeichnungen zu Philosophie und Theologie, Geschichte und Politik, ein hellwacher und kritischer Zeitgenosse."
Nun trägt Zimmermanns Buch den Untertitel "Die Sehnsucht nach Deutschland". Das mag angesichts dieses ubiquitären, zuletzt in Wien beschäftigten Schöngeistes erstaunen; dessen deutsch-patriotischen Äußerungen während der napoleonischen Kriege blieben ein Zwischenspiel ebenso wie die von Metternich bestellten Beobachtungen des Bundestags in Frankfurt. Deutschland war um 1800 eher eine Kulturidee, keine staatliche Wirklichkeit. In Kulturdingen kannte Schlegel sich aus. Ein wirkliches Vaterland sei ihm zu keiner Zeit vergönnt gewesen, sagt Zimmermann und zitiert aus einem Brief an Dorothea:
"Du sprichst von Deutschland; ach, wenn ich dort wäre..."
Zimmermann schließt:
"Friedrich Schlegel ist vielen ein Begriff, und doch war er unter den Deutschen nie wirklich erwünscht, seine Heimat lag immer nur hinter oder vor ihm. Dabei wollte er nur eines – zu Hause sein."
Harro Zimmermann: Friedrich Schlegel oder Die Sehnsucht nach Deutschland
Schöningh Verlag, Paderborn 2009
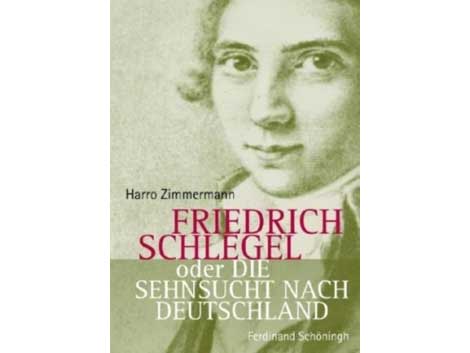
Harro Zimmermann: "Friedrich Schlegel oder Die Sehnsucht nach Deutschland"© Schöningh Verlag
