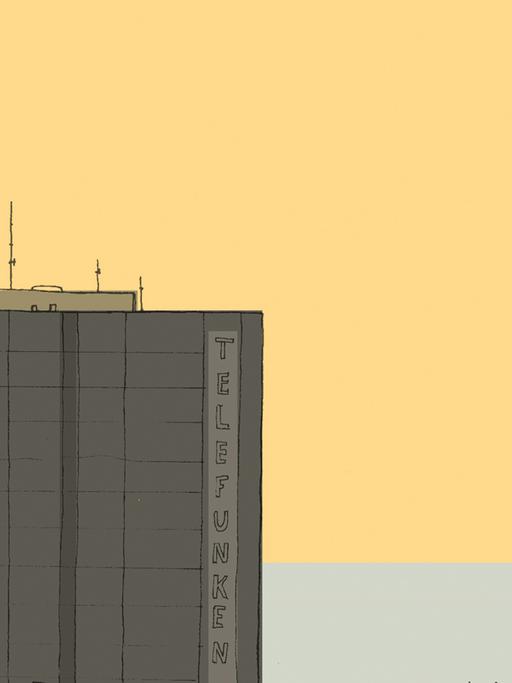Wie Migranten Berlin verwandeln

Erinnerungen an Heimat, Aufbruch und die Prägungen der neuen Heimat – viele Geschichten der ersten Generation der so genannten Gastarbeiter sind nicht erzählt. In Berlin-Kreuzberg gibt es Orte, wo man diesen Menschen abseits der Klischees zuhören kann.
"Jetzt mache ich hier den Garten, die Terrasse und so, die Blumen, ich gebe mir viel Mühe und gieße auch abends und pflege sie immer, da ich auch viele Blumen haben will, die Frauen haben sie auch selbst gekauft und uns geschenkt."
Der "Familiengarten" liegt mitten in Berlin Kreuzberg, einem Bezirk, wo rund ein Drittel der Einwohner eine Migrationsgeschichte hat. Der Familiengarten ist ein Begegnungszentrum, besteht aus einem großen Raum und einem kleinen Garten im anliegenden Innenhof.
Der "Familiengarten" liegt mitten in Berlin Kreuzberg, einem Bezirk, wo rund ein Drittel der Einwohner eine Migrationsgeschichte hat. Der Familiengarten ist ein Begegnungszentrum, besteht aus einem großen Raum und einem kleinen Garten im anliegenden Innenhof.
Hier, fernab von der lärmenden Oranienstraße, aber in direkter Nachbarschaft einer Kita, deren Kinder gerade auf den Hof strömen, steht Filiz Teschkün. Die türkischstämmige Rentnerin ist eine Frau mit viel Humor, in ihren Augen blitzt oft der Schalk. Sie weist auf das von ihr angelegte Blumen- und Kräuterbeet und pflückt einige Pfefferminzblätter für den Tee.
"Also zum Beispiel Wermut, ich kenne ihn aus der Türkei, Wermut haben wir jetzt hier im Garten, also wegen der Sehnsucht nach der Türkei, also aus der Kindheit. Ich bin sehr froh, der überlebt auch im Winter, weil in Bursa, wo ich geboren bin, da ist es im Winter auch immer hart. Ich habe überlegt, wenn er dort lebt, dann warum nicht hier?! Deswegen war ich sehr begeistert. Ich wohne am Weichselplatz, seit 39 Jahren wohne ich da, Ende '79 bin ich dorthin umgezogen, und habe einen weißen Flieder angepflanzt. Jetzt ist er ein großer Baum. Ja, ich freue mich auch darüber. Manche sind sehr leicht zu pflegen, man braucht nur Wasser, mehr nicht, Licht und Wasser, mehr nicht."
"Also zum Beispiel Wermut, ich kenne ihn aus der Türkei, Wermut haben wir jetzt hier im Garten, also wegen der Sehnsucht nach der Türkei, also aus der Kindheit. Ich bin sehr froh, der überlebt auch im Winter, weil in Bursa, wo ich geboren bin, da ist es im Winter auch immer hart. Ich habe überlegt, wenn er dort lebt, dann warum nicht hier?! Deswegen war ich sehr begeistert. Ich wohne am Weichselplatz, seit 39 Jahren wohne ich da, Ende '79 bin ich dorthin umgezogen, und habe einen weißen Flieder angepflanzt. Jetzt ist er ein großer Baum. Ja, ich freue mich auch darüber. Manche sind sehr leicht zu pflegen, man braucht nur Wasser, mehr nicht, Licht und Wasser, mehr nicht."
1989 öffnet der "Familiengarten"
Der "Familiengarten" ist ein sogenanntes Stadtteilzentrum, das 1989 eröffnet wurde. Seitdem dient es als Treffpunkt, als ein Ort, in dem sich Menschen aus der ganzen Welt, die Kreuzberg zu ihrer Heimat gemacht haben, treffen können. Dabei wird weder auf die Herkunft noch auf den Geldbeutel geschaut. Jeder, der den Raum betritt, wird freundlich begrüßt und eingeladen, sich auf eine der zahlreichen Sitzecken zu setzen und Tee zu trinken.
Vor 32 Jahren organisierte Filiz Teschkün hier zum ersten Mal ein Treffen türkischer Frauen, die sie aus ihrem alten Gastarbeiterinnenwohnheim kannte.
"Ich bin 1964 als Gastarbeiterin aus Istanbul nach Berlin gekommen, aber ich möchte gerne den Grund noch erzählen, warum ich überhaupt nach Deutschland gekommen bin. In Istanbul, als ich 14 Jahre alt war, wollte ich unbedingt Schneiderin werden. Und ich habe mich erkundigt und ein Atelier gefunden, wo der Meister Grieche war, er machte auch Konfektionsarbeit, also Frauenmäntel und so was, für Anatolien. Und das war für mich die schönste Zeit."
Filiz wirft einen forschenden Blick, sie möchte sichergehen, dass ihre Worte auch ankommen. Denn danach, als ihre 'schönste Zeit' endete, beschloss sie, nach Deutschland zu gehen.
"Na ja, und dann habe ich mich gemeldet in Istanbul beim Arbeitsamt. Die Papiere und Untersuchung, das war natürlich sehr problematisch, also unsere Zähne haben sie auch kontrolliert, Röntgenaufnahme von Leber und Urin gemacht, geschaut, ob wir schwanger sind, oder ob wir Diabetikerinnen sind, alles untersucht. Das hat drei, vier Wochen gedauert. Mein Vater oder Mutter, sie wollten nicht hierherkommen, also sie haben sich gewundert, warum ich nach Deutschland gehe. Ich habe alle bürokratischen Sachen vorbereitet und plötzlich habe ich gesagt, wir hatten gerade ein Abendessen: Ich habe meine Papiere vorbereitet, ich gehe bald nach Deutschland. Mein Vater hat gesagt: Bist du hier hungrig? Und dann habe ich gesagt: Nein, nicht wegen Hunger. Abenteuer!
"Ich bin 1964 als Gastarbeiterin aus Istanbul nach Berlin gekommen, aber ich möchte gerne den Grund noch erzählen, warum ich überhaupt nach Deutschland gekommen bin. In Istanbul, als ich 14 Jahre alt war, wollte ich unbedingt Schneiderin werden. Und ich habe mich erkundigt und ein Atelier gefunden, wo der Meister Grieche war, er machte auch Konfektionsarbeit, also Frauenmäntel und so was, für Anatolien. Und das war für mich die schönste Zeit."
Filiz wirft einen forschenden Blick, sie möchte sichergehen, dass ihre Worte auch ankommen. Denn danach, als ihre 'schönste Zeit' endete, beschloss sie, nach Deutschland zu gehen.
"Na ja, und dann habe ich mich gemeldet in Istanbul beim Arbeitsamt. Die Papiere und Untersuchung, das war natürlich sehr problematisch, also unsere Zähne haben sie auch kontrolliert, Röntgenaufnahme von Leber und Urin gemacht, geschaut, ob wir schwanger sind, oder ob wir Diabetikerinnen sind, alles untersucht. Das hat drei, vier Wochen gedauert. Mein Vater oder Mutter, sie wollten nicht hierherkommen, also sie haben sich gewundert, warum ich nach Deutschland gehe. Ich habe alle bürokratischen Sachen vorbereitet und plötzlich habe ich gesagt, wir hatten gerade ein Abendessen: Ich habe meine Papiere vorbereitet, ich gehe bald nach Deutschland. Mein Vater hat gesagt: Bist du hier hungrig? Und dann habe ich gesagt: Nein, nicht wegen Hunger. Abenteuer!

Filiz Teschkün kam 1964 nach Deutschland, vor 32 Jahren organisierte sie erstmals ein Treffen türkischer Frauen.© Deutschlandradio / Ofer Waldmann
Schließlich am 10. November war ich in Istanbul am Sirkeci-Bahnhof. Da waren auch viele Leute. Die Übersetzerin aus dem Arbeitsamt, sie ist auch später hierhergekommen, ich wollte nach München oder in die Nähe von München. Und sie hat mir gesagt: Ach, brauchst du gar nicht nach München gehen, dort sind viele Leute aus der Türkei, und ich habe mich gerade für Berlin angemeldet, ich wollte Montiererin bei Telefunken sein. Und ich schreib dich auf, als Montiererin bei Telefunken, ich komme auch dann nach, zu Siemens. Und so war die Entscheidung für Berlin gefallen. Ich habe nichts dagegen gesagt, kenne ich gar nicht. Entweder München oder Berlin, ist egal, Hauptsache, du gehst nach Deutschland, so oder so."
Im Zug nach Deutschland fuhr Filiz in jenem Winter 1964 zusammen mit Frauen aus allen Bevölkerungsgruppen der Türkei. Gelandet sind sie alle in Berlin, in einem Gastarbeiterinnenwohnheim, das unmittelbar an der Mauer lag, neben dem damals menschenleeren Potsdamer Platz.
"Wir haben armenische Frauen gehabt, und eine jüdische Frau, alle aus Istanbul. Es war so ein Mosaik, Italiener waren auch da. Wohnheim, Stresemannstraße, Hallesches Tor, Kreuzberg, neben dem Willy-Brandt-Haus. Nebenan! Dort war es ganz leer, das Willy-Brandt-Haus ist später gebaut worden, das war ganz leer. Da haben wir alle dasselbe Zimmer gehabt, also so ein Hochbett, und das haben wir auch geteilt."
Im Zug nach Deutschland fuhr Filiz in jenem Winter 1964 zusammen mit Frauen aus allen Bevölkerungsgruppen der Türkei. Gelandet sind sie alle in Berlin, in einem Gastarbeiterinnenwohnheim, das unmittelbar an der Mauer lag, neben dem damals menschenleeren Potsdamer Platz.
"Wir haben armenische Frauen gehabt, und eine jüdische Frau, alle aus Istanbul. Es war so ein Mosaik, Italiener waren auch da. Wohnheim, Stresemannstraße, Hallesches Tor, Kreuzberg, neben dem Willy-Brandt-Haus. Nebenan! Dort war es ganz leer, das Willy-Brandt-Haus ist später gebaut worden, das war ganz leer. Da haben wir alle dasselbe Zimmer gehabt, also so ein Hochbett, und das haben wir auch geteilt."
Kindergarten, Kulturverein, Laden
Ab und zu bittet Filiz um eine kurze Pause, dreht sich eine Zigarette, nutzt die Zeit, um ihre Gedanken – ihre Erinnerungen – zu sortieren. Aus jeder erzählten Geschichte entspringt eine neue, die auch erzählt werden möchte.
Filiz fing als Montiererin und Löterin bei Telefunken in West-Berlin an. Sie heiratete, bekam eine Tochter, ließ sich scheiden und kehrte mit ihrer Tochter zurück in die Türkei. Doch diese wollte nicht ohne ihren Vater, der in Berlin lebte, aufwachsen. Und Filiz zog in die eingemauerte Stadt zurück, diesmal für immer. Allmählich wurde nun aus der einstigen Gastarbeiterin eine Berlinerin.
1979 begann Filiz zuerst in einem Kindergarten zu arbeiten, danach in einem Kulturverein in dem Berliner Arbeiterviertel Wedding. Als dieser geschlossen wurde, eröffnete Filiz in seinen Räumlichkeiten einen Laden für traditionelle Strickereien.
"Die haben gesagt: Filiz, wir wollten hier nicht einen Zeitungsladen haben, du kannst doch hier was machen und wir möchten dich gerne hier haben und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt okay. Ich habe es übernommen, als Handarbeits- und Kunstladen, Filiz‘ Laden haben wir es genannt, zehn Jahre habe ich durchgestanden, schwierige Zeit, ich habe davon nicht gelebt, wollte ich, aber geht ja nicht, die Ecke ist ganz ruhig, keine Kunden, die vorbeikommen, nur Bekannte haben mich immer unterstützt."
Mit ihren Geschichten nimmt mich Filiz mit, an die Orte, die Filiz mit Berlin verbinden, ja, in denen sie die Stadt berührt, geprägt hat. Vor allem das Kreuzberger Stadtteilzentrum, der "Familiengarten", ist so ein Ort – ihn hat sie mitgeprägt, gestaltet, entwickelt. Für sie ist er ein Ort, an dem sich Vergangenheit und Gegenwart auf versöhnliche Weise miteinander verbinden.
Neriman Kurt: "Wir befinden uns hier in dem ehemaligen Schuhhaus von Leiser, die Halle war die Produktionshalle, wo jetzt das Begegnungszentrum, das Stadtteil-Zentrum, ist."
Neriman Kurt ist die Leiterin des Zentrums. Die Mitte-40-Jährige gehört zur zweiten Generation der türkischen Einwanderer. Sie spaziert durch den "Familiengarten", grüßt hier, fragt dort nach der Gesundheit, der Familie, mal auf Deutsch, mal auf Türkisch. Sie kennt die Geschichte des Hauses und zieht dabei wie selbstverständlich die Parallele zu heute.
"Wenn man jetzt bedenkt, dass Leiser als Migrant nach Berlin gekommen ist, hier etwas aufgebaut hat, später enteignet wurde von den Nazis und dieser Ort ganz lange in der Brache lag, unbelebt und eigentlich auch abgerissen werden sollte, durch die Bürgerproteste in den 1980ern konnte das gerettet werden. Und heute haben wir hier Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben, aber natürlich auch uralte Kreuzberger, neuzugezogene Kreuzberger, wir haben hier sozusagen die Tradition von Leiser weitergeführt, mit Migration was Neues schaffen, innovativ sein."
Filiz fing als Montiererin und Löterin bei Telefunken in West-Berlin an. Sie heiratete, bekam eine Tochter, ließ sich scheiden und kehrte mit ihrer Tochter zurück in die Türkei. Doch diese wollte nicht ohne ihren Vater, der in Berlin lebte, aufwachsen. Und Filiz zog in die eingemauerte Stadt zurück, diesmal für immer. Allmählich wurde nun aus der einstigen Gastarbeiterin eine Berlinerin.
1979 begann Filiz zuerst in einem Kindergarten zu arbeiten, danach in einem Kulturverein in dem Berliner Arbeiterviertel Wedding. Als dieser geschlossen wurde, eröffnete Filiz in seinen Räumlichkeiten einen Laden für traditionelle Strickereien.
"Die haben gesagt: Filiz, wir wollten hier nicht einen Zeitungsladen haben, du kannst doch hier was machen und wir möchten dich gerne hier haben und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt okay. Ich habe es übernommen, als Handarbeits- und Kunstladen, Filiz‘ Laden haben wir es genannt, zehn Jahre habe ich durchgestanden, schwierige Zeit, ich habe davon nicht gelebt, wollte ich, aber geht ja nicht, die Ecke ist ganz ruhig, keine Kunden, die vorbeikommen, nur Bekannte haben mich immer unterstützt."
Mit ihren Geschichten nimmt mich Filiz mit, an die Orte, die Filiz mit Berlin verbinden, ja, in denen sie die Stadt berührt, geprägt hat. Vor allem das Kreuzberger Stadtteilzentrum, der "Familiengarten", ist so ein Ort – ihn hat sie mitgeprägt, gestaltet, entwickelt. Für sie ist er ein Ort, an dem sich Vergangenheit und Gegenwart auf versöhnliche Weise miteinander verbinden.
Neriman Kurt: "Wir befinden uns hier in dem ehemaligen Schuhhaus von Leiser, die Halle war die Produktionshalle, wo jetzt das Begegnungszentrum, das Stadtteil-Zentrum, ist."
Neriman Kurt ist die Leiterin des Zentrums. Die Mitte-40-Jährige gehört zur zweiten Generation der türkischen Einwanderer. Sie spaziert durch den "Familiengarten", grüßt hier, fragt dort nach der Gesundheit, der Familie, mal auf Deutsch, mal auf Türkisch. Sie kennt die Geschichte des Hauses und zieht dabei wie selbstverständlich die Parallele zu heute.
"Wenn man jetzt bedenkt, dass Leiser als Migrant nach Berlin gekommen ist, hier etwas aufgebaut hat, später enteignet wurde von den Nazis und dieser Ort ganz lange in der Brache lag, unbelebt und eigentlich auch abgerissen werden sollte, durch die Bürgerproteste in den 1980ern konnte das gerettet werden. Und heute haben wir hier Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben, aber natürlich auch uralte Kreuzberger, neuzugezogene Kreuzberger, wir haben hier sozusagen die Tradition von Leiser weitergeführt, mit Migration was Neues schaffen, innovativ sein."
Den Dialog mit den Kindern ein wenig verpasst
Das Haus mit dem Garten liegt unscheinbar in einem verwinkelten Innenhof. Aus den Fenstern schallen Musik, Lachen, Menschenstimmen. Das Zentrum selbst ist ein großer Raum. An den Wänden hängen Bilder einer Berliner Künstlerin. Kleine Gruppen sitzen verstreut auf einfachen Holzstühlen und Sofas, unterhalten sich leise.
"Es werden immer Geschichten erzählt und diese Geschichten bleiben auch hier im Raum, sie beleben ja auch diesen Raum. Und wie man sieht, hat der Raum ja auch verschiedene Ecken, die auch so bestimmte Erinnerungen hervorrufen, der Samowar oder der Tresen, der halt so auf orientalisch gemacht wird, also das ist wirklich ein Ort, wo ganz viele verschiedene Geschichten und Lebenswelten aufeinander treffen und auch parallel nebeneinander existieren können."
Die Geschichten, die in diesem Raum erzählt werden, beleben ihn also. Ob sie ihn verlassen, nach draußen drängen, gehört werden, ist eine andere Frage. Weil die erste Generation, die sogenannten Gastarbeiter, sicher war, nach einigen Jahren Deutschland wieder zu verlassen, ist ihr die deutsche Sprache oft fremd geblieben. Die Geschichten, die hier erzählt werden, scheitern also oft an Sprachbarrieren. Sowohl beim Erzählen als auch beim Zuhören.
Neriman Kurt führt mich durch den Raum. An einem Tisch sitzen einige ältere türkischstämmige Frauen. Wir setzen uns dazu, Neriman übersetzt.
"Also gerade bei der ersten Generation haben sie den Dialog mit den Kindern ein bisschen verpasst, weil sie hatten eine Vision: schnell Geld verdienen, Haus in der Türkei kaufen oder in ihren Heimatort, ehemaligen Heimatort, und zurückzukehren. Und sie waren damit so sehr beschäftigt, dass die Kinder zu kurz gekommen sind."
Bis auf die wenigen Stimmen, die aus dem Kindergarten nebenan herüberwehen, fehlt hier jede Spur kindlicher Anwesenheit. Keine Spielecke, keine Kinderstühle, keine handgemalten Bilder an der Wand. Die Menschen, die ich hier treffe, sind Großmütter, Großväter. Sie genießen es ein wenig, erzählt Neriman Kurt mit einem Lächeln, hier ein wenig Ruhe vor den Enkeln zu haben. Aber dadurch verpassen die Enkelkinder natürlich auch die Chance, die Geschichten ihrer Großeltern zu hören. Was bei den Kindern begann, setzt sich bei den Enkeln offensichtlich fort.
Tülay: "Ich denke, da gibt es ein Bedürfnis, auch den Kindern zu erzählen, unter welchen Bedingungen sie dort gelebt haben, aber auch hier, was sie für Ziele hatten, ob sie es geschafft haben oder nicht. Viele sind enttäuscht, weil sie denken, ich bin hierhergekommen, habe mich kaputtgearbeitet, und habe jetzt aber auch nichts davon."
Tülay ist eine Berliner Sozialarbeiterin türkischer Herkunft. Sie sitzt in einem Park im Süden Neuköllns; durch die Bäume wehen fröhliche Kinderstimmen vom naheliegenden Spielplatz herüber. Die klein gewachsene Frau wirkt stolz und selbstbewusst. Es ist das Resultat ihrer Kindheit, erzählt sie, die sie bei Verwandten in der Türkei verbracht habe, während ihre Eltern in Deutschland arbeiteten. Mit acht Jahren wurde sie nach Deutschland geholt. Nun bekommt sie durch ihre Arbeit zunehmend Kontakt mit pflegebedürftigen Menschen aus der Generation ihrer Eltern.
Tülay: "Sie haben dieses Land mitaufgebaut. Und sie haben auch Tätigkeiten ausgeführt, die keiner machen wollte. Man durfte Jobs annehmen, erst wenn Deutsche diese nicht machen wollten. Und auch sehr körperlich schwer belastbare Tätigkeiten ausgeübt, das weiß ich, dass das auch im Alter bei meinem Vater zu sehr vielen Krankheiten geführt hat."
Die Geschichten, die in diesem Raum erzählt werden, beleben ihn also. Ob sie ihn verlassen, nach draußen drängen, gehört werden, ist eine andere Frage. Weil die erste Generation, die sogenannten Gastarbeiter, sicher war, nach einigen Jahren Deutschland wieder zu verlassen, ist ihr die deutsche Sprache oft fremd geblieben. Die Geschichten, die hier erzählt werden, scheitern also oft an Sprachbarrieren. Sowohl beim Erzählen als auch beim Zuhören.
Neriman Kurt führt mich durch den Raum. An einem Tisch sitzen einige ältere türkischstämmige Frauen. Wir setzen uns dazu, Neriman übersetzt.
"Also gerade bei der ersten Generation haben sie den Dialog mit den Kindern ein bisschen verpasst, weil sie hatten eine Vision: schnell Geld verdienen, Haus in der Türkei kaufen oder in ihren Heimatort, ehemaligen Heimatort, und zurückzukehren. Und sie waren damit so sehr beschäftigt, dass die Kinder zu kurz gekommen sind."
Bis auf die wenigen Stimmen, die aus dem Kindergarten nebenan herüberwehen, fehlt hier jede Spur kindlicher Anwesenheit. Keine Spielecke, keine Kinderstühle, keine handgemalten Bilder an der Wand. Die Menschen, die ich hier treffe, sind Großmütter, Großväter. Sie genießen es ein wenig, erzählt Neriman Kurt mit einem Lächeln, hier ein wenig Ruhe vor den Enkeln zu haben. Aber dadurch verpassen die Enkelkinder natürlich auch die Chance, die Geschichten ihrer Großeltern zu hören. Was bei den Kindern begann, setzt sich bei den Enkeln offensichtlich fort.
Tülay: "Ich denke, da gibt es ein Bedürfnis, auch den Kindern zu erzählen, unter welchen Bedingungen sie dort gelebt haben, aber auch hier, was sie für Ziele hatten, ob sie es geschafft haben oder nicht. Viele sind enttäuscht, weil sie denken, ich bin hierhergekommen, habe mich kaputtgearbeitet, und habe jetzt aber auch nichts davon."
Tülay ist eine Berliner Sozialarbeiterin türkischer Herkunft. Sie sitzt in einem Park im Süden Neuköllns; durch die Bäume wehen fröhliche Kinderstimmen vom naheliegenden Spielplatz herüber. Die klein gewachsene Frau wirkt stolz und selbstbewusst. Es ist das Resultat ihrer Kindheit, erzählt sie, die sie bei Verwandten in der Türkei verbracht habe, während ihre Eltern in Deutschland arbeiteten. Mit acht Jahren wurde sie nach Deutschland geholt. Nun bekommt sie durch ihre Arbeit zunehmend Kontakt mit pflegebedürftigen Menschen aus der Generation ihrer Eltern.
Tülay: "Sie haben dieses Land mitaufgebaut. Und sie haben auch Tätigkeiten ausgeführt, die keiner machen wollte. Man durfte Jobs annehmen, erst wenn Deutsche diese nicht machen wollten. Und auch sehr körperlich schwer belastbare Tätigkeiten ausgeübt, das weiß ich, dass das auch im Alter bei meinem Vater zu sehr vielen Krankheiten geführt hat."
Kein Ohr für die Geschichten der ersten Generation
Doch nicht nur die sogenannte Mehrheitsgesellschaft hat kein Ohr für die Geschichten der Generation der Gastarbeiter. Auch die eigenen Kinder und Enkelkinder kennen die Geschichten ihrer eigenen Großeltern oft nicht, wie Tülay immer wieder beobachtet. Sie wachsen hier in Deutschland auf und spüren – ob im Schulunterricht, ob in den Medien -, dass die Migrationsgeschichte ihrer Eltern nicht relevant ist. Nicht zählt.
"Weil Migration und diese Themen sehr oft gesellschaftlich unerwünscht sind. Es wird in dieser Gesellschaft nicht gesagt, trotzdem gibt es diese Vorurteile, dann möchte man natürlich nicht darüber reden, dass sie sich nicht trauen, sich damit auseinanderzusetzen und auch zu erkennen, dass da viel geleistet worden ist, auch von den Großeltern, dass das auch mit ihrer eigenen Geschichte ganz viel zu tun hat.
Ich würde mir wünschen, dass das weitergetragen und weitererzählt wird, dass diese Menschen wirklich über ihre Geschichten erzählen, aber auch mit den positiven Aspekten der Migration, mit dem, was sie geschafft haben."
Isidoro: "Die Oase, die ich vor ein paar Wochen entdeckt habe, als ich meinen Freund Ahmed nach Hause gebracht habe, ich nenne sie Ahmeds grüne Gegend."
Isidoro Fernandez Momparler hatte das Papier, auf dem er seine Geschichte schrieb, sorgfältig auseinander gefaltet. Seine Hände sind die eines Arbeiters: 1962 kam der damals 28-jährige Spanier zum Arbeiten nach Deutschland. Nun sitzt der Berliner Pensionär im Begegnungszentrum der Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Hier trifft sich regelmäßig eine Schreibgruppe für Seniorinnen und Senioren ausländischer Herkunft. Isidoros Hände schreiben nun Geschichten; seine Geschichten. Wie die, die er mir jetzt vorliest.
Ich würde mir wünschen, dass das weitergetragen und weitererzählt wird, dass diese Menschen wirklich über ihre Geschichten erzählen, aber auch mit den positiven Aspekten der Migration, mit dem, was sie geschafft haben."
Isidoro: "Die Oase, die ich vor ein paar Wochen entdeckt habe, als ich meinen Freund Ahmed nach Hause gebracht habe, ich nenne sie Ahmeds grüne Gegend."
Isidoro Fernandez Momparler hatte das Papier, auf dem er seine Geschichte schrieb, sorgfältig auseinander gefaltet. Seine Hände sind die eines Arbeiters: 1962 kam der damals 28-jährige Spanier zum Arbeiten nach Deutschland. Nun sitzt der Berliner Pensionär im Begegnungszentrum der Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Hier trifft sich regelmäßig eine Schreibgruppe für Seniorinnen und Senioren ausländischer Herkunft. Isidoros Hände schreiben nun Geschichten; seine Geschichten. Wie die, die er mir jetzt vorliest.
Isidoro: "Ich sah durch die großen Fenster: so eine idyllische Gegend. Wobei das Besondere für mich war ein Baum, an den ich mich aus meiner Kindheit in Spanien gut erinnere. Die Äste waren so schön gemischt, dass ich dachte, in Spanien zu sein."
Nur eine Straße vom AWO-Zentrum entfernt pulsiert Kreuzberg: Das Berliner Viertel, das wie kein anderes die Vielfalt Berlins wiedergibt. Migrantische Läden, Punk-Bars, alternative Öko-Läden, Hipster-Cafés und staunende Touristen.

Die Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg zwischen Oranienplatz und Heinrichplatz© picture alliance / rolf kremming
Dort, wo das AWO-Begegnungszentrum liegt, ist es etwas ruhiger. Das rote Backsteingebäude steht allein, getrennt von anderen Bauten, am Rande einer kleinen Parkanlage und eines kommunalen Kunstzentrums. Vor dem Eingang stehen einige aus Beton gegossene Tischtennistische. Daneben: eine Terrasse, auf der man fast jeden Tag ältere Menschen beim Teetrinken und Plaudern antrifft. Ein einladender Ort.
Isidoro: "Wenn wir lesen für die anderen, muss man sich Mühe geben, dass sie uns verstehen, versuchen wir schon so deutlich zu sein wie möglich. Ich mache noch immer viele Fehler, die deutsche Sprache ist sehr schwer. Mit dem ersten Geld, das ich hatte, habe ich einen Plattenspieler und Bücher gekauft - ‚Deutsch ohne Mühe'. Okay, ich habe gelernt, aber ich war so romantisch und so Idealist und so, wie man es nimmt."
Isidoros Geschichten, die geschriebenen und erzählten, sind voll von Erinnerungen des einst jungen Mannes, der als sogenannter Gastarbeiter hierher gekommen war. Der von Deutschland fasziniert war. Aber erst in dem kleinen Zimmer im AWO-Begegnungszentrum, inmitten der Schreibgruppe, schafft er es, diese Geschichten zu erzählen. Niemand hier ist ein Deutsch-Muttersprachler. Das hilft, denn der unsichere Umgang mit der deutschen Sprache verbindet.
Isidoro: "Ich bin nicht so lange hier, bin 85 Jahre! Ich kam mit 28 Jahren hierher. Weil es damals in Spanien, 1962, wenig Geld für Familie gab, und meine beiden Schwestern waren schon in der Emigration in Deutschland, haben uns ein bisschen Geld geschickt und hofften, ich konnte mit meinem Bruder auch kommen, Geld verdienen und nach Hause schicken. Ich landete da in Göttingen. Und da komme ich da, eine Stille, leblos, wie tot. Und ich hatte meine Freunde und mein ganzes Leben in Madrid, wir sind laut, und das war für mich sehr schmerzhaft."
Isidoro verließ schließlich Göttingen, er wollte nicht mehr am Fließband arbeiten, wollte die große Stadt entdecken. Über mehrere Stationen kam er nach Berlin. Nun sitzt er hier am Tisch und ordnet immer wieder die Seiten, auf denen seine Geschichten geschrieben stehen. Es herrscht eine spürbare Vertrautheit in dem kleinen Raum.
Katharina Ludwig: "Hier geht’s darum, Geschichten zu finden, zu teilen, die auszutauschen, die Worte zu Papier zu bringen und eben auch in die Gruppe zu bringen. Da geht es meistens erst einmal los: Und das ist für mich das Schönste, zu sehen, und auch als Rückmeldung, die kommen dann mit kleinen Ideen oder einem Thema oder einer Frage, und das kann um die eigene Biographie gehen, den Alltag hier in Berlin betreffen."
Isidoro: "Wenn wir lesen für die anderen, muss man sich Mühe geben, dass sie uns verstehen, versuchen wir schon so deutlich zu sein wie möglich. Ich mache noch immer viele Fehler, die deutsche Sprache ist sehr schwer. Mit dem ersten Geld, das ich hatte, habe ich einen Plattenspieler und Bücher gekauft - ‚Deutsch ohne Mühe'. Okay, ich habe gelernt, aber ich war so romantisch und so Idealist und so, wie man es nimmt."
Isidoros Geschichten, die geschriebenen und erzählten, sind voll von Erinnerungen des einst jungen Mannes, der als sogenannter Gastarbeiter hierher gekommen war. Der von Deutschland fasziniert war. Aber erst in dem kleinen Zimmer im AWO-Begegnungszentrum, inmitten der Schreibgruppe, schafft er es, diese Geschichten zu erzählen. Niemand hier ist ein Deutsch-Muttersprachler. Das hilft, denn der unsichere Umgang mit der deutschen Sprache verbindet.
Isidoro: "Ich bin nicht so lange hier, bin 85 Jahre! Ich kam mit 28 Jahren hierher. Weil es damals in Spanien, 1962, wenig Geld für Familie gab, und meine beiden Schwestern waren schon in der Emigration in Deutschland, haben uns ein bisschen Geld geschickt und hofften, ich konnte mit meinem Bruder auch kommen, Geld verdienen und nach Hause schicken. Ich landete da in Göttingen. Und da komme ich da, eine Stille, leblos, wie tot. Und ich hatte meine Freunde und mein ganzes Leben in Madrid, wir sind laut, und das war für mich sehr schmerzhaft."
Isidoro verließ schließlich Göttingen, er wollte nicht mehr am Fließband arbeiten, wollte die große Stadt entdecken. Über mehrere Stationen kam er nach Berlin. Nun sitzt er hier am Tisch und ordnet immer wieder die Seiten, auf denen seine Geschichten geschrieben stehen. Es herrscht eine spürbare Vertrautheit in dem kleinen Raum.
Katharina Ludwig: "Hier geht’s darum, Geschichten zu finden, zu teilen, die auszutauschen, die Worte zu Papier zu bringen und eben auch in die Gruppe zu bringen. Da geht es meistens erst einmal los: Und das ist für mich das Schönste, zu sehen, und auch als Rückmeldung, die kommen dann mit kleinen Ideen oder einem Thema oder einer Frage, und das kann um die eigene Biographie gehen, den Alltag hier in Berlin betreffen."
Eine Wienerin gründete die Schreibgruppe
So die Autorin und freie Journalistin Katharina Ludwig. Sie hat die Gruppe vor eineinhalb Jahren initiiert und leitet sie bis heute. Als Wienerin, die in Berlin ihre Heimat fand, weiß sie um die Schwierigkeiten der Migration. Auch wenn sie, durch Bildung und Herkunft, eine privilegierte Migrantin ist. Sie wollte einen Raum schaffen, in dem alte Menschen mit Migrationshintergrund ihre Geschichten erzählen können.
"Also das macht irgendwo so einen Umgang miteinander zärtlicher und vorsichtiger, man ist auch verletzlicher, manchmal sind das ja auch sehr persönliche Sachen, die man teilt. Es ist ein Nachbarschaftszentrum, ein Begegnungszentrum hier, dieser Ort, an dem wir uns treffen."
Das AWO-Begegnungszentrum ist in seiner Nachbarschaft fest verankert und spiegelt die Vielfalt der Bewohner Kreuzbergs wieder. Am Eingang hängt ein Plakat mit dem Wort "Hallo" in Dutzenden von Sprachen. Hier treffen sich Gruppen aller Nationalitäten, und auch sonstige Gruppierungen, die Kreuzberg ausmachen. Es wird gesungen, gemalt, diskutiert – und eben auch geschrieben.
"Da gibt es natürlich einen ganzen Fundus von Geschichten, wie sich an dem Ort schon alles geändert hat, entwickelt, und jetzt auch weiter ändert. Und was hier auch schon oft Thema ist: man ist eigentlich am selben Ort, wo man vielleicht Mal angekommen ist, nachdem man so eine Wanderung schon mitgemacht oder durchgemacht hat, und dann ist da so ganz viel Dynamik um einen herum und es ist ganz schwer, sich an etwas festzuhalten. Oder ganz einfach auch, man selber wird ein bisschen älter, der Körper ändert sich, um einen herum sind viel mehr junge Leute, was macht es mit dem Alltag und auch mit dem Gefühl, wie man sich durch die Stadt bewegt, wie sicher man sich fühlt, wie willkommen man sich fühlt, wie sichtbar man sich fühlt."
Tülay: "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass diese Menschen, vor allem die älteren Menschen mit Migrationshintergrund, viel zu erzählen haben und auch ganz viel von ihren Potenzialen berichtet haben."
Sagt mir Tülay, die Sozialarbeiterin türkischer Herkunft, nachdem ich ihr von meinen frustrierenden Erlebnissen erzählt habe. Ich ging nämlich durch Kreuzberg und Neukölln, durch Straßencafés und Parkanlagen, und habe versucht, mit älteren Menschen, die durch Sprache und Auftreten als ehemalige Migranten zu erkennen waren, ins Gespräch zu kommen. Sie nach ihrer Migrationsgeschichte zu fragen. Überall wurde ich höflich, aber entschieden abgewiesen.
Tülay: "Es ist auch nicht so, dass jeder, egal welcher Herkunft, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, über seine privaten Geschichten jedem erzählen möchte. Das braucht Vertrauen. Die sind aufgebrochen in ein Land, wo sie die Sprache nicht konnten, mutig, flexibel, anpassungsfähig, immer wieder, und nicht so geblieben, wie sie vor 50, 60 Jahren gekommen sind, sie haben sich eigentlich wider den Vorstellungen der hiesigen Gesellschaft immer wieder gewandelt, angepasst. Es wollte auch keiner, lange Jahre wollte keiner deren Stimme hören."

AWO-Begegnungszentrum: Begrüßt wird hier in vielen Sprachen.© Deuschlandradio: Ofer Waldman
Kein Anker für die Erinnerungen
Die Leerstelle, die dadurch entstand, hatte zwei Seiten: Einerseits fanden diese Menschen keinen Anker für ihre Erinnerungen – und damit kein Zuhause. Andererseits konnten die Medien so auch ein verzerrtes Bild älterer Migranten entwerfen, sagt Tülay.
"Weil die Erfahrungen - insbesondere mit Medien - zeigen sehr oft, dass die Medien sehr einseitig über ältere Menschen mit Migrationshintergrund oder überhaupt Migrantinnen berichten, mit Vorbehalten, mit Vorverurteilungen, und sehr viel auch problembehaftete Themen oft aufgreifen, und gar nicht auf die Ressourcen und die positiven Seiten ihres Lebens eingehen. Und ich denke, das ist das eine, was eine Rolle spielt, das andere ist, dass Menschen, vor allem ältere Menschen mit Migrationshintergrund, sehr wohl das Bedürfnis haben, über ihre Geschichte zu erzählen, ihre Lebensgeschichte, über ihre Migrationserfahrung, über die Erfahrung hier, weil sie ein Teil unserer Gesellschaft sind, keine Randgruppe, sondern zu dieser Gesellschaft gehören."
Die Schreibgruppe im Begegnungszentrum der Arbeiterwohlfahrt ist ein Ort, wo die Menschen sich trauen, ihre Geschichten aufzuschreiben und zu erzählen. So wie Dagmar Lasocki.
Dagmar: "Ich habe zum Geburtstag eine Puppe gekriegt, sie heißt Maja, ich hatte immer Freude, wenn ich mit ihr spielen konnte."
Dagmar, geboren in Warschau nach dem Zweiten Weltkrieg, liest aus einem Heft, in dem sie diese und andere Geschichten aus ihrer Kindheit festgehalten hat.
"Eines Tages ging ich spazieren mit dem Puppenwagen und Maja. Mir wurde die Puppe gestohlen, ich habe schrecklich geweint und sie vermisst, ich habe nie wieder eine Puppe bekommen. Ich konnte mit keiner anderen Puppe spielen, bis heute, ich habe die schöne Kleidung meiner Puppe in Erinnerung, vielleicht würde ich meiner Enkelin eine Puppe schenken und ihr erzählen, wie das war, als ich eine Puppe hatte und was mit ihr passiert war."
Warschau Ende der 40er Jahre, die Puppe Maja, deren schöne Kleidung, ihr eigenes Weinen über den Verlust – das alles schafft einen Erinnerungsort, einen Anker für das Gedächtnis, auch bei den anderen, die ihr zuhören. Dies gilt vor allem für die Hoffnung, ihrer eigenen Enkelin durch die Puppe eines Tages über die eigene Kindheit erzählen zu können. Indem sie die Geschichte ihrer vertrauten Schreibgruppe vorliest, anfangs noch etwas schüchtern, wird sie auch zur Geschichte der anderen und – irgendwie – Teil des Kreuzberger AWO-Begegnungszentrums.
Dagmar: "Ich vermute, durch diese Geschichten, die Menschen geschrieben haben, dass es Teil von der Geschichte von Berlin wird, von den Leuten, die aus fremden Ländern gekommen sind. Du kannst ihr Leben durch die Geschichte besser kennen, die Mentalität von den Deutschen, ein Teil der Geschichte von Deutschland, von Berlin sein. Und dadurch kann es auch interessant sein, wie viele Nationalitäten es doch in Berlin gibt. Jeder in Deutschland hat seine Geschichte, seine Kultur."
Ihre Zuversicht hat Dagmar nicht verloren. Auch wenn sie es nicht einfach hatte, hier in Berlin, anzukommen.
"Das war schwer hier, die ersten Schritte zu machen, die Sprache zu beherrschen und dann neues Leben anzufangen. Aber trotzdem sage ich, das Leben ist wirklich schön, ich war eigentlich viele Jahre geschlossen im politischen System und von zu Hause, ich konnte nicht frei denken, machen, was ich will. Jetzt weiß ich, dass ich lebe, ich kann machen, was ich will, ich bin nicht abhängig von niemand, nicht von dem System, nicht von zu Hause, oder Ehemann, ich kann machen, was ich will, ich kann denken, wie ich will und das war ein schönes Gefühl, als ich es zum ersten Mal erfahren habe."
Die Schreibgruppe im Begegnungszentrum der Arbeiterwohlfahrt ist ein Ort, wo die Menschen sich trauen, ihre Geschichten aufzuschreiben und zu erzählen. So wie Dagmar Lasocki.
Dagmar: "Ich habe zum Geburtstag eine Puppe gekriegt, sie heißt Maja, ich hatte immer Freude, wenn ich mit ihr spielen konnte."
Dagmar, geboren in Warschau nach dem Zweiten Weltkrieg, liest aus einem Heft, in dem sie diese und andere Geschichten aus ihrer Kindheit festgehalten hat.
"Eines Tages ging ich spazieren mit dem Puppenwagen und Maja. Mir wurde die Puppe gestohlen, ich habe schrecklich geweint und sie vermisst, ich habe nie wieder eine Puppe bekommen. Ich konnte mit keiner anderen Puppe spielen, bis heute, ich habe die schöne Kleidung meiner Puppe in Erinnerung, vielleicht würde ich meiner Enkelin eine Puppe schenken und ihr erzählen, wie das war, als ich eine Puppe hatte und was mit ihr passiert war."
Warschau Ende der 40er Jahre, die Puppe Maja, deren schöne Kleidung, ihr eigenes Weinen über den Verlust – das alles schafft einen Erinnerungsort, einen Anker für das Gedächtnis, auch bei den anderen, die ihr zuhören. Dies gilt vor allem für die Hoffnung, ihrer eigenen Enkelin durch die Puppe eines Tages über die eigene Kindheit erzählen zu können. Indem sie die Geschichte ihrer vertrauten Schreibgruppe vorliest, anfangs noch etwas schüchtern, wird sie auch zur Geschichte der anderen und – irgendwie – Teil des Kreuzberger AWO-Begegnungszentrums.
Dagmar: "Ich vermute, durch diese Geschichten, die Menschen geschrieben haben, dass es Teil von der Geschichte von Berlin wird, von den Leuten, die aus fremden Ländern gekommen sind. Du kannst ihr Leben durch die Geschichte besser kennen, die Mentalität von den Deutschen, ein Teil der Geschichte von Deutschland, von Berlin sein. Und dadurch kann es auch interessant sein, wie viele Nationalitäten es doch in Berlin gibt. Jeder in Deutschland hat seine Geschichte, seine Kultur."
Ihre Zuversicht hat Dagmar nicht verloren. Auch wenn sie es nicht einfach hatte, hier in Berlin, anzukommen.
"Das war schwer hier, die ersten Schritte zu machen, die Sprache zu beherrschen und dann neues Leben anzufangen. Aber trotzdem sage ich, das Leben ist wirklich schön, ich war eigentlich viele Jahre geschlossen im politischen System und von zu Hause, ich konnte nicht frei denken, machen, was ich will. Jetzt weiß ich, dass ich lebe, ich kann machen, was ich will, ich bin nicht abhängig von niemand, nicht von dem System, nicht von zu Hause, oder Ehemann, ich kann machen, was ich will, ich kann denken, wie ich will und das war ein schönes Gefühl, als ich es zum ersten Mal erfahren habe."
Aufbruch und Heimat: das Schreiben eröffnet Zugänge
Für Dagmar war der Gang nach Berlin eine Befreiung: aus dem kommunistischen Polen, aus Enge und Zwang, in eine unbekannte Freiheit. Diese Gedanken und Gefühle blieben eingekapselt, bis Dagmar die Schreibgruppe fand.
Ich denke nach, frage mich: Welchen Platz haben sogenannte Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in der Geschichte, die die bundesdeutsche Gesellschaft sich selber erzählt? Welche Bilder hat man vor Augen, wenn man in Deutschland über sie nachdenkt? In der Regel sind es nur wenige, anonymisierte Anhaltspunkte: Anwerbung im Herkunftsland, ob in Spanien, Italien oder in der Türkei. Jahrelange Arbeit in deutschen Fabriken, als Putzfrauen, als Straßenfeger. Dann, als nächstes: Begriffe wie Migrationshintergrund, Parallelgesellschaft, Radikalisierung und Fanatismus.
Ich denke nach, frage mich: Welchen Platz haben sogenannte Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in der Geschichte, die die bundesdeutsche Gesellschaft sich selber erzählt? Welche Bilder hat man vor Augen, wenn man in Deutschland über sie nachdenkt? In der Regel sind es nur wenige, anonymisierte Anhaltspunkte: Anwerbung im Herkunftsland, ob in Spanien, Italien oder in der Türkei. Jahrelange Arbeit in deutschen Fabriken, als Putzfrauen, als Straßenfeger. Dann, als nächstes: Begriffe wie Migrationshintergrund, Parallelgesellschaft, Radikalisierung und Fanatismus.
Ludwig: "Das ist auch eine wichtige Erfahrung, dass es eine friedliche Möglichkeit gibt, diese Vielheit nebeneinander und auch miteinander auszutauschen, aber auch für sich stehen zu lassen. Also es hat jeder seine eigene Geschichte, die man aufgeschrieben hat, wir lesen die vor, man kann natürlich auch diskutieren darüber. Aber wir müssen nicht alles auf eine Seite bringen und zu einer Geschichte machen. Gerade in Zeiten, wenn Sprache als Sanktionsmittel, als Strafe, als Ausgrenzungsmittel missbraucht wird, muss man sagen, dass es wichtig ist, Orte zu haben, an denen du sagen kannst, wir treffen uns, wir haben gemeinsame Sprachen, mit denen wir uns verständigen können, die sind offen, die können bereichert werden, können wachsen, wachsen an Bildern und Assoziationen, und werden reicher dadurch."
Südstern, eine U-Bahnstation auf der Grenze zwischen Berlin Kreuzberg und Neukölln, den zwei Berliner Bezirken, die zusammen mit Wedding durch Migration am stärksten geprägt wurden. Zwei Fußminuten davon entfernt ragt eine große, stattliche Kirche – Heimat für die polnische katholische Community in Berlin.
Auf dem Balkon probt der Chor die letzten Passagen für die feierliche Messe: Heute wird nämlich der Geburtstag des Kirchenpatrons, Johannes des Täufers, gefeiert.
Südstern, eine U-Bahnstation auf der Grenze zwischen Berlin Kreuzberg und Neukölln, den zwei Berliner Bezirken, die zusammen mit Wedding durch Migration am stärksten geprägt wurden. Zwei Fußminuten davon entfernt ragt eine große, stattliche Kirche – Heimat für die polnische katholische Community in Berlin.
Auf dem Balkon probt der Chor die letzten Passagen für die feierliche Messe: Heute wird nämlich der Geburtstag des Kirchenpatrons, Johannes des Täufers, gefeiert.
Drei volle Gottedienste am Sonntag
So wie im Publikum sind auch im Chor viele junge Menschen, darunter zwei, manchmal drei Generationen aus derselben Familie.
Die Kirche als ein Ort, wo die polnische Kultur gelebt wird? Jedenfalls gehen so viele Polen, die nach der türkischstämmigen Community die zweitgrößte Migrantengruppe in Berlin bilden, hierher, dass jeden Sonntag gleich mehrere Messen stattfinden müssen.
Pater Marek, Leiter der Gemeinde, erzählt.
"Diese Kirche ist nicht ganz voll, aber erster Gottesdienst 600, zweiter Gottesdienst 800, 900 Leute und am Abend dann 500, 600 Leute, die besuchen und zusammen beten wollen. Etwas bekommen zum geistigen Leben, aber auch, was brauchen wir zum Leben in Berlin als Migranten."
Der katholische Glauben ist seit jeher ein fester Bestandteil der polnischen Nation. Vielleicht gibt er in Berlin, fern der Heimat, nochmal anders Halt? Die Chorsängerin, die ich das in der Pause frage, bejaht:
"Ich bin Polin und katholisch, und hatte auch sehr gute Führung, ich meine, also ich kann schon lernen, das ist auch sehr interessant, und ich glaube, mein Blut ist darin, irgendwie, mein Glaube, meine Liebe, also, alles, was ich bin."
Die Kirche als ein Ort, wo die polnische Kultur gelebt wird? Jedenfalls gehen so viele Polen, die nach der türkischstämmigen Community die zweitgrößte Migrantengruppe in Berlin bilden, hierher, dass jeden Sonntag gleich mehrere Messen stattfinden müssen.
Pater Marek, Leiter der Gemeinde, erzählt.
"Diese Kirche ist nicht ganz voll, aber erster Gottesdienst 600, zweiter Gottesdienst 800, 900 Leute und am Abend dann 500, 600 Leute, die besuchen und zusammen beten wollen. Etwas bekommen zum geistigen Leben, aber auch, was brauchen wir zum Leben in Berlin als Migranten."
Der katholische Glauben ist seit jeher ein fester Bestandteil der polnischen Nation. Vielleicht gibt er in Berlin, fern der Heimat, nochmal anders Halt? Die Chorsängerin, die ich das in der Pause frage, bejaht:
"Ich bin Polin und katholisch, und hatte auch sehr gute Führung, ich meine, also ich kann schon lernen, das ist auch sehr interessant, und ich glaube, mein Blut ist darin, irgendwie, mein Glaube, meine Liebe, also, alles, was ich bin."
Auf dem Platz neben der Kirche weht die weiß-gelbe Flagge der katholischen Kirche. Der Boden, auf dem die Kirche steht, gehört nämlich dem Vatikanstaat. Verlässt man also Deutschland, wenn man das Kirchengelände betritt?
Chorsängerin: "Ich glaube, das ist nicht zwei verschiedene, sondern das ist eine Welt und das befindet sich hier. Das ist so, dass ich bin hier, ich lebe hier und ich liebe das Land, also Deutschland, aber ich bin Polin und ich liebe auch Polen, also das ist so zwei in eins."
Doch auch jenseits der Kirche wird die polnische Kultur in Berlin gelebt.
Ich gehe noch einmal ins Zentrum der Arbeiterwohlfahrt, denn hier trifft sich auch eine Gruppe älterer Polinnen und Polen. Sie tagt im großen Saal. An den Wenden kleine Bastelarbeiten der unterschiedlichen Gruppen, die sich hier treffen. Plastikschüsseln mit polnischem Essen werden herumgereicht, dazu Becher mit Wein.
Es sind fast ausschließlich Frauen, die sich hier treffen. Rentnerinnen. Ein älterer Herr sitzt dabei und genießt offensichtlich seinen Minderheitenstatus. Alle treffen sich lieber hier, im AWO-Zentrum, als in der Kirche.
Ich frage nach dem Namen, nach der Biographie, nach Deutschland.
Szczupakowski: "Warum? Enkelkinder sind gekommen, meine Kinder sind gekommen, und ich bin mit meinem Mann alleine geblieben in Polen. Das war so ein paar Jahre, naja, und ich bin mit meinem Mann gekommen."
Oft zog man den Kindern, dem Ehepartner, hinterher nach Berlin, weg aus der vertrauten Umgebung in die Fremde. Doch diese Fremde wird mit den Jahren vertraut.
Szczupakowski: "Sehen Sie, komisch ist das. Wenn man spricht über Polen, sagt man zu Hause, und wenn man spricht über Deutschland, ist es auch zu Hause. Viele sprechen so."
Das eine Zuhause bedeutet Alltag, mit all seinen Höhen und Tiefen. Das andere, ferne, wird teils kritisiert, doch immer wieder auch verklärt.

Blick in die Kirche am Kreuzberger Südstern, der Heimat der polnischen katholischen Community; sie steht auf einem Grundstück des Vatikanstaats.© Deutschlandradio / Ofer Waldman
Szczupakowski: "Sind solche Sachen hier in Deutschland, die sind nicht gut. Die Familie ist nicht so zusammen wie in Polen. Jeder hat gewohnt bei Oma und Opa und alle zusammen, nicht? Alles wurde gefeiert mit der Familie, hier nicht."
Kreuzberg, Neukölln – die zwei Bezirke, ehemals West-Berlin, wo Migranten am sichtbarsten präsent sind. Neben dem Familiengarten und dem AWO-Zentrum gibt es zahlreiche kleine Orte in diesen Berliner Bezirken, wo man sich begegnen, sich Geschichten erzählen kann. Tülay, die Sozialarbeiterin, besucht diese Orte oft im Rahmen ihrer Arbeit.
Tülay: "Viele, wenn sie älter werden, am Kottbusser Tor hier sind bestimmte Plätze, da sitzen die, in Neukölln auch, da sitzen sie auf ihren Bänken, wenn sie bestimmte Cafés, so Männercafés oder auch Bäckereien, da sitzen auch viel mehr ältere Menschen jetzt, teilweise auch vereinsamt."
Kreuzberg, Neukölln – die zwei Bezirke, ehemals West-Berlin, wo Migranten am sichtbarsten präsent sind. Neben dem Familiengarten und dem AWO-Zentrum gibt es zahlreiche kleine Orte in diesen Berliner Bezirken, wo man sich begegnen, sich Geschichten erzählen kann. Tülay, die Sozialarbeiterin, besucht diese Orte oft im Rahmen ihrer Arbeit.
Tülay: "Viele, wenn sie älter werden, am Kottbusser Tor hier sind bestimmte Plätze, da sitzen die, in Neukölln auch, da sitzen sie auf ihren Bänken, wenn sie bestimmte Cafés, so Männercafés oder auch Bäckereien, da sitzen auch viel mehr ältere Menschen jetzt, teilweise auch vereinsamt."
Viele Straßen sind ständig im Wandel
Es sind Orte, die Tülay aus der eigenen Kindheit kennt; die zu ihrer Kindheitslandschaft gehören.
Tülay: "Früher waren es die Hinterhöfe, Parks, überhaupt die Orte, wo sich Familien getroffen haben, Hasenheide zum Beispiel kenne ich ganz gut, da waren ganz viele türkische Familien, das hat sich gewandelt, wobei dann auch wieder neue Läden dazugekommen sind, also durch die Migration, Geflüchtete, Sonnenallee zum Beispiel. Es gibt ganz viele Straßen, die ständig im Wandel sind, jetzt kommen da hippe Cafés hin, hier ändert sich natürlich auch, ändern sich die Wohnquartiere und auch die Menschen, die dort leben."
Die steigenden Mieten, die sogenannte Gentrifizierung, verändern die Bezirke, die von Migranten und Migrantinnen einst geprägt wurden, rapide. Sind also diese Berliner Orte, deren Zuhause sie mal waren, die Spuren, die sie dort hinterließen, im Begriff zu verschwinden?
Tülay: "Früher waren es die Hinterhöfe, Parks, überhaupt die Orte, wo sich Familien getroffen haben, Hasenheide zum Beispiel kenne ich ganz gut, da waren ganz viele türkische Familien, das hat sich gewandelt, wobei dann auch wieder neue Läden dazugekommen sind, also durch die Migration, Geflüchtete, Sonnenallee zum Beispiel. Es gibt ganz viele Straßen, die ständig im Wandel sind, jetzt kommen da hippe Cafés hin, hier ändert sich natürlich auch, ändern sich die Wohnquartiere und auch die Menschen, die dort leben."
Die steigenden Mieten, die sogenannte Gentrifizierung, verändern die Bezirke, die von Migranten und Migrantinnen einst geprägt wurden, rapide. Sind also diese Berliner Orte, deren Zuhause sie mal waren, die Spuren, die sie dort hinterließen, im Begriff zu verschwinden?
Sozialarbeiterin Tülay: "Es ist so, dass wir feststellen, dass viele ältere Menschen, insbesondere in Kreuzberg Neukölln, auch in Mitte mittlerweile aus den Wohnungen vertrieben werden, wo sie eigentlich alt geworden sind, das waren Wohnungen, da wollte keiner damals wohnen, auch Deutsche nicht, weil das waren heruntergekommene Wohnungen, die haben sie aufgebaut, da haben sie jahrelang gewohnt. Jetzt weil die Innenbezirke so attraktiv und lukrativ geworden sind, werden die langsam aus ihren Quartieren vertrieben."
Diese Welle der Veränderung trifft auf Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte. Menschen, die es sich nicht leisten können, in ihren nun hipp gewordenen Wohnvierteln zu bleiben.
Neriman Kurt, die Leiterin des Familiengartens, ist jedenfalls gekränkt, weil der Bezirk, einst von der eigenen Elterngeneration gestaltet, sich verwandelt, unkenntlich wird.
"Also diese Vielfalt, womit Kreuzberg ja auch immer gepriesen wird, und vermarktet wird, die entwickelt sich immer mehr zu einer Monokultur. Wir haben hier eine Kneipe nach der anderen, die sehen sich alle gleich, sind wie aus dem Ei gepellt, also diese bestimmte Kultur mit rauen Wänden und so weiter. Das sind auch keine Kreuzberger mehr, die in die Kneipen gehen, Menschen, die mit dem Ort hier nichts zu tun haben, von außen kommen, hier konsumieren, Strukturen, Netzwerke zerstören und gehen. Und das ist die Parallelgesellschaft, und die erleben wir hier auf der Oranienstraße vehement."
Was wird also von den Spuren, die die Migrationswellen der letzten Jahrzehnte in Berlin hinterlassen haben, übrigbleiben? Werden die Orte unkenntlich? Bleiben am Ende vielleicht doch nur die Geschichten, die hier erzählt wurden?
Im AWO-Begegnungszentrum wird eine weitere Runde Wein herumgereicht. Und dann, plötzlich, dreht sich das Gespräch: Ich werde vom Interviewer zum Interviewten.
"Wo sind Sie geboren?"
"Jerusalem."
"Oh! Schön!"
"Dann wird Jerusalem für Sie… es wird für Sie ein Erinnerungsort."
Ja, welche Geschichten erzähle ich meinen eigenen Kindern über meine Jerusalemer Heimat? Und inwieweit prägen diese Geschichten die Stadt Berlin? Durch die hebräischen, fremdartigen Buchstaben an unserer Haustür? Durch die hebräischen Worte, die die Freunde meiner Kinder von ihnen aufschnappen und mit schwerem, deutschen Akzent aussprechen? Ich bin der Migrationshintergrund meiner Kinder.
Menschen wie die, die hier zu Wort kamen, sind es auch. Die Orte, die diese Deutschlandrundfahrt besucht hat – das AWO-Begegnungszentrum, die katholische Kirche, der Familiengarten, aber auch Straßencafés und Parkbänke – sind wie kleine Fenster in andere Zeiten, in andere Welten. Sie liegen alle nah beieinander; doch die Orte, von denen sie erzählen, liegen tausende Kilometer von Berlin – und voneinander – entfernt. Eine deutsche Migrationsgeschichte wird erzählt. Und lässt neue deutsche Erinnerungsorte entstehen.
Nicht zufällig liegen die Worte "gehört" und "gehören" nah beieinander. Man gehört dazu, wenn man gehört wird. Wie die Sozialarbeiterin Tülay betont, wollen diese Menschen, dass ihre Geschichten gehört werden. Wie sie aus Abenteuerlust, aus Not, aus Neugier, aus Geldzwang, in dieses Land kamen. Wie sie Deutschland mitaufgebaut und geprägt haben. Und wie es für sie ein Zuhause wurde.
Welche Zukunft haben jedoch solche Orte des Gehört-Werdens in Zeiten zunehmender Polarisierung, von immer offener werdendem Rassismus? Wieso müssen überhaupt Menschen, die den Wohlstand dieser Gesellschaft mitgeschaffen haben, um das Gehör dieser Gesellschaft bitten? Müssen sie das überhaupt?
Ihre Geschichten liegen da: Auf das Zuhören kommt es an.
Diese Welle der Veränderung trifft auf Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte. Menschen, die es sich nicht leisten können, in ihren nun hipp gewordenen Wohnvierteln zu bleiben.
Neriman Kurt, die Leiterin des Familiengartens, ist jedenfalls gekränkt, weil der Bezirk, einst von der eigenen Elterngeneration gestaltet, sich verwandelt, unkenntlich wird.
"Also diese Vielfalt, womit Kreuzberg ja auch immer gepriesen wird, und vermarktet wird, die entwickelt sich immer mehr zu einer Monokultur. Wir haben hier eine Kneipe nach der anderen, die sehen sich alle gleich, sind wie aus dem Ei gepellt, also diese bestimmte Kultur mit rauen Wänden und so weiter. Das sind auch keine Kreuzberger mehr, die in die Kneipen gehen, Menschen, die mit dem Ort hier nichts zu tun haben, von außen kommen, hier konsumieren, Strukturen, Netzwerke zerstören und gehen. Und das ist die Parallelgesellschaft, und die erleben wir hier auf der Oranienstraße vehement."
Was wird also von den Spuren, die die Migrationswellen der letzten Jahrzehnte in Berlin hinterlassen haben, übrigbleiben? Werden die Orte unkenntlich? Bleiben am Ende vielleicht doch nur die Geschichten, die hier erzählt wurden?
Im AWO-Begegnungszentrum wird eine weitere Runde Wein herumgereicht. Und dann, plötzlich, dreht sich das Gespräch: Ich werde vom Interviewer zum Interviewten.
"Wo sind Sie geboren?"
"Jerusalem."
"Oh! Schön!"
"Dann wird Jerusalem für Sie… es wird für Sie ein Erinnerungsort."
Ja, welche Geschichten erzähle ich meinen eigenen Kindern über meine Jerusalemer Heimat? Und inwieweit prägen diese Geschichten die Stadt Berlin? Durch die hebräischen, fremdartigen Buchstaben an unserer Haustür? Durch die hebräischen Worte, die die Freunde meiner Kinder von ihnen aufschnappen und mit schwerem, deutschen Akzent aussprechen? Ich bin der Migrationshintergrund meiner Kinder.
Menschen wie die, die hier zu Wort kamen, sind es auch. Die Orte, die diese Deutschlandrundfahrt besucht hat – das AWO-Begegnungszentrum, die katholische Kirche, der Familiengarten, aber auch Straßencafés und Parkbänke – sind wie kleine Fenster in andere Zeiten, in andere Welten. Sie liegen alle nah beieinander; doch die Orte, von denen sie erzählen, liegen tausende Kilometer von Berlin – und voneinander – entfernt. Eine deutsche Migrationsgeschichte wird erzählt. Und lässt neue deutsche Erinnerungsorte entstehen.
Nicht zufällig liegen die Worte "gehört" und "gehören" nah beieinander. Man gehört dazu, wenn man gehört wird. Wie die Sozialarbeiterin Tülay betont, wollen diese Menschen, dass ihre Geschichten gehört werden. Wie sie aus Abenteuerlust, aus Not, aus Neugier, aus Geldzwang, in dieses Land kamen. Wie sie Deutschland mitaufgebaut und geprägt haben. Und wie es für sie ein Zuhause wurde.
Welche Zukunft haben jedoch solche Orte des Gehört-Werdens in Zeiten zunehmender Polarisierung, von immer offener werdendem Rassismus? Wieso müssen überhaupt Menschen, die den Wohlstand dieser Gesellschaft mitgeschaffen haben, um das Gehör dieser Gesellschaft bitten? Müssen sie das überhaupt?
Ihre Geschichten liegen da: Auf das Zuhören kommt es an.