Ein Rütli-Schwur wäre fällig
Händeringen überall. Aber was lehrt uns der Fall Rütli-Schule? Inzwischen hat der unglaubliche Vorgang des Hilferufs eines ganzen Lehrer-Kollegiums weite Kreise gezogen und seine unterschiedlichen Seiten hervorgekehrt. Man sieht bestürzt, wie viel hier zusammenkommt.
An dem Anlass des Hilferufs ist nichts zu beschönigen. In diesem Fall hat sich ein Abgrund an sozialer Fehlentwicklung und politischem Versagen aufgetan. Niemand wird, niemand hat den Lehrern, die zur Notbremse gegriffen haben, sein Verständnis versagen. Aber ein Moment der Kapitulation vor der Lage ist auch dabei. Das gilt für das Kollegium selbst, aber auch für die Schulverwaltung. Man fragt sich, wie solche Zustände an einer Schule einreißen konnten, ohne dass das Kollegium oder einzelne Lehrer in irgendeiner von außen wahrnehmbaren Weise darauf reagiert hätten. Aber man steht auch ratlos vor dem Umstand, dass der Brief mit seinem alarmierenden Inhalt einen runden Monat in der Welt sein konnte, bis die Veröffentlichung in einer Zeitung ihn vor die Augen des zuständigen Senators und seiner Verwaltung brachte.
Dass die Situation an der Neuköllner Schule kein Fall ist, der ganz jenseits des Schulalltags liegt, macht die Sache nicht besser. Aber immerhin profiliert er das Problem und lenkt den Blick von der lokalen Ebene auf die der Entwicklung jenseits der Rütli-Schule. Da stößt er zunächst auf eine bestürzende Schicht von Gewöhnung und Resignation, die sich wie ein Schutzmantel um die Konflikte gelegt hat, so dass dann alarmierend neu erscheint, was es keineswegs ist. Nur der Skandal ist offenbar in der Lage, diese Schicht zu durchbrechen. Das betrifft den Schulbetrieb insgesamt, nicht zuletzt die Schulaufsicht, und reicht bis in die Fragen des Schulsystems hinein – der Abstieg der Hauptschule zur Rest-Schule wird seit Jahren beklagt.
Es ist auch richtig, dass die Kritik und das Nachdenken über die Konsequenzen, die zu ziehen sind, hier ansetzen. Sprachförderung, sozialpädagogische Betreuung, schärfere Reaktionen – Lehrern, Schülern und Eltern wird nicht geholfen, wenn nicht überlegt wird, was konkret und vor Ort verbessert werden kann. Aber das Echo zeigt auch, dass die Wirkung dieses Vorfalls tiefer reicht. Es kann gar nicht bezweifelt werden, dass der Hilfeschrei des Kollegiums dieser Schule gezeigt hat, wie weit wir es gebracht haben – in Sachen jugendlicher Fehlentwicklung, mangelnder Integration, sozialer Problemzonen, vielmehr: wie weit sie uns misslungen sind.
Dieser Vorgang ist eine Frage an uns, an unsere Gesellschaft, an die Politik, die sie betreibt oder erlaubt. Er spitzt zu, was an Problemen seit langem auf uns eindringt. Der ganze Komplex von Migration, Integration, sozialem Außenseitertum liegt damit auf dem Tisch, untrennbar verwickelt mit der Debatte um Erziehung und soziales Verhalten, um die Bedeutung von Regeln und Werten. Es spricht vieles dafür, dass der Hintergrund nicht zuletzt die soziale Ghettoisierung von Ausländern ist – es ist die soziale Perspektivlosigkeit, die zu asozialem Verhalten führt. Aber ein Blick nach Neukölln belehrt darüber, dass die kulturelle Selbst-Ghettoisierung vieler Ausländerfamilien ihren Teil dazu beiträgt. Die Gewaltbereitschaft, die daraus erwächst, hat die Lehrer in die Defensive und in die Resignation gebracht.
Aber man wird doch zumindest fragen dürfen, ob dazu nicht eine bis an den Rand der Gleichgültigkeit reichende Toleranz beigetragen hat, die gar nicht mehr wagt, Grenzen zu setzen und auf Regeln zu beharren. Wie überhaupt zu fragen ist, ob hinter der Kapitulation der Lehrerschaft vor der unhaltbaren Situation nicht die zumindest partielle Kapitulation der Gesellschaft steht, auf ihren Überzeugungen zu beharren. Selbst an dem leidigen Streit um die Leitkultur ist aus Anlass dieser Debatte kaum vorbeizukommen. Denn irgendwie ist auch er ein Exempel für das Scheitern der Vorstellung, es könnten Eltern und Kinder in dieser Gesellschaft sinnvoll leben, wenn sie sich auf deren Sprache, deren Gewohnheiten, deren Werte nicht einlassen. Weshalb das Beharren auf einem Mindestmaß davon kein Fall von kulturellem Hochmut und ethnischer Unterdrückung ist, sondern eine notwendige Bedingung des Lebens in dieser Gesellschaft.
Ist es erlaubt, ohne den Ernst der Sache ins Spaßige zu ziehen, wenigstens einmal die Assoziation zu bemühen, zu der der Name der Schule herausfordert? Auf dem Rütli schworen sich die Schweizer zusammenzuhalten. Ein Rütli-Schwur, die Fragen endlich ernster zu nehmen, die der Hilferuf aus Neukölln heraufbeschwört, wäre fällig.
Hermann Rudolph ist Herausgeber der in Berlin erscheinenden Zeitung "Der Tagesspiegel". Es war zuvor Chefredakteur des Blattes. Vor seiner Aufgabe beim "Tagesspiegel" war Hermann Rudolph unter anderem für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" und die "Süddeutsche Zeitung" tätig. Er ist mehrfach ausgezeichnet worden, darunter mit dem Karl-Hermann-Flach-Preis.
Dass die Situation an der Neuköllner Schule kein Fall ist, der ganz jenseits des Schulalltags liegt, macht die Sache nicht besser. Aber immerhin profiliert er das Problem und lenkt den Blick von der lokalen Ebene auf die der Entwicklung jenseits der Rütli-Schule. Da stößt er zunächst auf eine bestürzende Schicht von Gewöhnung und Resignation, die sich wie ein Schutzmantel um die Konflikte gelegt hat, so dass dann alarmierend neu erscheint, was es keineswegs ist. Nur der Skandal ist offenbar in der Lage, diese Schicht zu durchbrechen. Das betrifft den Schulbetrieb insgesamt, nicht zuletzt die Schulaufsicht, und reicht bis in die Fragen des Schulsystems hinein – der Abstieg der Hauptschule zur Rest-Schule wird seit Jahren beklagt.
Es ist auch richtig, dass die Kritik und das Nachdenken über die Konsequenzen, die zu ziehen sind, hier ansetzen. Sprachförderung, sozialpädagogische Betreuung, schärfere Reaktionen – Lehrern, Schülern und Eltern wird nicht geholfen, wenn nicht überlegt wird, was konkret und vor Ort verbessert werden kann. Aber das Echo zeigt auch, dass die Wirkung dieses Vorfalls tiefer reicht. Es kann gar nicht bezweifelt werden, dass der Hilfeschrei des Kollegiums dieser Schule gezeigt hat, wie weit wir es gebracht haben – in Sachen jugendlicher Fehlentwicklung, mangelnder Integration, sozialer Problemzonen, vielmehr: wie weit sie uns misslungen sind.
Dieser Vorgang ist eine Frage an uns, an unsere Gesellschaft, an die Politik, die sie betreibt oder erlaubt. Er spitzt zu, was an Problemen seit langem auf uns eindringt. Der ganze Komplex von Migration, Integration, sozialem Außenseitertum liegt damit auf dem Tisch, untrennbar verwickelt mit der Debatte um Erziehung und soziales Verhalten, um die Bedeutung von Regeln und Werten. Es spricht vieles dafür, dass der Hintergrund nicht zuletzt die soziale Ghettoisierung von Ausländern ist – es ist die soziale Perspektivlosigkeit, die zu asozialem Verhalten führt. Aber ein Blick nach Neukölln belehrt darüber, dass die kulturelle Selbst-Ghettoisierung vieler Ausländerfamilien ihren Teil dazu beiträgt. Die Gewaltbereitschaft, die daraus erwächst, hat die Lehrer in die Defensive und in die Resignation gebracht.
Aber man wird doch zumindest fragen dürfen, ob dazu nicht eine bis an den Rand der Gleichgültigkeit reichende Toleranz beigetragen hat, die gar nicht mehr wagt, Grenzen zu setzen und auf Regeln zu beharren. Wie überhaupt zu fragen ist, ob hinter der Kapitulation der Lehrerschaft vor der unhaltbaren Situation nicht die zumindest partielle Kapitulation der Gesellschaft steht, auf ihren Überzeugungen zu beharren. Selbst an dem leidigen Streit um die Leitkultur ist aus Anlass dieser Debatte kaum vorbeizukommen. Denn irgendwie ist auch er ein Exempel für das Scheitern der Vorstellung, es könnten Eltern und Kinder in dieser Gesellschaft sinnvoll leben, wenn sie sich auf deren Sprache, deren Gewohnheiten, deren Werte nicht einlassen. Weshalb das Beharren auf einem Mindestmaß davon kein Fall von kulturellem Hochmut und ethnischer Unterdrückung ist, sondern eine notwendige Bedingung des Lebens in dieser Gesellschaft.
Ist es erlaubt, ohne den Ernst der Sache ins Spaßige zu ziehen, wenigstens einmal die Assoziation zu bemühen, zu der der Name der Schule herausfordert? Auf dem Rütli schworen sich die Schweizer zusammenzuhalten. Ein Rütli-Schwur, die Fragen endlich ernster zu nehmen, die der Hilferuf aus Neukölln heraufbeschwört, wäre fällig.
Hermann Rudolph ist Herausgeber der in Berlin erscheinenden Zeitung "Der Tagesspiegel". Es war zuvor Chefredakteur des Blattes. Vor seiner Aufgabe beim "Tagesspiegel" war Hermann Rudolph unter anderem für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" und die "Süddeutsche Zeitung" tätig. Er ist mehrfach ausgezeichnet worden, darunter mit dem Karl-Hermann-Flach-Preis.
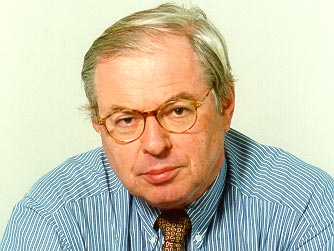
Hermann Rudolph© privat