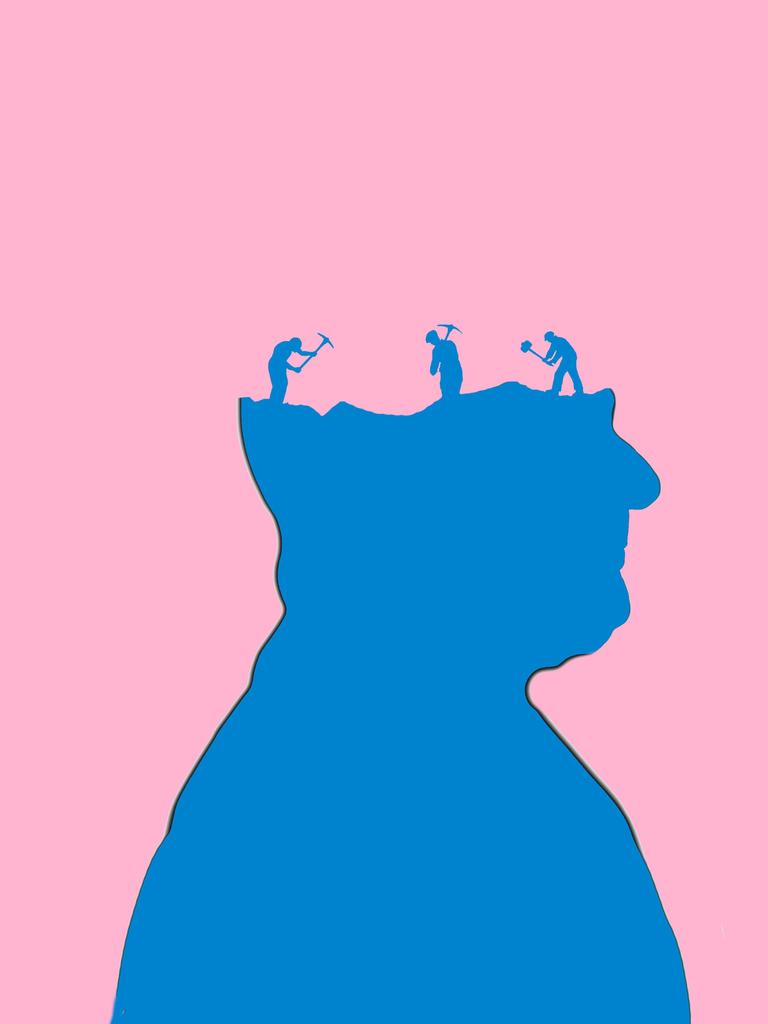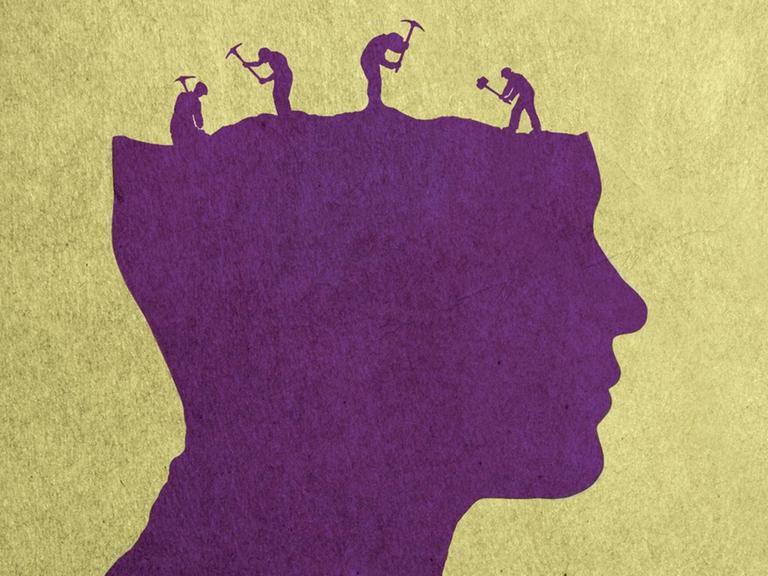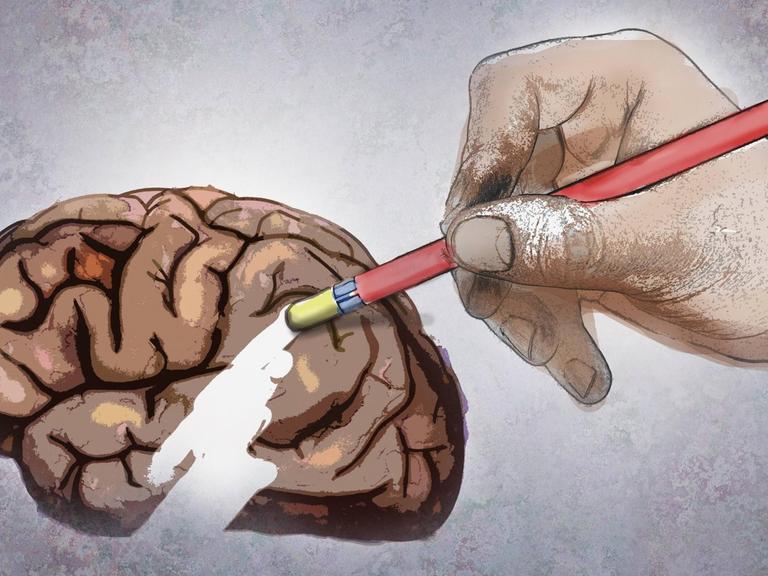Die Erstausstrahlung dieser "Langen Nacht" war am 22.09.2018.
Die Angst vor dem Vergessen

Es scheint so ziemlich das Schlimmste zu sein, was einem betagten Menschen passieren kann: Demenz. Die Angst vor dem Vergessen greift um sich. Fachleute sagen: Ein gutes Leben mit Demenz ist möglich. Aber was tun, wenn ein Leben zu Hause nicht mehr möglich ist?
Wer es bemerkt, zieht sich zurück, aus Scham und voller Angst, aus der Rolle zu fallen. Angehörige trifft es genauso wie den, der sich nicht mehr erinnert, was im Moment zuvor geschehen ist.
Der Autor hat Menschen mit Demenz getroffen und mit ihnen, mit Angehörigen, Pflegekräften, Ärzten, Wissenschaftlern und Polizisten gesprochen. Er war im Heim und im berühmten Demenzdorf De Hogeweyk in Holland. Er hat auf einem Kongress Menschen mit Demenz zugehört, die sich selbstbewusst zu Wort melden.
Ein gutes Leben mit Demenz ist möglich. Das sagen Fachleute, die nicht länger darum streiten wollen, ob dieses Phänomen des Alterns eine Krankheit ist, sondern sich Gedanken machen, wie man damit lebt. Und wenn es nicht mehr geht in der eigenen Wohnung und auch nicht bei den Kindern? Wenn die Pflege immer wichtiger wird? Auch diese Fragen stellen wir in der Langen Nacht über Demenz.
Demenz erscheint als Schicksal des Einzelnen, dem zunächst der Alltag entgleitet, bevor er – wie es heißt – seiner Persönlichkeit beraubt nur mithilfe anderer überlebt. Dieses Gespenst der Demenz ist auch das Zerrbild einer Gesellschaft, von der es heißt, sie sei allmählich überaltert und könne die Hilfe für die vielen Verwirrten nicht mehr lange leisten. Rund 1,7 Millionen Menschen sollen es derzeit in Deutschland sein; ihre Zahl könnte sich – sagen Schätzungen – bis zum Jahr 2050 verdoppeln.
"Die Angst vor dem Vergessen" – in der dieser Langen Nacht geht es auch um die Frage: Ist Demenz eine Krankheit oder doch nur Teil des natürlichen Alt-Werdens? Wir begleiten Betroffene und Angehörige auf der Suche nach einem alternativen Umgang mit dem Phänomen, unter anderem bei einem Besuch in einer Einrichtung in den Niederlanden, die oft als Demenzdorf bezeichnet wird. Außerdem zeigen Theatermacher und Literaten, was ein anderer Blick auf die Demenz bewirken kann.
Demenz in den Medien – ein Schreckgespenst
Bekannt sind Demenzen als eine Erscheinung des hohen Alters: Zwischen dem 70. und 75. Lebensjahr wird bei knapp jedem 30. eine Demenz festgestellt; bei den über 90-Jährigen ist es jeder Dritte. Das heißt umgekehrt, dass zwei Drittel der Menschen dieses Alter bei klarem Verstand erleben. Die häufigste Form ist das, was Alzheimersche Krankheit genannt wird. Benannt ist dieses Phänomen nach Alois Alzheimer, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach dem Tod seiner verwirrten Patientin Adele D. Veränderungen in ihrer Hirnsubstanz festgestellt hat.
Umfragen zeigen, dass die Angst vor einer Demenz sehr groß ist. Was auch an dem Bild liegt, das in den Medien herrscht. Heinrich Grebe forscht am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich. Er hat an 250 Pressetexten untersucht, welche Bilder und Deutungen von Demenz durch Publikumsmedien transportiert werden.
"Es gibt einmal eine defizitorientierte Herangehensweise an das Thema. Da wird die Situation von Betroffenen sehr düster beschrieben: Demenz als das Leben, kein Mensch mehr zu sein. Das ist ’ne Aussage, die trifft der Bildzeitungskolumnist Franz Josef Wagner in Bezug auf die Situation von Walter Jens. Das war ein großes mediales Thema. Es gibt ja immer die Assoziation, die Bild-Zeitung ist tendenziös in bestimmte Richtung und dann gibt es die Qualitätspresse wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Neue Züricher Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und so weiter, da wird doch hochgradig differenziert berichtet und auch über das Thema Demenz sehr differenziert berichtet.
Das ist nicht so! Auch in diesen Zeitungen herrschen die gleichen defizitorientierten Tendenzen vor: Das wird nicht gesagt, es ist das Leben, kein Mensch mehr zu sein, sondern wird ein bisschen vorsichtiger formuliert: 'Die Gedächtnisfestplatte wird gelöscht’, 'Das Personsein löst sich auf', 'Der Mensch wird leer'. Aber semantisch, in Bezug auf die Bedeutung, ist das Alles sehr ähnlich: Der Mensch wird leer, die leere Hülle. Das ist ein Bild, das umgeht in Bezug auf die Situation von Betroffenen."
Im Mittelpunkt dieser Darstellungen stehen das Erinnerungsvermögen und dessen Verlust. Interessant für den Kulturwissenschaftler Grebe ist, welche Vorstellung wir vom Gedächtnis haben:
"Alle kennen wahrscheinlich das Bild, dass das Gedächtnis 'ne Festplatte ist. Das ist ’ne verbreitete Vorstellung, die sich unter anderem darin niederschlägt, dass wir sagen, 'ich hab was abgespeichert'. Das Gedächtnis ist 'ne Festplatte beziehungsweise das Gedächtnis ist 'n Gefäß, in dem alle unsere Erinnerungen und letzten Endes auch unser Personsein gelagert ist. Der Inhalt letzten Endes dessen, was wir sind, liegt im Gedächtnis. So, und jetzt kommt Demenz. Und die mediale Darstellung ist: Demenz macht das Gedächtnis, macht das Gedächtnisgefäß leer. Demenz löscht die Gedächtnisfestplatte und löscht damit auch alles, was den Menschen ausgemacht hat."
Der Kulturwissenschaftler Heinrich Grebe zeigt, dass die mediale Darstellung mit ihrer Reduzierung von Menschen mit Demenz auf ihre Defizite natürlich Auswirkungen hat:
"Wenn jetzt Angehörige zum Beispiel immer wieder lesen 'Die Betroffenen werden leer, das sind leere Hüllen', und sie orientieren sich in ihrer Alltagspraxis an dieser Metapher, dann hat diese Metapher, dann hat diese mediale Beschreibung alltagspraktische Folgen, nämlich unter Umständen die Folge, dass die Angehörigen nur noch den Körper pflegen, aber das Menschliche, den Versuch zu unternehmen, die kommunikative Beziehung herzustellen, dass sie das abbrechen, weil: Es ist ja sowieso überflüssig, es ist ja sowieso leer. Und da gibt es entsprechende Untersuchungen, die das zeigen, das Phänomen des sozialen Todes, das Risiko des sozialen Todes, das mit diesen Beschreibungen zusammenhängt."
Das fängt damit an, dass "Wir", "die Normalen", von "den Dementen" reden und sie damit auf mutmaßliche Defizite reduzieren. Die Aktion Demenz, eine Initiative von Forschern und Praktikern, fordert deshalb nachdrücklich, sie "Menschen mit Demenz" zu nennen. Es hat sich ja auch eingebürgert, "Menschen mit Behinderung" nicht als "die Behinderten" schon sprachlich auszugrenzen.
Ist Demenz eine Krankheit oder nur eine Form des Alterns?
Was ist das eigentlich, was Betroffene und Angehörige erleben: eine mögliche – wenn auch seltene und unangenehme – Form des Alterns? Oder ist es eine Krankheit? Der Direktor der Münchener Klinik für Psychiatrie rechts der Isar Professor Hans Förstl hat sich vorgewagt:
"Ich bin von meinen Kollegen schon mal sehr, sehr gescholten worden, als ich mich öffentlich geäußert habe zu dieser Frage und behauptet hab, man könne es eigentlich nicht als Krankheit bezeichnen, da es so regelhaft im Alter auftritt."
Widerspruch gibt es genug, etwa von Jan Wojnar klar. Lange Jahre hat der Gerontopsychiater als Heimarzt die Bewohner in verschiedenen Pflegeeinrichtungen Hamburgs betreut.
"Es ist eine schwere Krankheit, die vor allem alte Menschen trifft, und ich finde das oft unverantwortlich, wenn man versucht, die Demenz nur als eine Alterserscheinung zu bagatellisieren, weil man dadurch auch dem Kostenträger gute Argumente liefert, eventuell weniger Geld in diesen Bereich zu investieren und dadurch das Leben der Demenzkranken viel schlimmer gestalten als es möglich wäre."
Mit der Definition als Krankheit werden Menschen mit Demenz zu Patienten und haben Anspruch auf Leistungen des medizinischen Systems. Ist das sinnvoll? Mancher wird sich erinnern, wie lange es gedauert hat, Alkoholabhängige als therapiebedürftig anzusehen und nicht mehr als liederliche Trunkenbolde, die es trockenzulegen oder zu verwahren galt. Andererseits war noch bis 1992 Homosexualität im internationalen Klassifikationssystem als eine Krankheit verzeichnet, die behandelt werden sollte – was heutzutage grotesk anmutet.
Doch die Debatte wird kontrovers geführt. Die Biologin Cornelia Stolze hat ein Buch mit dem Titel geschrieben: "Vergiss Alzheimer! Die Wahrheit über eine Krankheit, die keine ist" und macht darin den Medizinern die Deutungshoheit streitig.
Sie geht scharf mit allen ins Gericht, denen sie Geschäftemacherei mit der Situation der Menschen mit Demenz vorwirft. Die Auseinandersetzung um die Einordnung der Demenz ist in der Tat ein Streit nicht nur um die Deutungshoheit. Es geht um Geld, viel Geld, um die Kosten für und die Einnahmen aus Betreuung, Versorgung und Pflege der Betroffenen, um lockende Etats für die Forschung, um einen Markt, der viel verspricht. Für die Kanalisierung der gewaltigen Geldströme geht es dann natürlich um die Definition dessen, was als Problem gesehen wird. Was haben die Ärzte da zu bieten?
In der Reihe der systematisch erarbeiteten oder zufällig entdeckten Erkenntnisse der Medizin steht Alois Alzheimer mit seiner Arbeit neben den ganz Großen wie dem Erforscher der Tuberkulose Robert Koch oder dem Retter der Mütter Ignaz Semmelweis, der die Ursache des Kindbettfiebers fand.
Es begann mit einem Vortrag 1906
Die Erfolgsgeschichte der nach Alzheimer benannten Krankheit begann mit einem Vortrag im Jahre 1906 vor einer Versammlung damals so genannter Irrenärzte über seine Patientin Auguste D.. Die zeigte bereits mit 51 Jahren die Auffälligkeiten, die heute bei einer Reihe vor allem älterer Menschen festgestellt werden. Zwei Phänomene der Moderne mussten dazu kommen: Die Tatsache, dass immer mehr Menschen in den Industrie-Nationen durch verbesserte Lebensbedingungen relativ gesund ein Alter erreichen, das in früheren Zeiten nur wenigen vergönnt war. Dazu kommt die enorme Leistungsfähigkeit der Medizin.
Die hilft vielen, Krankheiten zu überstehen, die ihre Großeltern nicht überlebt hätten. Aber dann gibt es Probleme bei den Synapsen, schlagen Plaques und Fibrillen im Hirn gnadenlos zu – verkünden Neurologen und Psychiater. Die lassen Alte erst wunderlich und dann unerträglich werden. Das mag schon immer so gewesen sein, fällt aber erst auf, seitdem die Zahl der Hochbetagten so enorm zugenommen hat.
Doch selbst naturwissenschaftlich orientierte Schulmediziner sind sich nicht immer sicher, wie sie das Phänomen einordnen sollen. Etwa Peter J. Whitehouse, einem Psychiater und Neurologe aus den USA, er forscht und lehrt an der Case Western Reserve University in Cleveland/Ohio. Für mehr als drei Jahrzehnte war er dem gängigen Erklärungsmuster verhaftet, hat multinationale Pharmafirmen beraten und Millionen Dollar an Forschungsmitteln verbraucht. Diesem Star seines Berufsstandes ist irgendwann aufgefallen, dass sein wissenschaftliches Fundament höchst fragil war. In "Mythos Alzheimer. Was Sie schon immer über Alzheimer wissen wollten, Ihnen aber nicht gesagt wurde" – so der Titel der deutschen Übersetzung – bemüht er sich, die grundlegenden Annahmen dieses Mythos zu erschüttern.
Unter anderem heißt es in dem Buch, dass:
"Die sogenannte Alzheimerkrankheit sich vom normalen Alterungsprozess nicht wirklich unterscheiden lässt und dass kein Krankheitsverlauf mit einem anderen identisch ist und dass wir nicht einmal wissen, wie wir die Alzheimerkrankheit diagnostizieren sollen, geschweige denn, wie die Zahlen der von der Krankheit Betroffenen darzustellen sind."

Der deutsche Psychiater und Neuropathologe Alois Alzheimer, hier auf einem undatierten Foto, nachdem die Krankheit Alzheimer benannt wurde. © picture alliance / Everett Collection / Courtesy Everett Collection
Aber natürlich ist es nicht nur der Wunsch der Alzheimer-Forscher, auch diesem Geheimnis des Lebens auf die Spur zu kommen, es ist auch der Ehrgeiz, eine bahnbrechende Entdeckung zu machen. Wichtiger ist die darauf aufbauende Suche nach einem Impfstoff oder einer wirksamen Therapie, deren Entdeckung neben Ruhm auch sehr viel Geld verspricht. Und da sind die eifrigen Forscher – wie sie selbst zugeben – noch sehr, sehr weit entfernt von dem, was den Menschen helfen könnte, die auf Heilung hoffen. Aber: Möglicherweise ist ja auch alles gar nicht so furchtbar, wie viele gegenwärtig befürchten, setzt der Münchner Klinik-Direktor Förstl der aufkommenden Panik etwas entgegen:
"Vielleicht müsste man eine Überlegung anstellen, wodurch der Mensch so alt wird in unserer westlichen Gesellschaft. Und das gibt dann auch wieder etwas Hoffnung. Denn wir werden ja so alt, weil wir so lang so gesund bleiben und davon profitiert natürlich auch das Gehirn. Das zeigt sich auch an den Zahlen aus der Epidemiologie: Man erkennt, dass die Demenzrate pro Altersstufe etwas absinkt. Dieser Effekt konkurriert damit, dass die Lebenserwartung steigt. Und wie das Rennen ausgeht, zwischen den Organsystemen, zwischen diesen beiden Rechengrößen, das ist heute noch gar nicht entscheidbar. Es ist sicher vernünftig, mit hohen Zahlen zu rechnen und entsprechend motiviert an die Sache heranzugehen."
Diese Erkenntnisse aus der epidemiologischen Forschung sind für diejenigen, die mit fortschreitendem Alter ängstlich erste Anzeichen von Vergesslichkeit und Verwirrtheit an sich oder ihren Angehörigen zu sehen meinen, ein schwacher Trost. Der frühere Heimarzt Jan Wojnar hat es tagtäglich erlebt. Er geht davon aus, dass es natürlich furchtbar ist für Menschen, zu merken, dass ihnen der Alltag entgleitet. Wenn sie diese Anfangsphase durchlitten haben, haben nicht mehr sie, sondern ihre Angehörigen damit zu kämpfen:
"Und das ist eben das Problem, auch den Angehörigen zu verdeutlichen, dass die Kranken nicht leiden, dass sie nicht vegetieren, in einem Nichts einfach auf den Tod warten, sondern dass sie unter Umständen ein – sogar ein lustvolles Leben führen."
Der Demenz begegnen: die Selbst-Hilfegruppe
"Demenz ist schlimm für die Betroffenen im Anfangsstadium, das heißt, zu merken, man funktioniert nicht mehr so wie früher, man wird vergesslich, eventuell von der Umgebung ausgelacht oder nicht verstanden, ist schlimm."
Das hat Jan Wojnar immer wieder von Menschen mit Demenz gehört, die bei ihm Rat und Hilfe gesucht haben. Helfen kann gerade in dieser ersten Phase der Orientierungs- und Hilflosigkeit eine Selbsthilfegruppe. Hans-Ulrich, ein ehemaliger Jurist, der mit Anfang 60 dement wurde, hat eine solche Gruppe bei der Alzheimer Gesellschaft gefunden.
"Ja, ich glaube, wir machen da alle neue Erfahrungen, welche Macken oder Besonderheiten da bei dem Einzelnen sind – manche singen gerne, manche wandern gerne, manche sind ganz still, und dann kann man die mal mit ein paar Scherzen auflockern, oder ich bring dann mal irgendwie – ja, ich bin eigentlich, ich sag mal, ein lustigerer Typ, und kann die denn gerne mal aufheitern. Dass mal andere, die nicht so weit – oder die schon weiter daneben sind –, dass die aufgemuntert werden, und mal mehr aus sich herauskommen. Weil wir uns gegenseitig kennen und wissen, das stört keinen, wenn man mal einen Fehler macht und dergleichen mehr. Man muss nicht immer so fehlerlos arbeiten, sondern kann auch mal was sagen, was denn letztlich Blödsinn ist."
Es ist ein geschützter Raum. Ganz offen können die Mitglieder über sich und ihre Probleme reden, über ihre Beziehungen zu den anderen, die mit mehr oder weniger Verständnis auf sie reagieren. Sie sind unter sich. Nur eine Anleiterin gibt es. In Kiel hat die Sozialarbeiterin Michaela Kaplaneck eine solche Gruppe gegründet. Sie respektiert die Verletzlichkeit der Teilnehmer, will sie aber nicht ‚in Watte packen’:
"Die Menschen haben gemerkt, ich respektiere sie als Person. Ich reduziere sie nicht auf ihre Demenz, ich nehme sie als ganzen, vollständigen, wertvollen Menschen wahr. Und das erleben die nicht überall. Auch nicht in ihrer Familie unbedingt. Das wissen die unheimlich zu schätzen und ich habe es eben geschafft, zu jedem einzelnen Gruppenteilnehmer eine ganz gute, gefestigte Arbeitsbeziehung aufzubauen, und das erlaubt mir, sie mit meiner Moderation, mit meiner Gesprächsführung an ihre Grenzen zu bringen, ohne dass jemand zusammenbrechen muss. Das find ich ganz erstaunlich – und es ist mir gelungen. Darüber bin ich ganz froh und die Teilnehmer sind es auch und das melden sie mir zurück nach jeder Sitzung. 'So viel wie heute habe ich seit 14 Tagen nicht gesabbelt und ich geh jetzt so erleichtert nach Hause und es war schön, bei Ihnen zu sein'."
Sie erleben sich ein Stück weit wie früher, in der Zeit vor der Diagnose, in der sie als ernst zu nehmende Gesprächspartner galten. So wollen sie auch weiterhin gesehen werden. Bei ihren Treffen wird ihnen bewusst, dass sie viel mehr können als die Menschen um sie herum ihnen für gewöhnlich zutrauen, schildert Michaela Kaplaneck ihren Eindruck. Im Alltag verstummen sie schnell, wenn sie das Gefühl haben, dass sie etwa dem Gespräch am Tisch nicht folgen können. Die neue Erfahrung ist ...
"Dass sie aber in der Gruppe merken, Mensch, die anderen Teilnehmer, die gehen auf meine Sprachschwierigkeiten ein, die lassen mich zu Wort kommen oder Frau Kaplaneck achtet darauf, dass ich auch zu Wort komme, und erleben das natürlich alles unheimlich entlastend und selbstbewusstseinsfördernd. Das hat wirklich etwas damit zu tun, nehme ich den Menschen die Selbstbestimmung oder ermutige ich sie, weiterhin selbstbewusst die Person zu bleiben, die sie eigentlich immer schon waren und weiter sein werden, egal ob mit oder ohne Demenz."
Alltag im Pflegeheim
Das Elisabeth Alten- und Pflegeheim in Hamburg-Eimsbüttel, zentrale Lage, quirliger Stadtteil, ist ein Haus mit gutem Ruf. Es ist kurz nach sieben. Pfleger Hilko hat Frühdienst auf der Dementenstation.
"Heute ist ’n Luxustag. In der Regel sind wir zu dritt in der Pflege und einer im Service – manchmal haben wir auch das Pech, dass wir zu zweit sind – und das heißt, dann dementsprechend kommen die meisten Bewohner definitiv zu kurz."
Ständig schaltet er um: vom gehetzten schnellen Schritt auf dem Weg ins Zimmer zum langsamen Gang mit einem Patienten den langen Flur des ehemaligen Krankenhauses entlang zum Essensraum. In der kleinen Stationsküche schmiert inzwischen die Servicekraft die Brötchen – für die Bewohner, die das mit Anleitung und Hilfe vielleicht ja auch selbst könnten. Aber die Zeit ... Nächster Arbeitsschritt: Der Pfleger eilt durch den Speiseraum und verteilt Medikamente. Alles genau dosiert – die Arznei und die Zuwendung: Alltag wie in vielen der über 13.000 deutschen Pflegeheimen. Dabei brauchen gerade Menschen mit Demenz Ruhe und eine entspannte Atmosphäre. Hektik kann ihre Situation verschlimmern.

Nicht immer ist soviel Zeit: gemeinsames Frühstück von Menschen mit Demenz und ihren BetreuerInnen im "Plüschzimmer".© Deutschlandradio / Plemper
Es gibt ein besonderes Angebot auf der Station: Zweimal pro Woche sitzen acht der verwirrten alten Damen und Herren im so genannten ‚Plüschzimmer’ um den geradezu festlich gedeckten runden Tisch. Es könnte ein Treffen mit der Verwandtschaft sein oder alten Freunden, in der ‚guten Stube’, die Viele früher hatten: Das besondere Zimmer, das nur zu besonderen Anlässen genutzt wurde.
Währenddessen eilt Pfleger Hilko über den Flur ins Dienstzimmer, schließt den großen Schrank mit den Medikamenten auf, nimmt diverse Schachteln heraus und zählt einzelne Pillen ab – wie es auf dem ärztlichen Verordnungsblatt in der Heimakte der Bewohner steht. Wer alt ist, hat oft mehrere gesundheitliche Probleme. Einige lassen sich zumindest lindern. Immer wieder ist zu hören, dass Menschen in Pflegeheimen mit Medikamenten ruhig gestellt werden, um den knappen Pflegekräften die Arbeit zu erleichtern. Das weist Hilko weit von sich:
"Einige Bewohner brauchen sicherlich Medikamente, um ruhig zu werden, weil sie innerlich so getrieben sind, aber das sprechen wir auch immer mit unseren Neurologen und Hausärzten ab. Es ist nicht so, dass wir uns damit die Arbeit leichter machen wollen. Also das ganz bestimmt nicht."
Bei all der Hektik gelingt es dem Pfleger, einer alten Dame ein dankbares Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Für außenstehende Betrachter ist es nicht unbedingt das, was sie sich für ihr Alter oder das ihrer Angehörigen wünschen. Einige bezeichnen das Leben im Heim gar als ‚Horror’. Den hat Hilko durchaus erlebt in Häusern, in denen er zuvor gearbeitet hat:
"Wenn man sich dann vorstellt, ein Wohnbereich mit 60 Bewohnern, das sind dann halt drei, vier Pflegekräfte, dann auch noch nicht eingearbeitet, vielleicht von der Zeitarbeit – das ist dann einfach auch ein ganz anderes Arbeiten – da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es der Horror sein kann. Definitiv."
Alternativer Umgang? Ein "Demenzdorf" in den Niederlanden
Weesp vor den Toren Amsterdams, eine idyllische Kleinstadt wie aus dem Bilderbuch: Grachten durchziehen das Zentrum, kleine Häuser ducken sich an ziegelgepflasterten Straßen, Radfahrer warten, bis sich die Klappbrücke am kleinen Hafen wieder schließt, und blicken verträumt den Segelbooten nach.
Aber es gibt auch ein anderes Gesicht der Stadt, nicht weit vom Zentrum entfernt: Moderne Gewerbebauten entlang der Straße, dann – ein wenig weiter draußen – Häuserblocks: groß, breit, hoch. Der übliche Massenwohnungsbau. Und mittendrin ein Karree, zweigeschossig, in sich geschlossen. Die beiden Flügel der gläsernen Schiebetür gleiten zur Seite, ein paar Schritte und der Besucher steht in der Eingangshalle vor einem Empfangstresen.
Eine zweite Glastür gibt den Blick frei auf einen kleinen gepflasterten Platz, dahinter eine Gasse. Aber diese Tür öffnet sich nicht, solange nicht die Außentür geschlossen ist. Sicherheitsschleuse, der Eingang zum berühmten Demenzdorf De Hogeweyk.

Der Eingangsbereich des sogenannten Demenzdorfs in den Niederlanden.© Deutschlandradio / Plemper
Die Leiterin der Einrichtung, Yvonne van Amerongen-Heijer, stellt jedoch klar:
"Nein, wir haben kein Demenzdorf gebaut, wir haben eine Umgebung entwickelt, wo Menschen mit einer schweren Demenzkrankheit sich wohlfühlen und sich sicher fühlen und wo man ein normales Leben haben kann."
So normal das Leben eben sein kann, hinter einer Sicherheitsschleuse. Die funktioniert in umgekehrter Richtung genauso: Wer aus der Gasse kommt und den kleinen Platz überquert, steht in der Eingangshalle. Erst wenn die innere Tür geschlossen ist, kann sich die äußere öffnen.
"Es scheint so, dass man nicht frei ist, rauszugehen und reinzukommen; das ist aber nicht so. Es ist aber so, dass unsere Bewohner nicht sicher sind im Draußen. Denn die verstehen die Umwelt nicht, die verstehen nicht, die verstehen das Verkehr nicht, die verstehen nicht, was geschieht. Denn diese Menschen sind wirklich am Ende von Demenzkrankheit."
Aber kann die Lösung darin liegen, diese Menschen in einer abgeschotteten Welt vor dem Alltag in Sicherheit zu bringen? Ist es nicht heutzutage angebracht, sie mit entsprechender Hilfe in ihrer normalen Umgebung zu belassen?
"Solange das möglich ist, dass Menschen mit Demenz in eine normale Umgebung weiter leben können, machen wir das, das ist auch die Idee, das unsere Regierung hat: Man kann hier in den Niederlanden so lange wie möglich zuhause bleiben. Und 85 Prozent von unseren Bewohnern hier in den Niederlanden, die Demenzkrankheit haben, die können zu Hause bleiben, bis zum Ende. Aber für 15 Prozent ist es nicht möglich, das ist nicht gut. Und für die Menschen haben wir eine Umgebung entwickelt, die gut ist, wo man gut leben kann."
Gut 150 Menschen mit Demenz in unterschiedlichem Stadium leben in De Hogeweyk. Es mutet tatsächlich an wie ein kleines Dorf: Ein Theater grenzt an das Verwaltungsgebäude mit der Eingangshalle, davor ein Bassin mit Springbrunnen, ein paar Gartenstühle lassen erahnen, dass dort bei gutem Wetter die Leute zusammensitzen. Auf der anderen Seite des Platzes ist die Eckkneipe - es gibt das gleiche Bier wie in den Kneipen im Zentrum der Stadt. Daneben öffnet sich eine Durchgangshalle mit Supermarkt und Restaurant, an denen vorbei es auch zu den Wohngebäuden geht. Die Menschen in Wohngruppen untergebracht.

Blick auf den zentralen Innenhof des Pflegeheims de Hogeweyk.© Deutschlandradio / Plemper
Das Besondere in De Hogeweyk ist, dass das Leben in allen Wohngruppen dasselbe kostet: 5000 Euro im Monat. Also nur etwas für Gutbetuchte? Nein, erklärt die Leiterin, das Pflegeheim eine Non-Profit-Organisation und nicht auf Gewinn aus. Das Geld wird voll aus den Sozialkassen finanziert. Und sie legt noch mal Wert darauf, dass sie kein ‚Demenzdorf’ gebaut haben, sondern das ‚Verpleghuis Hogewey’, eine Pflegeeinrichtung; allerdings, betont sie stolz, eine sehr gute.
Während in anderen Heimen mit einhundertfünfzig Plätzen die Bewohner von ihrer Station aus den langen Gang entlang und in ein anderes Stockwerk gehen, um zur Physiotherapie zu kommen, verlassen sie in De Hogeweyk das Haus ihrer Wohngruppe und gehen durch die Gassen und über den zentralen Platz zum flachen Gebäude mit der Aufschrift ‚Fysiotherapeut’.
Oder sie gehen nebenan zum ‚Mozartsaal’, indem sich die Gruppe der Klassikliebhaber trifft. Das ist es, was viele Besucher begeistert, die sich von der schönfärberischen Bezeichnung ‚Dorf’ nicht abbringen lassen. Radikale Kritiker dagegen halten nichts davon, Heime auf diese Weise ‚aufzuhübschen’. Sie fordern, die Institutionen aufzulösen und die Bewohnerinnen und Bewohner ambulant zu versorgen – in ihrer gewohnten Umgebung.
In Deutschland immer beliebter: die Demenz-WG
Was machen wir, wenn das Leben in der eigenen Wohnung irgendwann zu beschwerlich wird, Angehörige mit der Sorge, vielleicht auch der Pflege, überfordert sind? Es ist auch legitim, dass die eine solche Aufgabe nicht übernehmen wollen. Und vielleicht sind überhaupt keine Angehörigen da. Was dann? Da gibt’s doch noch die Wohngemeinschaften, wenn es kein Heim sein soll. Sie werden immer beliebter.

Alltag in einer "Demenz-WG" in Hamburg© Deutschlandradio / Plemper
Sechs alte Damen und ein Herr mit Demenz leben in dieser WG der Amalie-Sieveking-Stiftung in St. Georg, dem Innenstadt-Viertel am Hamburger Hauptbahnhof. Alle können schlafen, so lange sie wollen. Die Bewohnerinnen werden nicht einfach versorgt, sie bewältigen mithilfe von Pflege- und Betreuungskräften gemeinsam ihren Alltag – so gut sie können. Zum Konzept gehört auch der Einkauf im Supermarkt zwei Straßen weiter.
An diesem Tag ist das die Aufgabe von Emmi, 91-jährige Bewohnerin und dem Betreuer Helmut. Die Alten sind im Quartier sichtbar und nicht hinter Mauern versteckt. Die offene Küche ist der Mittelpunkt des gemeinsamen Alltags. Was sie ihr Leben lang konnten, können sie in der Wohngemeinschaft weiter tun. Emmi hilft Helmut, Paprika in feine Streifen zu schneiden, fein säuberlich in atemberaubendem Tempo.
Emmi: "Das ist nicht gut."
Helmut: "Jo, das machst du schon... Du nimmst das ja noch genauer wie ich."
Emmi: "Genauer als..."
Helmut: "Richtig!"
Emmi: "Komparativ bitte mit als!"
Emmi war früher Lehrerin. Sie ist die Aktivste der kleinen Gruppe und hilft gern. Und wenn das auch noch die Fachleute gut finden, weil es "Kompetenzen erhält" – wie sie sagen – und "den Abbau von Fähigkeiten verlangsamt", ist es umso besser. Sie kämen gut miteinander aus und würden viel lachen, erklärt Emmi. Gelegenheiten gibt es genug. Manches ist einfach komisch in ihrem Alltag. Die Herausforderung für die Betreuungs- und Pflegekräfte ist es, mit solchen Situationen spielerisch umzugehen: Die Alten ernst zu nehmen mit dem, was sie sagen und tun, sie nicht lächerlich zu machen, sondern mit ihnen über das Komische zu lachen – was etwas Befreiendes hat. Und es gilt, ihnen immer nur so weit zu helfen, wie es tatsächlich erforderlich ist – aber auch nicht weniger.
Etwa beim Essen. Bei Ilse genügt es, wenn die Betreuerin Christine daneben sitzt und sie immer wieder ermuntert – egal, wie lange das dauert. Währenddessen muss Helmut dem "Doktor", wie sie den alten Arzt respektvoll nennen, das "Essen reichen"; so sagen die Fachleute. Für andere ist es "füttern".
Vieles ist in dieser und in anderen Wohngemeinschaften so, wie es dem Standard in Pflege und Betreuung entspricht – oder besser: entsprechen sollte. Das Personal hat einfach mehr Zeit als die Kollegen in großen Einrichtungen und die Gruppe ist klein. Das haben die Angehörigen so gewollt. Sie sind verantwortlich dafür, was geschieht: Die WG ist nämlich kein Heim, sondern – wie es im Sozialgesetzbuch heißt - die 'eigene Häuslichkeit'. Sie haben für die Bewohnerinnen einen ganz normalen Mietvertrag für das WG-Zimmer unterschrieben.
Den jeweiligen Anspruch auf ambulante Pflegeleistung haben sie sozusagen ‚in einen Topf geworfen’ und gemeinsam einen Pflegedienst ausgesucht. Der sorgt dafür, dass sich rund um die Uhr Fachpersonal um die verwirrten Alten kümmert. Erst allmählich wird diese Form der Versorgung etwas bekannter. Die Kosten sind unterschiedlich, je nach Region, auf dem Dorf anders als in der Stadt. In etwa entsprechen sie dem, was auch bei einem ganz normalen Heim um die Ecke fällig wird. Für den, der das nicht selbst bezahlen kann, springt – wie im Heim auch – die Sozialhilfe ein. Am Geld sollte die Idee also nicht scheitern.
Demenz in der Literatur
Wenn sich an unserer gesellschaftlichen Reaktion auf Menschen mit Demenz etwas ändern soll, müssen sich die Vorstellungen ändern. Henriette Herwig, Professorin für Literaturwissenschaft an der Universität Düsseldorf, forscht über "Alte im Film und auf der Bühne", über "Merkwürdige Alte" – so die Titel zweier ihrer Bücher - und darüber, was Schriftsteller aus ihnen machen.
"Mich interessieren ganz besonders literarische Umsetzungen und Darstellungsweisen des Problems, die auch ästhetische Qualitäten haben, was bedeutet, dass sie das Phänomen unter Umständen multiperspektivisch ausleuchten, dass sie eben gerade nicht mit stereotypen Vorstellungen des alten Menschen oder auch des demenzkranken Menschen arbeiten, sondern vielleicht auch Überraschendes zum Vorschein bringen."
Es geht ihr aber nicht darum, dass Autoren – wie oft Journalisten – die Situation nur beschreiben, sondern ...
"Dass sie uns wachrütteln, dass sie uns auf unsere Vorurteile aufmerksam machen, dass sie helfen, die Vorurteile und vielleicht auch die normativen Vorstellungen, die sich dahinter verbergen, zu überdenken, zu relativieren, dass sie uns vielleicht auch schockieren."
Da fällt uns natürlich zuerst ein, wie Arno Geiger sich mit seinem Vater auseinandersetzt, beschrieben als "Der alte König in seinem Exil". Dessen Verhalten ist – vorsichtig ausgedrückt – oft ziemlich anstrengend: Die Familie leidet und der schreibende Sohn lässt uns daran teilhaben. Auch an der schwieriger werdenden Kommunikation, geprägt durch eine verdrehte Sprache des Alten. Henriette Herwig:
"Die neuen sprachlichen Wendungen des Vaters, die vielleicht auf die durch die Demenz gestörten kognitiven Ordnungsmuster zurückzuführen sind, wirken auf ihn aber nicht als krankhaft, sondern im Gegenteil sogar als brillant, kreativ, poetisch und dadurch rückt er sie in die Nähe des poetischen Sprachgebrauchs, der Poesie, und das ist wiederum dann etwas, das er selber mit dem Vater teilt."
Nun sind nicht alle, die Sorge tragen für einen Menschen mit Demenz, Schriftsteller und reagieren auch nicht mit Anerkennung ob der Kreativität, wenn ihr Angehöriger versucht, ihnen etwas mitzuteilen. Das ist der Moment, in dem es weniger um die Brillanz, die Form, geht, oft auch weniger um den Inhalt als vielmehr darum, irgendwie in Kontakt zu bleiben. Das ist auch Arno Geiger schwer gefallen, wie er uns mitfühlen lässt, auch wenn er den – schwachen – Trost der Poesie hat. Die Kulturwissenschaftlerin Herwig stellt die Definition einer Demenz als Krankheit nicht infrage. In der Regel orientieren sich auch die Autoren, deren Werke sie untersucht hat, an den medizinischen Krankheitsbildern.
"Aber sie kontextualisieren sie, sie betten sie in persönliche Lebensgeschichten, in Familiengeschichten ein. Sie geben dem Krankheitsbild möglicherweise eine neue Deutung und das kann ganz unterschiedlich sein.
Die Kunst besteht darin, eine solche Lebenssituation nicht zu bagatellisieren, gar in ein romantisches Licht zu tauchen, sich aber auch nicht in einem reinen Katastrophenbild zu verlieren. In dieser geglückten Gratwanderung zeige Geiger eine besondere literarische Qualität, sagt Henriette Herwig:
"Der Text erzählt in sehr dichter Weise einen Krankheitsverlauf, der sich in der Realität ja quälend langsam hingezogen hat. Und er schafft, indem er Sätze des Vaters, zum Beispiel: "Das Leben ist ohne Probleme auch nicht leichter", zitiert, schafft er komische Pointen. Und er macht dadurch etwas erträglich, was in der Realität vielleicht unerträglich wäre. Das wird in dem Text auch selber kommentiert, nämlich dadurch, dass die Schwester des Icherzählers es nicht erträgt, ihren Vater im Altersheim zu besuchen, aber es sehr gut erträgt, es zu lesen, was ihr Bruder darüber schreibt. Wie kommt das?
Das muss mit genau dem zusammenhängen, dass durch dieses Maß an Verdichtung von Pointen eine Heiterkeit erzeugt wird, die im Leben nicht da wäre. Und das bringt mich auch zu einem sehr wichtigen Aspekt, im Zusammenhang mit positiver Altersdarstellung: Der Humor, die Selbstironie, die Gelassenheit – das kann dann eben in einer Weise zum Ausdruck kommen, wie es in einem dokumentarisch protokollierten Bericht vom Pflegealltag vermutlich nicht der Fall wäre."
Über den Autor:
Burkhard Plemper ist ausgebildeter Soziologe und arbeitet als Journalist für Funk und Fernsehen. Mit dem Thema Demenz beschäftigt er sich seit vielen Jahren intensiv. Jetzt hat er dazu auch ein Buch veröffentlicht unter dem Titel "…und nichts vergessen. Die gesellschaftliche Herausforderung Demenz."