Eine neue Bewegung
Gabor Steingart, Leiter des "Spiegel"-Büros in Washington, liest in "Die Machtfrage" der deutschen Parteiendemokratie die Leviten und fordert nichts Geringeres als ihre Abschaffung. Denn die Lage der Parteien ist hoffnungslos - und das Wahlvolk hat das längst begriffen.
Es gibt eine neue Bewegung in Deutschland. Man redet nicht gern darüber. Denn sie ist gefährlich. Weit gefährlicher als ein bisschen Linkspopulismus hier, ein wenig Rechtspopulismus da: Sie ist größer, bedeutender, attraktiver. Hat in der letzten Zeit rasanten Zulauf erfahren und wird in diesem Jahr womöglich die Spitzenposition erringen.
Es ist eine Partei, die sich von allen anderen Parteien unterscheidet. Bei der Bundestagswahl 2005 lag sie mit 13,8 Millionen Wahlstimmen noch hinter der Union mit 16,6 Millionen und der SPD mit 16,2 Millionen. Aber das könnte sich ändern. Bald schon. Genauer: im Laufe der nächsten sechs Monate.
Es handelt sich, natürlich, um die Partei der Nichtwähler. Ihr Manifest liegt bereits auf dem Tisch: Gabor Steingart, Leiter des "Spiegel"-Büros in Washington, liest der Parteiendemokratie in Deutschland die Leviten und fordert nichts Geringeres als ihre Abschaffung. Denn die Lage der Parteien ist hoffnungslos – und das Wahlvolk hat das längst begriffen.
Das ist kühn gedacht, klug analysiert und süffig geschrieben – und vor allem nicht die übliche ressentimentgeladene Politikerbeschimpfung, wie man fürchten könnte. Denn Politiker hierzulande können ja kaum anders – sie müssen sich systembedingt auf das Machbare beschränken. Das Wünschenswerte und Nötige fällt zugunsten von Herrschaftssicherung unter den Tisch, nicht allein, weil man nicht will, sondern vor allem, weil man nicht kann. Und das liegt an der Rolle der Parteien.
Da ist sie, Angela Merkel, die ihre Partei mehr zu fürchten hat als die Wähler, weshalb sie sie fest an der Kandare hält:
"Es soll nach Demokratie aussehen, aber in Wahrheit bevorzugt sie eine gutartige Form der Despotie."… "Die Gelegenheitskonservative Merkel ist drauf und dran, der CDU das Besondere (…) zu nehmen."
Da ist er, Frank-Walter Steinmeier, ein erstklassiger zweiter Mann, der etwas schaffen soll, was seine Partei gar nicht will:
"Die SPD scheint am glücklichsten, wenn sie nicht regieren muss. Dann schnurrt die Partei wie eine Katze. Der Gefühlshaushalt ihrer Mitglieder ist ausgeglichen, wenn sie Programme schreiben oder Protestplakate malen dürfen. Die Worte ‚Nein’ und ‚Niemals’ lernt ein Sozialdemokrat schon in der Jugendorganisation."
Wenn diese beiden aus unterschiedlichen Gründen eingeschränkten Kräfte eine Koalition eingehen, kann kein Höhenflug entstehen. Ihre reformerische Potenz ist unterdessen auf nahe Null geschrumpft – auf Kosten der Unterscheidbarkeit der beiden nicht mehr wirklich großen "Volks"parteien:
"Als lebe Demokratie von Uniformität, haben sie ihre Unterschiede verleugnet und die Konfliktlinien verwischt. Ihre Lieblingsworte waren nicht Idee, Debatte, Meinungsstreit, wie es sich für ein vitales Gemeinwesen gehört, sondern Koalitionszwang und Geschlossenheit."… "Früher hielt man sich gegenseitig in Schach, heute hält man sich aneinander fest."
Aber wie soll das auch anders sein, bei Parteien, in denen Stillstand das Grundprinzip ist? Die meisten Mitglieder einer Partei sind Männer, gern auch Rentner, aktuell und ehemals öffentlicher Dienst. Ihr Alltag heißt Antragsformular und Rentenbescheid, ihre Lebensziele sind Gleitzeit und Vorruhestand. Es sind ihre Interessen, die die Interessen der Parteien bestimmen, reiner "Machterwerbsagenturen", in denen beizeiten alles aussortiert wird, was nicht dazugehört – der nicht unerhebliche produktive und kreative Rest der Gesellschaft, der die Zeche zahlen muss.
Aber muss man nicht nachsichtig sein? Unsere Parteien sind traumatisiert, nicht erst seit den Nazis, schon seit der Bismarckzeit, als sie verfolgt waren. Doch heute fühlen sie sich nur noch so. Und seit Hitler stilisieren sie das, was eigentlich Parteiversagen war, zu Volksversagen hoch, sagt Steingart – mit Folgen für die Neuentstehung der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg:
"Dass auch die Alliierten den gewöhnlichen Deutschen mißtrauten, traf sich gut. Die Sowjets hielten nichts von Demokratie, und die Westalliierten hielten nicht viel von den Deutschen. So entstand eine indirekte Demokratie, in der das Volk wenig und die Parteien viel zu sagen haben."
Doch nun sieht es ganz so aus, als ob das deutsche Wahlvolk, mit dieser Entwicklung unzufrieden, sich in die "innere Emigration" verzogen hätte. Die Zahl der Wahlenthaltungen hat sich seit den Siebzigerjahren verdoppelt, die der eingeschriebenen Parteimitglieder um die Hälfte verringert. Und niemand mag sie mehr, die Politiker, vor allem jene nicht, die sich, dank sicherer Listenplätze, nie um Erfolg bei ihren Wählern haben bemühen müssen. Sie nennt Steingart die "grauen Gesellen der Parteipolitik", die weder den Wählern noch ihrem Gewissen verantwortlich, aber ihren Parteien bis ans Lebensende verpflichtet sind.
Die hessische SPD hat jüngst bewiesen, wie wenig Gespür in dieser Partei noch vorhanden ist für das, was ein freier Abgeordneter ist und sein soll. Was Wunder: Ein braver Parteisoldat, der mit einem Listenplatz belohnt werden will, ist eines gewiss nicht: frei.
Was hilft? Einfach nicht mehr wählen, sagt Steingart. Und hoffen, dass sie es merken, unsere Parteien, dass ihnen die Legitimation fehlt.
"Es hilft nichts, die Augen vor der fundamentalen Erkenntnis zu verschließen: Die Parteien, Institutionen aus dem späten 19. Jahrhundert, werden von den heutigen Deutschen in ihrer Mehrheit abgelehnt, friedlich, energisch, instinktiv. Wenn es derzeit ein politisches Projekt in Deutschland gibt, dann ist es nicht die Revitalisierung des Parteienstaats, sondern seine Überwindung."
Wer das möchte, darf das System nicht bestätigen, die Parteien nicht zum Weiter-so ermutigen. Denn: "Wer wählt, stimmt zu."
Eine derart radikale Prosa ist Wasser auf die Mühlen des entnervten Wahlvolks, das von den Wahlkampflügen und hohlen Versprechungen die Nase voll hat und sich vor dem kommenden Superwahljahr fürchtet: Es wird ein langes Jahr der platten Parolen und Worthülsen werden, während dessen die Politiker die Wirtschaftskrise sich selbst überlassen bzw. demjenigen Teil der Bevölkerung, der sich nach Leibeskräften bemüht, sie zu bewältigen.
Über Gabor Steingarts Thesen und Vorschläge mag man im einzelnen streiten. Aber seine Vision eines gigantischen Denkzettels ist bestechend. Werden sich demnächst die Nichtwähler vor den Wahllokalen zusammenrotten und ein Volksfest feiern? Oder werden wir zum zigsten Mal die Wiederauferstehung des Immergleichen erleben? Abwarten – und mal wieder ein Buch lesen. Vielleicht sogar dieses hier.
Gabor Steingart: Die Machtfrage
Piper Verlag
Es ist eine Partei, die sich von allen anderen Parteien unterscheidet. Bei der Bundestagswahl 2005 lag sie mit 13,8 Millionen Wahlstimmen noch hinter der Union mit 16,6 Millionen und der SPD mit 16,2 Millionen. Aber das könnte sich ändern. Bald schon. Genauer: im Laufe der nächsten sechs Monate.
Es handelt sich, natürlich, um die Partei der Nichtwähler. Ihr Manifest liegt bereits auf dem Tisch: Gabor Steingart, Leiter des "Spiegel"-Büros in Washington, liest der Parteiendemokratie in Deutschland die Leviten und fordert nichts Geringeres als ihre Abschaffung. Denn die Lage der Parteien ist hoffnungslos – und das Wahlvolk hat das längst begriffen.
Das ist kühn gedacht, klug analysiert und süffig geschrieben – und vor allem nicht die übliche ressentimentgeladene Politikerbeschimpfung, wie man fürchten könnte. Denn Politiker hierzulande können ja kaum anders – sie müssen sich systembedingt auf das Machbare beschränken. Das Wünschenswerte und Nötige fällt zugunsten von Herrschaftssicherung unter den Tisch, nicht allein, weil man nicht will, sondern vor allem, weil man nicht kann. Und das liegt an der Rolle der Parteien.
Da ist sie, Angela Merkel, die ihre Partei mehr zu fürchten hat als die Wähler, weshalb sie sie fest an der Kandare hält:
"Es soll nach Demokratie aussehen, aber in Wahrheit bevorzugt sie eine gutartige Form der Despotie."… "Die Gelegenheitskonservative Merkel ist drauf und dran, der CDU das Besondere (…) zu nehmen."
Da ist er, Frank-Walter Steinmeier, ein erstklassiger zweiter Mann, der etwas schaffen soll, was seine Partei gar nicht will:
"Die SPD scheint am glücklichsten, wenn sie nicht regieren muss. Dann schnurrt die Partei wie eine Katze. Der Gefühlshaushalt ihrer Mitglieder ist ausgeglichen, wenn sie Programme schreiben oder Protestplakate malen dürfen. Die Worte ‚Nein’ und ‚Niemals’ lernt ein Sozialdemokrat schon in der Jugendorganisation."
Wenn diese beiden aus unterschiedlichen Gründen eingeschränkten Kräfte eine Koalition eingehen, kann kein Höhenflug entstehen. Ihre reformerische Potenz ist unterdessen auf nahe Null geschrumpft – auf Kosten der Unterscheidbarkeit der beiden nicht mehr wirklich großen "Volks"parteien:
"Als lebe Demokratie von Uniformität, haben sie ihre Unterschiede verleugnet und die Konfliktlinien verwischt. Ihre Lieblingsworte waren nicht Idee, Debatte, Meinungsstreit, wie es sich für ein vitales Gemeinwesen gehört, sondern Koalitionszwang und Geschlossenheit."… "Früher hielt man sich gegenseitig in Schach, heute hält man sich aneinander fest."
Aber wie soll das auch anders sein, bei Parteien, in denen Stillstand das Grundprinzip ist? Die meisten Mitglieder einer Partei sind Männer, gern auch Rentner, aktuell und ehemals öffentlicher Dienst. Ihr Alltag heißt Antragsformular und Rentenbescheid, ihre Lebensziele sind Gleitzeit und Vorruhestand. Es sind ihre Interessen, die die Interessen der Parteien bestimmen, reiner "Machterwerbsagenturen", in denen beizeiten alles aussortiert wird, was nicht dazugehört – der nicht unerhebliche produktive und kreative Rest der Gesellschaft, der die Zeche zahlen muss.
Aber muss man nicht nachsichtig sein? Unsere Parteien sind traumatisiert, nicht erst seit den Nazis, schon seit der Bismarckzeit, als sie verfolgt waren. Doch heute fühlen sie sich nur noch so. Und seit Hitler stilisieren sie das, was eigentlich Parteiversagen war, zu Volksversagen hoch, sagt Steingart – mit Folgen für die Neuentstehung der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg:
"Dass auch die Alliierten den gewöhnlichen Deutschen mißtrauten, traf sich gut. Die Sowjets hielten nichts von Demokratie, und die Westalliierten hielten nicht viel von den Deutschen. So entstand eine indirekte Demokratie, in der das Volk wenig und die Parteien viel zu sagen haben."
Doch nun sieht es ganz so aus, als ob das deutsche Wahlvolk, mit dieser Entwicklung unzufrieden, sich in die "innere Emigration" verzogen hätte. Die Zahl der Wahlenthaltungen hat sich seit den Siebzigerjahren verdoppelt, die der eingeschriebenen Parteimitglieder um die Hälfte verringert. Und niemand mag sie mehr, die Politiker, vor allem jene nicht, die sich, dank sicherer Listenplätze, nie um Erfolg bei ihren Wählern haben bemühen müssen. Sie nennt Steingart die "grauen Gesellen der Parteipolitik", die weder den Wählern noch ihrem Gewissen verantwortlich, aber ihren Parteien bis ans Lebensende verpflichtet sind.
Die hessische SPD hat jüngst bewiesen, wie wenig Gespür in dieser Partei noch vorhanden ist für das, was ein freier Abgeordneter ist und sein soll. Was Wunder: Ein braver Parteisoldat, der mit einem Listenplatz belohnt werden will, ist eines gewiss nicht: frei.
Was hilft? Einfach nicht mehr wählen, sagt Steingart. Und hoffen, dass sie es merken, unsere Parteien, dass ihnen die Legitimation fehlt.
"Es hilft nichts, die Augen vor der fundamentalen Erkenntnis zu verschließen: Die Parteien, Institutionen aus dem späten 19. Jahrhundert, werden von den heutigen Deutschen in ihrer Mehrheit abgelehnt, friedlich, energisch, instinktiv. Wenn es derzeit ein politisches Projekt in Deutschland gibt, dann ist es nicht die Revitalisierung des Parteienstaats, sondern seine Überwindung."
Wer das möchte, darf das System nicht bestätigen, die Parteien nicht zum Weiter-so ermutigen. Denn: "Wer wählt, stimmt zu."
Eine derart radikale Prosa ist Wasser auf die Mühlen des entnervten Wahlvolks, das von den Wahlkampflügen und hohlen Versprechungen die Nase voll hat und sich vor dem kommenden Superwahljahr fürchtet: Es wird ein langes Jahr der platten Parolen und Worthülsen werden, während dessen die Politiker die Wirtschaftskrise sich selbst überlassen bzw. demjenigen Teil der Bevölkerung, der sich nach Leibeskräften bemüht, sie zu bewältigen.
Über Gabor Steingarts Thesen und Vorschläge mag man im einzelnen streiten. Aber seine Vision eines gigantischen Denkzettels ist bestechend. Werden sich demnächst die Nichtwähler vor den Wahllokalen zusammenrotten und ein Volksfest feiern? Oder werden wir zum zigsten Mal die Wiederauferstehung des Immergleichen erleben? Abwarten – und mal wieder ein Buch lesen. Vielleicht sogar dieses hier.
Gabor Steingart: Die Machtfrage
Piper Verlag
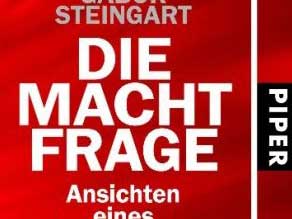
Cover: "Gabor Steingart: Die Machtfrage"© Piper Verlag
