Eine ungewöhnliche Freundschaft
Rüdiger Safranski stellt in "Goethe und Schiller" die Geschichte dieser für die Dichtung so wichtigen Begegnung dar. Denn die Freundschaft der beiden Schriftsteller gilt als ungewöhnlich.
Sie gehört zu den schönsten Momenten deutscher Nationalgeschichte, die Freundschaft zwischen Goethe und Schiller. Schließlich kommt es nur äußerst selten vor, dass ein Genie das andere nicht nur erkennt, sondern auch schätzt und ihm nichts neidet, ja zum Ruhm des anderen noch selbst beiträgt.
Wie ungewöhnlich diese Beziehung war, kann man an der Einsamkeit eines anderen Genies ermessen: Mit wem hätte Napoleon außer mit den nichtsnutzigen Verwandten Freundschaft schließen sollen? Entweder hatte er Diener, zu denen auch ein Talleyrand gehörte, oder Feinde und niemals hat der Korse auch nur auf ein Quäntchen seines Ruhmes zugunsten eines seiner Marschälle verzichtet. Im Gegenteil: Er vereinnahmte den Ruhm auch dort, wo er – wie bei Marengo - einem anderen zustand.
Ganz anders die deutschen Dichterfürsten. Vieles wusste man schon, das Meiste wurde schon oft aufgeschrieben, und doch liest es sich immer wieder spannend, das Werden einer Freundschaft. Dabei stand das Ergebnis nie fest, der Erfolg war keinesfalls ausgemacht. Die Widerstände waren gewaltig, und die Unterschiede zwischen zwei absoluten Herrschern im selben Reich des Geistes beträchtlich.
Was Rüdiger Safranski in seinem Buch schildert, bleibt deshalb spannend, obwohl wir den Ausgang kennen. Denn immer von Neuem müssen Unterschiede, Lebensanschauungen, ja Gewohnheiten dem anderen angepasst werden. Das beginnt schon bei den Dingen des täglichen Lebens.
Schiller war oft krank, Goethe hasste Krankheiten; Schiller brauchte Stimulanzien wie Kaffee, Wein, Arrak, Schnupftabak oder die berühmten fauligen Äpfel, deren Geruch Goethe zur Verzweiflung brachte. Schiller konnte größere Menschenansammlungen kaum ertragen und wurde deshalb bei geselligen Abenden im Haus am Frauenplan in einen kleinen Salon gesetzt, wo nicht mehr als sechs Personen Platz fanden.
Erstaunlich auch, wie der angebliche Revolutionär und Tyrannenfeind auf bürgerliche Ordnung und Etikette hielt. Er mochte weder Goethes unordentliches Liebesleben noch seinen Bettschatz Christiane, die er nie grüßen ließ und sich auch nicht bei ihr für Speis und Trank bedankte. Und dann der Altersunterschied und die so verschiedenartigen Lebensumstände. Die erste Begegnung war nicht vielversprechend. Schillers Resümee:
"Ich zweifle ob wir einander je sehr nahe rücken werden. Vieles, was mir jetzt noch interessant ist, was ich noch zu wünschen und zu hoffen habe, hat seine Epoche bei ihm durchlebt; er ist mir an Jahren weniger als an Lebenserfahrungen und Selbstentwicklung soweit voraus, dass wir unterwegs nie mehr zusammenkommen werden; und sein ganzes Wesen ist schon von Anfang her anders angelegt als das meinige, seine Welt ist nicht die meinige, unsere Vorstellungsarten scheinen wesentlich verschieden."
Und tatsächlich betrachteten sie die Dinge der Welt, aber auch die Dichtkunst aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Goethe geht den Weg vom Besonderen zum Allgemeinen, von der Anschauung zur Gesetzmäßigkeit, während Schiller vom Allgemeinen, von den Ideen und Begriffen zum Besonderen herabsteigt. Er hat es selbst ganz unnachahmlich oder, wie Safranski schreibt, mit beispielloser Prägnanz formuliert.
"Weil mein Gedankenkreis kleiner ist, so durchlaufe ich ihn eben darum schneller und öfter und kann eben darum meine kleine Barschaft besser nutzen, und eine Mannigfaltigkeit, die dem Inhalt fehlt, durch die Form erzeugen. Sie bestreben sich, ihre große Ideenwelt zu simplifizieren, ich suche Varietät für meine kleinen Besitzungen. Sie haben ein Königreich zu regieren, ich nur eine etwas zahlreiche Familie von Begriffen, die ich herzlich gern zu einer kleinen Welt erweitern möchte."
Goethe, so folgert Safranski, regiert ein Königreich der Empirie, Schiller eine kleine Welt von Begriffen.
Doch auch Goethes Beginnen dieser Freundschaft ist eher zögerlich und unentschlossen. Er sieht in Schiller ein kraftvolles aber unreifes Talent, das gerade die "ethischen und theatralischen Paradoxien, von denen er sich zu reinigen bestrebt hatte mit seinen Räubern im vollen hinreißenden Strom über das Vaterland ausgegossen hatte." Es erinnerte ihn zu sehr an die eigenen Tollheiten des Sturm und Drang.
Dass dennoch all dies sich in jener Formel aus den Wahlverwandschaften auflöst, die sich in Ottiliens Tagebuch findet: Gegen große Vorzüge eines anderen gibt es kein Rettungsmittel als die Liebe, ist das eigentliche Wunder dieser Freundschaft. Erstaunlicherweise kamen beide von ganz unterschiedlichen Standpunkten aus bei den beiden großen sie beschäftigenden Lebensfragen – der Bewertung der französischen Revolution und der antiken poetischen Vorbilder – zu denselben Ergebnissen, dass erstere ein Fehlversuch zur Besserung der menschlichen Gesellschaft sei, und letztere gegen den platten Rationalismus eines Nicolai und die in krudem Naturalismus auslaufende "Schlammflut des Banalen" eines Kotzebue verteidigt werden müssten.
Es war eben nicht nur so, dass Schiller auf die Vollendung des Faust drängte, den Wilhelm Meister bewunderte und Goethe den Egmont-Stoff überließ, sondern Goethe dichtete am Wallenstein mit, korrigierte Maria Stuart und unternahm nach Schillers Tod den allerdings erfolglosen Versuch, das Demetrius-Fragment zu vollenden, von den gemeinsamen Xenien und Horen einmal abgesehen.
"Es wird auch meiner Existenz einen ganz anderen Schwung geben", heißt es in einem Brief Schillers an Goethe vom 24. Juli 1799, "wenn wir wieder beisammen sind, denn sie wissen mich immer nach außen und in die Breite zu treiben, wenn ich allein bin, versinke ich in mich selbst."
Was für ein Missverständnis und welche Kleingeisterei, wenn Börne bei Erscheinen des posthumen Briefwechsels zwischen Goethe und Schiller davon spricht, dass beide auf dem ausgetretenen Wege der Selbstsucht wandeln, gefangen in ihren ästhetischen Interessen und gleichgültig gegen die politischen Erfordernisse des Tages; oder Grabbe die ewige Caresse bedauert,
"welche Schiller dem Herrn von Goethe, abgesehen von allen Standesverhältnissen, wegen seines überlegenen Genies glaubt machen zu müssen."
Es geschah ein solches Wunder eben auch in Deutschland nur dieses eine Mal, schon den Nachgeborenen fehlte das Verständnis dafür. Safranskis Buch ist eine schöne Hommage auf eine wunderbare Freundschaft und zugleich ein Dokument zeitlosen Verstehens.
Rüdiger Safranski: Goethe und Schiller. Geschichte einer Freundschaft
Carl Hanser Verlag, München 2009
Wie ungewöhnlich diese Beziehung war, kann man an der Einsamkeit eines anderen Genies ermessen: Mit wem hätte Napoleon außer mit den nichtsnutzigen Verwandten Freundschaft schließen sollen? Entweder hatte er Diener, zu denen auch ein Talleyrand gehörte, oder Feinde und niemals hat der Korse auch nur auf ein Quäntchen seines Ruhmes zugunsten eines seiner Marschälle verzichtet. Im Gegenteil: Er vereinnahmte den Ruhm auch dort, wo er – wie bei Marengo - einem anderen zustand.
Ganz anders die deutschen Dichterfürsten. Vieles wusste man schon, das Meiste wurde schon oft aufgeschrieben, und doch liest es sich immer wieder spannend, das Werden einer Freundschaft. Dabei stand das Ergebnis nie fest, der Erfolg war keinesfalls ausgemacht. Die Widerstände waren gewaltig, und die Unterschiede zwischen zwei absoluten Herrschern im selben Reich des Geistes beträchtlich.
Was Rüdiger Safranski in seinem Buch schildert, bleibt deshalb spannend, obwohl wir den Ausgang kennen. Denn immer von Neuem müssen Unterschiede, Lebensanschauungen, ja Gewohnheiten dem anderen angepasst werden. Das beginnt schon bei den Dingen des täglichen Lebens.
Schiller war oft krank, Goethe hasste Krankheiten; Schiller brauchte Stimulanzien wie Kaffee, Wein, Arrak, Schnupftabak oder die berühmten fauligen Äpfel, deren Geruch Goethe zur Verzweiflung brachte. Schiller konnte größere Menschenansammlungen kaum ertragen und wurde deshalb bei geselligen Abenden im Haus am Frauenplan in einen kleinen Salon gesetzt, wo nicht mehr als sechs Personen Platz fanden.
Erstaunlich auch, wie der angebliche Revolutionär und Tyrannenfeind auf bürgerliche Ordnung und Etikette hielt. Er mochte weder Goethes unordentliches Liebesleben noch seinen Bettschatz Christiane, die er nie grüßen ließ und sich auch nicht bei ihr für Speis und Trank bedankte. Und dann der Altersunterschied und die so verschiedenartigen Lebensumstände. Die erste Begegnung war nicht vielversprechend. Schillers Resümee:
"Ich zweifle ob wir einander je sehr nahe rücken werden. Vieles, was mir jetzt noch interessant ist, was ich noch zu wünschen und zu hoffen habe, hat seine Epoche bei ihm durchlebt; er ist mir an Jahren weniger als an Lebenserfahrungen und Selbstentwicklung soweit voraus, dass wir unterwegs nie mehr zusammenkommen werden; und sein ganzes Wesen ist schon von Anfang her anders angelegt als das meinige, seine Welt ist nicht die meinige, unsere Vorstellungsarten scheinen wesentlich verschieden."
Und tatsächlich betrachteten sie die Dinge der Welt, aber auch die Dichtkunst aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Goethe geht den Weg vom Besonderen zum Allgemeinen, von der Anschauung zur Gesetzmäßigkeit, während Schiller vom Allgemeinen, von den Ideen und Begriffen zum Besonderen herabsteigt. Er hat es selbst ganz unnachahmlich oder, wie Safranski schreibt, mit beispielloser Prägnanz formuliert.
"Weil mein Gedankenkreis kleiner ist, so durchlaufe ich ihn eben darum schneller und öfter und kann eben darum meine kleine Barschaft besser nutzen, und eine Mannigfaltigkeit, die dem Inhalt fehlt, durch die Form erzeugen. Sie bestreben sich, ihre große Ideenwelt zu simplifizieren, ich suche Varietät für meine kleinen Besitzungen. Sie haben ein Königreich zu regieren, ich nur eine etwas zahlreiche Familie von Begriffen, die ich herzlich gern zu einer kleinen Welt erweitern möchte."
Goethe, so folgert Safranski, regiert ein Königreich der Empirie, Schiller eine kleine Welt von Begriffen.
Doch auch Goethes Beginnen dieser Freundschaft ist eher zögerlich und unentschlossen. Er sieht in Schiller ein kraftvolles aber unreifes Talent, das gerade die "ethischen und theatralischen Paradoxien, von denen er sich zu reinigen bestrebt hatte mit seinen Räubern im vollen hinreißenden Strom über das Vaterland ausgegossen hatte." Es erinnerte ihn zu sehr an die eigenen Tollheiten des Sturm und Drang.
Dass dennoch all dies sich in jener Formel aus den Wahlverwandschaften auflöst, die sich in Ottiliens Tagebuch findet: Gegen große Vorzüge eines anderen gibt es kein Rettungsmittel als die Liebe, ist das eigentliche Wunder dieser Freundschaft. Erstaunlicherweise kamen beide von ganz unterschiedlichen Standpunkten aus bei den beiden großen sie beschäftigenden Lebensfragen – der Bewertung der französischen Revolution und der antiken poetischen Vorbilder – zu denselben Ergebnissen, dass erstere ein Fehlversuch zur Besserung der menschlichen Gesellschaft sei, und letztere gegen den platten Rationalismus eines Nicolai und die in krudem Naturalismus auslaufende "Schlammflut des Banalen" eines Kotzebue verteidigt werden müssten.
Es war eben nicht nur so, dass Schiller auf die Vollendung des Faust drängte, den Wilhelm Meister bewunderte und Goethe den Egmont-Stoff überließ, sondern Goethe dichtete am Wallenstein mit, korrigierte Maria Stuart und unternahm nach Schillers Tod den allerdings erfolglosen Versuch, das Demetrius-Fragment zu vollenden, von den gemeinsamen Xenien und Horen einmal abgesehen.
"Es wird auch meiner Existenz einen ganz anderen Schwung geben", heißt es in einem Brief Schillers an Goethe vom 24. Juli 1799, "wenn wir wieder beisammen sind, denn sie wissen mich immer nach außen und in die Breite zu treiben, wenn ich allein bin, versinke ich in mich selbst."
Was für ein Missverständnis und welche Kleingeisterei, wenn Börne bei Erscheinen des posthumen Briefwechsels zwischen Goethe und Schiller davon spricht, dass beide auf dem ausgetretenen Wege der Selbstsucht wandeln, gefangen in ihren ästhetischen Interessen und gleichgültig gegen die politischen Erfordernisse des Tages; oder Grabbe die ewige Caresse bedauert,
"welche Schiller dem Herrn von Goethe, abgesehen von allen Standesverhältnissen, wegen seines überlegenen Genies glaubt machen zu müssen."
Es geschah ein solches Wunder eben auch in Deutschland nur dieses eine Mal, schon den Nachgeborenen fehlte das Verständnis dafür. Safranskis Buch ist eine schöne Hommage auf eine wunderbare Freundschaft und zugleich ein Dokument zeitlosen Verstehens.
Rüdiger Safranski: Goethe und Schiller. Geschichte einer Freundschaft
Carl Hanser Verlag, München 2009
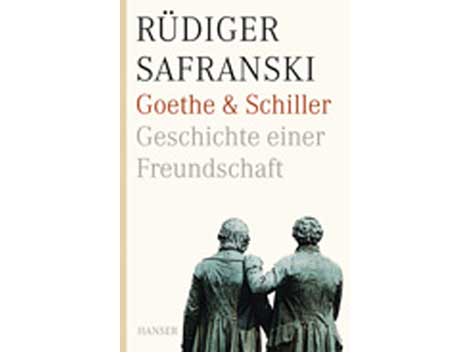
Cover: "Rüdiger Safranski: Goethe und Schiller"© Karl Hanser Verlag
