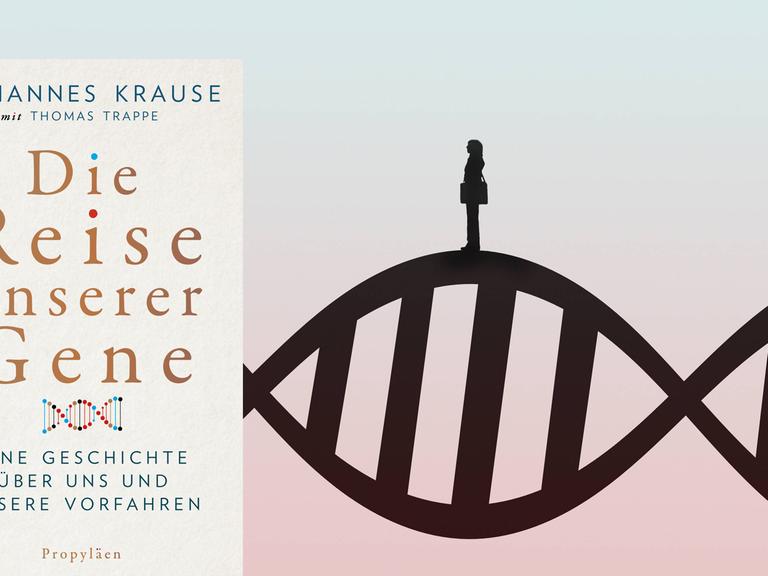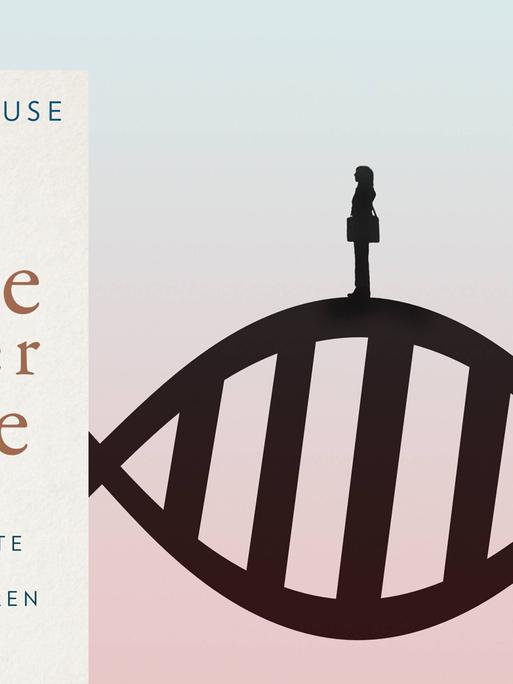Jan Plamper, geboren 1970 in Laichingen, Baden-Württemberg, ist Professor für Geschichte am Goldsmiths College der Universität London. Nach Studium in den USA mit Schwerpunkt Osteuropäische Geschichte befasst Plamper sich derzeit vor allem mit der Historie von Emotionen und mit Migration.
Sein jüngstes Buch: "Das neue Wir. Warum Migration dazugehört. Eine andere Geschichte der Deutschen". S. Fischer Verlag 2019, 400 Seiten, 20 Euro.
Deutsche und Plusdeutsche
29:28 Minuten

Migration ist in Deutschland eine Erfolgsgeschichte. Zu diesem Fazit kommt der Historiker Jan Plamper in seiner Analyse der Zuwanderung in unser Land – von den Vertriebenen der Nachkriegszeit bis zu den Flüchtlingen von heute.
"Jeder ist Migrant, fast überall, fast immer – besonders die Deutschen." Diese These belegt der Migrations- und Gefühls-Historiker Jan Plamper mit einer Fülle von Daten und Geschichten über das Einwanderungsland Deutschland.
Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen sind nach dem Krieg hierher gekommen, später "Gastarbeiter" in den Westen, "Vertragsarbeiter" in den Osten, Spätaussiedler, jüdische Kontingentflüchtlinge, Asylbewerber. Und jüngst jene, die vor dem Krieg in Syrien geflohen sind.
Migration, schlussfolgert Jan Plamper, ist ein ganz wesentlicher Teil deutscher Geschichte. Und dies mitzudenken könne uns helfen, eine positive nationale Identität zu finden, die alteingesessene Deutsche ebenso einbezieht wie Zuwanderer. "Plusdeutsche" nennen sich letztere manchmal selbst, also Deutsche, die eine zusätzliche migrantische Zugehörigkeit haben.
Die nationale Salatschüssel
Plampers Vision des Einwanderungslands Deutschland ist nicht der "melting pot", also der Schmelztiegel, an dem die USA sich lange orientiert haben. "Das neue Wir" – so der Titel seines jüngsten Buchs – sieht Jan Plamper eher als eine Art Salatschüssel: Die Nation als Gefäß, in der die Vielfalt der Menschen und ihrer Identitäten ein buntes Multikulti-Gemisch ergibt.
Das Dressing dieses Salats solle keine in Stein gemeißelte deutsche Leitkultur sein, sondern ein von Respekt und Toleranz getragener Diskurs über Werte und Ziele. Also eine nationale Identität im ständigen Werden.
Das Interview im Wortlaut:
Deutschlandfunk Kultur: Wer sind wir eigentlich, wir Deutschen? Wer gehört dazu bei uns und wer nicht? Die uralte Frage nach unserer nationalen Identität bekommt durch die Migrationsdebatte wieder mal enorme Brisanz. Historiker reagieren auf solche Aufgeregtheiten gern mit einem nüchternen, tiefen Blick in die Geschichte.
Ein Historiker sitzt heute bei mir am Tisch. Guten Tag, Prof. Jan Plamper vom Goldsmiths College der Universität London.
Jan Plamper: Guten Tag. Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur: Herr Plamper, Sie haben gerade ein Buch geschrieben, das eine "andere Geschichte der Deutschen" bieten soll, mit dem Untertitel: "Warum Migration dazu gehört". Also eine Geschichte des Einwanderungslandes Deutschland nach dem Motto: Wer kam wann, warum, wie hierher?
Plamper: Ja, das ist es genau. Es ist eine erzählende Geschichte, die sich an den zahlenmäßig wichtigsten Einwanderergruppen entlang hangelt, die aber auch sich versteht als Beitrag zur Migrationsdebatte.
Deutschlandfunk Kultur: Also, es sind nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern es geht auch darum, sich an der Debatte zu beteiligen. Sie führen in diesem Buch unter anderem detailliert aus, wie mobil die Menschen in Europa eigentlich immer schon waren. Im Mittelalter haben Bauern ihre Scholle verlassen, um anderswo ein besseres Leben zu finden. Handwerker waren, sind auf der Walz. Im 18. und 19. Jahrhundert sind Hunderttausende von Deutschen ausgewandert. Deutschland war damals ein Auswanderungs-, nicht ein Einwanderungsland.
Alles schön und gut, aber was sagt uns das heute in unserer Situation?
Der Blick in die Geschichte lehrt Demut
Plamper: Das sagt uns zweierlei. Einerseits sagt es uns, dass – wenn man in die Geschichte schaut und sieht, wie schnell ein Land vom Aus- zum Einwanderungsland werden kann – es sehr wahrscheinlich ist, dass Deutschland auch wieder einmal ein Auswanderungsland wird. Und dass Migranten aus Deutschland dann ähnliche Erfahrungen machen werden wie Migrierte jetzt in Deutschland. Also, es lehrt Demut.
Aber es zeigt auch, dass die Vorstellung von einem homogenen Deutschland, das es schon immer gab, die letztlich doch ethno-biologisch gefasst ist und die immer noch rumgeistert, wirklich nicht stimmt.
Deutschlandfunk Kultur: Sie schreiben, die Geschichte der Migration in Deutschland sei alles in allem eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. Das sehen manche Zeitgenossen anders, zumindest was die Zuwanderung von Flüchtlingen in den letzten Jahren betrifft.
Sie als Historiker, beziehen Sie diesen aktuell noch laufenden Vorgang der sogenannten Flüchtlingswelle der letzten Jahre in Ihre Analyse oder in Ihr Fazit als Erfolgsgeschichte schon mit ein?
"Größte soziale Bewegung in der Geschichte der Bundesrepublik"
Plamper: Das wäre zu früh, aber ich halte es auf jeden Fall für einen großen Erfolg, was 2015 passiert ist. Ich halte die Willkommenskultur, die echte Solidarität von Menschen für andere Menschen über Grenzen hinweg für einen großen Erfolg. In der Hinsicht ist das Buch auch ein Versuch, da was zu korrigieren, ein Narrativ zu korrigieren, eben nicht von einer Krise zu sprechen, sondern erstmal das eigentlich Erklärungsbedürftige zu erklären, nämlich die große Frage, wie es dazu kam, dass die größte soziale Bewegung der Geschichte der Bundesrepublik im Sommer 2015, zahlenmäßig ist sie das nämlich, zustande kam.
Deutschlandfunk Kultur: Also die Bewegung derer, die sich für Flüchtlinge engagiert haben, die Flüchtlinge aufgenommen haben, die Orientierungshilfe gegeben haben, die Patenschaften übernommen haben?
Plamper: Genau, in verschiedenster Form Patenschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Hausaufgabenhilfe, Spenden, Sachspenden, Empfangskomitees etc., etc. – all das zusammen genommen. Und das baut aber natürlich auf auf einer viel längeren Geschichte, die eigentlich in den 1980er Jahren beginnt für damalige Asylbewerber. Und diese Bürgerinitiativen, bis hin zu sehr linken Antirassismus-Initiativen, die ihren Kopf hingehalten haben in dem Kampf gegen Neonazis vor allem in den 90er Jahren, das darf man nie vergessen, die haben eigentlich den Boden bereitet dafür, dass diese Helferszene, die sogenannte, in der Willkommenskultur 2015 entstehen konnte.
Deutschlandfunk Kultur: Und es war tatsächlich zahlenmäßig die größte Bürgerbewegung in der Bundesrepublik?
Plamper: Ja. Selbst konservative Schätzungen kommen auf eine Zahl von ca. zehn Millionen Menschen. Das sind mehr als damals in Bonn gegen den Nato-Doppelbeschluss Anfang der 80er Jahre demonstriert haben. Es sind mehr als bei der größten Montagsdemonstration 1989 gegen das DDR-Regime. Es ist, wie es viele Sozialwissenschaftler inzwischen sehen, mit Abstand die größte soziale Bewegung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Deutschlandfunk Kultur: Bemerkenswerte Zahlen. Aber Sie wollen sicher nicht nur, wie Sie sagten, auf Zahlen oder auf Fakten begrenzen, sondern auch einen Diskussionsbeitrag leisten. Deshalb haben Sie Ihrem Buch den Titel gegeben: "Das neue Wir". "Wir", damit meinen Sie sicher die Deutschen. Aber was ist oder was soll daran neu sein an diesem Wir?
Multikulti ohne kollektive Identität funktioniert nicht
Plamper: Das neue Wir bedeutet für mich zweierlei. Zum einen ist es ganz einfach die Summe der deutschen Staatsbürger, einschließlich derer, die zugewandert sind, die oft vergessen werden, auch aus Geschichten rausgeschrieben werden, nicht beachtet werden. Aber zum zweiten ist es der Vorschlag einer ja emotional symbolisch überhöhten oder angereicherten Kollektividentität. Das heißt, ich bin zu dem Schluss gekommen, nachdem ich lange postnational gedacht hatte, dass Multikulturalismus, verstanden als Nebeneinanderleben von verschiedenen Herkunftskulturen, ohne ein Dach drüber, ohne eine Kollektividentität nicht mehr aktuell ist, dass es nicht funktioniert und dass es auch eine Kollektividentität braucht.
Das Neue ist aber: Ich mache den Vorschlag, dass eben die Herkunftskultur, die Herkunftssprachen zusammengehen können mit der Kollektividentität. Das ist ein Modell, wie es eigentlich dem amerikanischen Salatschüsselmodell, wie man das nennt, seit den 1960er Jahren ähnlich ist. Also, viele bunte Blätter eines Salats, aber zusammengehalten durch die Salatschlüssel. Das hat das Schmelztiegelmodell, also: Gib auf, was du noch an Herkunftskultur mitbringst, deine deutsche, italienische etc. Herkunft, gib das auf und verschmelze dich zu einem homogenen Amerikanertum. Das hat das eben in den 1960er Jahren abgelöst.
Deutschlandfunk Kultur: Und die vielen Geschichten, die Sie erzählen über die Zuwanderungswellen zu Deutschland, beginnend mit den Flüchtlingen und Vertriebenen 1944 bis '48, immerhin zwölf Millionen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind; dann die Gastarbeiter, die Vertragsarbeiter in der DDR usw. usw. Das zeigt uns, dass auch die sogenannten Biodeutschen oder autochthone oder alteingesessenen Deutschen, wenn sie in ihre Geschichte, in ihre Familiengeschichte gucken, auch sehr viel Migrationshintergrund haben.
Ist das sozusagen auch ein einigendes Band für dieses Wir? Wir sind alle irgendwie Migranten, wenn wir lange genug in die Geschichte schauen?
Die Plusdeutschen
Plamper: Absolut. Es kommt immer nur drauf an, wo man anfängt zu zählen. Aber wir sind alle natürlich mal emigriert und wir werden wahrscheinlich auch nochmal emigrieren. Das ist eben der Versuch des zweiten Begriffs, den ich neu einzuführen versuche, nämlich des Begriffs der Plusdeutschen. Das ist nicht mein Begriff. Das ist eine Selbstbezeichnung von Migrierten. Die Alternativbegriffe wären Neudeutsche, Bindestrich-Deutsche und Postmigranten. Und Plusdeutsche hat meines Erachtens unter anderem den Vorteil, dass es ein sehr offener Begriff ist und eben auch deutlich macht: Plusdeutsch kann auch eine regionale Identität sein. Es kann ein Dialekt sein. Es kann eine lokale Identität sein. Es kann vieles mehr sein, aber es macht deutlich, wir leben alle eigentlich verschiedene Identitäten immer gleichzeitig. Und die müssen nicht im Konflikt miteinander sein. Es ist ein offenerer Begriff als zum Beispiel Postmigranten, der auf das Migrantische reduziert ist.
Deutschlandfunk Kultur: Also, ein Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund, wie man das etwas umständlich sagen würde, wäre also ein Plusdeutscher, ein Türkei-Deutscher. Anstelle des Plus würde man dann also sozusagen die Herkunft Türkei setzen. Oder Sie sind von ihrer Geburt her ein Schwaben-Deutscher?
Plamper: So ungefähr. Also, wenn Dieter Bohlen in die Türkei auswandert und seine deutsche Staatsangehörigkeit aufgibt und türkischer Staatsbürger wird, dann wäre er ein Deutsch-Türke. Während Mesut Özil zum Beispiel ein Türkei-Deutscher oder Türken-Deutscher oder Turko-Deutscher, das sind alles selbstbezeichnende Begriffe, wäre. Das heißt, die Herkunft wäre adjektivisch, aber Substantiv wäre das Deutsche.
Es ist schon typisch, dass Leute eigentlich ausgeschlossen werden vom Deutsch-Sein durch diese Bezeichnungen. Also, wir müssen hin zu Türkei-Deutschen statt Deutsch-Türken.
Deutschlandfunk Kultur: Also, wenn ich so denke, könnte ich zum Beispiel mehr Verständnis für die Probleme eines syrischen Flüchtlings haben, wenn ich an meinen eigenen Urgroßvater denke, der in den 1880er Jahren aus Tirol ins Ruhrgebiet migriert ist? Also, wenn ich meinen eigenen, wenn auch schon etwas lange zurückliegenden Migrationshintergrund mir bewusst mache?
Die Vertriebenen und die Salatschüssel
Plamper: Das wäre die Hoffnung, dass es bei denen, die schon länger hier sind, mehr Verständnis, mehr Empathie schafft für die, die noch nicht so lange da sind, einfach weil die Migrationserfahrung universalisiert wird.
Nehmen Sie doch mal das Beispiel der zwölfeinhalb Millionen Vertriebenen, die innerhalb von sechs Jahren gekommen sind. Als die ankamen, da hat man die Rassismen der nationalsozialistischen Zeit fast 1:1 auf die übertragen. "Mulattenzucht" war ein Begriff, der für die verwendet wurde. Dann war die Forderung von der Politik, dass sie sich integrieren, das heißt assimilieren, das heißt, alle herkunftskulturellen Merkmale aus Pommern, aus dem Sudetenland usw. aufgeben. Aber um 1950 hat man kapiert, dass es nicht funktioniert und hat ihnen das Angebot gemacht mit dem altertümlich klingenden Begriff der Brauchtumspflege: Also, hier habt ihr sogar Geld, pflegt eure pommersche Herkunftskultur. Aber ihr seid auch Deutsche. Ihr kriegt auch die deutsche Zugehörigkeit zur deutschen Kollektividentität.
Und dieses Angebot war eigentlich im Rückblick außerordentlich fortschrittlich und modern. Es hat eigentlich das amerikanische Salatschüsselmodell vorweg genommen. Das war so einer der überraschenden Funde bei meinen Recherchen.
Deutschlandfunk Kultur: Also, Integration wurde erstmal gefordert, aber dann doch sehr stark relativiert bei den Flüchtlingen und Vertriebenen.
Plamper: Wenn Integration bedeutet Assimilation, gib alles auf, was du noch mitbringst an kulturellem Gepäck, dann war das die ursprüngliche Forderung. Aber schon um 1950 hat man aufgrund der politischen Stärke der Vertriebenen gemerkt, dass das nicht funktioniert und hat ihnen ein Angebot gemacht von: Pflege deine Herkunftskultur, aber du kannst auch Deutscher sein. Beides passt zusammen. Die schließen sich nicht aus.
Deutschlandfunk Kultur: Also, Integration kann man Ihrer Ansicht nach durchaus fordern, aber man muss dann doch sehr trennscharf gegenüber der Assimilation dabei sein. Also nicht fordern, dass also eigene Zugehörigkeit, eigene Identität dabei verloren geht?
Den Begriff Integration aufgeben
Plamper: Da müsste man wir viel Arbeit machen, um den Begriff wieder so umzudeuten. Er ist leider meiner Ansicht nach besetzt inzwischen als Assimilation. Ich wäre dafür, ihn aufzugeben. Aber wenn man das so umformuliert, wie Sie es gerade getan haben, dann ja, genau das wär’s.
Deutschlandfunk Kultur: Bei den Vertriebenen, später auch bei den Spätaussiedlern sind wir auf dieses Phänomen der Bindestrich-Deutschen gestoßen, das Sie schon angesprochen haben, also zum Beispiel die Sudeten-Deutschen aus dem heutigen Tschechien oder die Russland-Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie bevorzugen den Ausdruck "Plusdeutsche". Das klingt nach einer bunten Vielfalt der Identitäten. Aber in der gesellschaftlichen Wirklichkeit funktioniert das ja oft nicht so einfach.
Sie zitieren Benjamin Franklin, einen der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Der hat 1751 mächtig gegen die angebliche Überfremdung Pennsylvanias durch deutsche Einwanderer gewettert. Der Reflex der Angst vor Überfremdung, vor Unterwanderung, ist der eine anthropologische Konstante, die sich eben immer wieder in der Geschichte zeigt, sobald es zu Migration kommt?
Plamper: Nein, das glaube ich nicht. Also, ich glaube fest, dass es Fortschritt geben kann. Aber es ist in der Tat so, wie Sie gerade gesagt haben, dass den deutschen Einwanderern in den USA Ähnliches widerfahren ist, wie vielen Migrierten in der Bundesrepublik heute oder in den letzten Jahrzehnten.
Der Begriff der Plusdeutschen scheint mir auch besser geeignet zum Beispiel für Spätaussiedler, weil er von dem merkwürdigen, nicht einlösbaren Versprechen befreit, dass man praktisch zu Seinesgleichen nach Hause zurückkehrt. Dort in der Sowjetunion wurden sie diskriminiert als Deutsche, als Faschisten, und jetzt kehren Sie heim gewissermaßen – und sind nicht darauf vorbereit, dass sie eigentlich in eine migrantische Situation kommen.
Wenn das eine plusdeutsche Gruppe unter vielen wäre, dann wäre das viel normaler gewissermaßen. Und es wäre praktisch aufgelöst in einer viel größeren Zahl von Plusdeutschen aus unterschiedlicher Herkunft.
Deutschlandfunk Kultur: Wobei bei dem Beispiel, das Sie genannt haben, die Flüchtlinge und Vertriebenen aus den Jahren 1944 bis '48, dass die so massive Anfeindungen erstmal über sich ergehen lassen mussten, "Mulattenzucht" sagten Sie, das ist ja eigentlich doch erstaunlich, weil das ja eine Minderheit war, die dann gekommen ist, die nicht sichtbar war. Das ganze Thema Ablehnung von anders aussehenden Menschen, um nicht zu sagen Rassismus, hätte bei dieser volksdeutschen Gruppe eigentlich nicht greifen können, hat es aber trotzdem.
Plamper: Es gibt in der Migrationsforschung diesen wichtigen Begriff der sichtbaren Minderheiten. Aber Sie sehen auch hier, dass da so viel Fantasie und auch so viel Fantasmatisches im Spiel ist. Also, damals wurde behauptet, dass die anders riechen, dass sie anders aussehen, dass sie dunkler sind. Das heißt, es wurden wirklich rassistische Eigenschaftsmerkmale aus der NS-Zeit auf die übertragen – völlig unabhängig davon, wie sie aussahen, rochen etc.
Deutschlandfunk Kultur: Erstaunlich. - Herr Plamper, Sie haben schon das Bild der Salatschüssel angebracht: Also die Nation oder der Staat als ein Gefäß, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Kultur nicht zu einem nationalen Eintopf verkocht werden, sondern nebeneinander, miteinander existieren können unter Bewahrung ihrer jeweiligen Eigenarten, also ein buntes Multikulti-Salatgericht.
Aber reicht das? Reicht die gemeinsame Staatsangehörigkeit, vielleicht auch das Grundgesetz, auf das sich alle einigen können, um diese Vielfalt zusammenzuhalten? Oder braucht es nicht auch noch eine kollektive Identität als Bindemittel, sozusagen als Dressing über diesen Salat?
Identität als Diskussionsprozess
Plamper: Das ist ja mein zweiter Vorschlag, die zweite Bedeutung des neuen Wir. Also, das ist nicht nur die Summe aller Staatsbürger, sondern dass es auch eine emotionale oder symbolische Überhöhung gibt. Es gibt ja in diese Richtung gehende Vorschläge: Leitkultur, Patriotismus, Heimat, um nur drei zu Stichworte zu nennen. Und es gibt inzwischen auch Versuche von links, zum Beispiel den Begriff Leitkultur positiv zu besetzen - Jakob Augstein, Raed Saleh.
Mein Problem damit ist, dass der Begriff viel zu sehr besetzt ist meines Erachtens. Er ist schwer zurückzuerobern, viel zu sehr besetzt von rechts und extrem rechts. Das ist das Eine. Das Andere ist, dass selbst bei jemandem wie Raed Saleh dann doch eigentlich unveränderliche, essentielle Eigenschaften für dieses Wir kommen, also für diese Leitkultur.
Ich bin der Meinung, dass der Inhalt des Wir nur auf demokratischem Wege bestimmt werden kann, im Rahmen des Grundgesetzes, aber auf demokratischem Wege. Und das heißt, dass er ergebnisoffen ist.
Zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel: Man beschließt, dass man ein Einwanderungsmuseum haben möchte. Denn merkwürdigerweise gibt’s ja zwar ein Auswandererhaus in Bremerhaven. Es gibt inzwischen auch einen Erweiterungsbau, in dem es um Zuwanderung geht, aber es heißt immer noch Auswandererhaus und es ist in Bremerhaven. Es ist nicht im symbolischen Zentrum der Republik in Berlin.
Dann entsteht eine Debatte. Irgendwann sagt jemand, "ja, aber warum wollen wir das gettoisieren und dieses Museum in Bremerhaven haben? Warum soll es nicht wirklich ins symbolische Zentrum? Warum sollen wir nicht zum Beispiel die beiden Standorte des Deutschen Historischen Museums in Bonn und Berlin, die Dauerausstellungen umbauen? Warum sollen wir da nicht überall Migrierte und Migration einschreiben, dass das eine wichtige Dimension dieser Dauerausstellungen wird?" – Und es geht hin und her. Und irgendwann gibt’s einen Beschluss im Bundestag über ein solches Museum. Das wäre so ein Beispiel.
Oder Einbürgerungszeremonien: Merkwürdigerweise geschieht das heute, wenn Sie deutscher Staatsbürger werden, in Berlin zum Beispiel auf Bezirksebene und auf Landesebene im Roten Rathaus. Es geschieht nicht auf nationaler Ebene, obwohl man eigentlich Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland wird. Das heißt: Wie wäre es, wenn wir darüber nachdenken, wie man das macht, wie man das symbolisch ausgestaltet? Ob das in einem Fußballstadion stattfindet, was für Musik, wie sollen die symbolischen Inhalte von solchen Zeremonien aussehen zum Beispiel?
Aber, wie gesagt, es ist nicht fest. Das wird sich immer den Zeitläuften anpassen. Es wird sich auch der Zusammensetzung der Bevölkerung und den Herkunftskulturen anpassen. – Das wäre mein Vorschlag und die zweite Bedeutung des neuen Wir.
Deutschlandfunk Kultur: Also, keine kanonisierte Leitkultur, in der ein für allemal festgeschrieben worden ist, was gehört an Werten, an Verhaltensweisen, an Zielorientierung dazu, Deutscher zu sein, sondern die Identitätsfindung als immerwährender Diskurs, als ständige öffentliche Diskussion?
Plamper: Richtig. Für den Kanon ist das Grundgesetz zuständig. Davon bin ich überzeugt.
Deutschlandfunk Kultur: Ist das nicht ein bisschen ein elitäres Denken, dieser ständige gesellschaftliche Diskurs? Läuft das nicht auf eine Nation für Bildungsbürger hinaus, die bereit und in der Lage sind, an diesem Diskurs überhaupt teilzunehmen? Und andere, die nicht auf der Höhe der Diskussion sind, die fühlen sich dann wieder abgehängt?
Plamper: Na, aber es gibt doch jede Menge demokratische Entscheidungsprozesse, an denen alle Staatsbürger teilnehmen. Es ist nur so, dass eben diese Dimension der Staatsbürgernation in Deutschland entweder von rechts besetzt wird oder vernachlässigt wurde von links, eben weil es als immer und ewig kontaminiert galt durch den Nationalsozialismus. Und dafür habe ich sehr viel Verständnis. Aber das Problem ist dann, dass eben entweder die Rechten Angebote machen, extrem Rechte, oder dass aus bestimmten Herkunftsländern von Zugewanderten Angebote gemacht werden, die sehr erfolgreich sind. Herkunftsländer, die sich zunehmend ethno-national, in Abkehr ihrer früheren Nationsdefinition übrigens, verstehen - also, zum Beispiel Erdogans Türkei oder Putins Russland. Denken Sie an den Fall Lisa Januar 2016 zurück, mit den Russlanddeutschen.
Deutschlandfunk Kultur: Das russische Mädchen, das angeblich vergewaltigt worden sein sollte von Flüchtlingen.
Für die Bundesrepublik ist die Nation eine Leerstelle
Plamper: Genau, die ganz schnell zu "unserer Lisa", "nascha Lisa" mutierte. Und wie schnell sich Leute russlanddeutscher Herkunft mobilisieren ließen, das liegt unter anderem daran, dass für die Bundesrepublik die Nation nur eine Leerstelle ist und dass sie keine attraktiven, emotional besetzten Gegenangebote macht. Und dass die Leute dann eben, das hat auch was zu tun mit der Mediensituation, mit der digitalen Revolution, mit dem Satellitenfernsehen, und dass sie dann eben zurückgreifen auf die attraktiven Medienangebote der, ich nenne es, "Putin-Propaganda".
Deutschlandfunk Kultur: Sie sagten "emotional besetzt", auch wenn Sie da drüber sprechen, die Zeremonien aufzuwerten. Die Suche nach der nationalen Identität soll für Sie also nicht nur ein Kopfprojekt sein, sondern auch ein Emotionsprojekt? Es soll auch das Gefühl ansprechen, auch um konkurrierende Angeboten wie etwa aus Russland oder aus der Türkei für Menschen mit entsprechendem Hintergrund zu begegnen?
Plamper: Das wäre mein Vorschlag. Also, es basiert auf dem Faktum, dass die Nation – "leider" muss man sagen oder "leider immer noch" – eine wichtige Identitätsressource ist für sehr viele Leute und dass man, wenn man nichts anbietet, eben verliert gegen stark symbolisch angereicherte Angebote, zum Beispiel aus Erdogans Türkei von der AKP, dass man gegen die verliert.
Da muss man rein. Da muss man eigentlich auch ein Angebot machen.
Deutschlandfunk Kultur: Aber wir sehen doch in Europa allenthalben, da muss man nicht bis in die Türkei oder bis nach Russland gehen, dass der Weg vom Nationalgefühl, das ja in vielen Teilen Europas, im Westen wie im Osten, wieder in Schwung kommt, zum Nationalismus doch ein recht kurzer ist. – Ist es nicht ein bisschen riskant, auf ein Nationalgefühl zu setzen, das eben wirklich auch viel mit Gefühl zu tun hat, mit Emotionen?
Plamper: Ja also, wie gesagt, die inhaltliche Ausgestaltung wäre ergebnisoffen und würde auf demokratischem Wege geschehen. Ich lasse das Buch nicht im Telos der Nation enden, sondern ich hoffe natürlich auch, dass irgendwann die Nation verschwinden wird und dass supranationale Gebilde, erstmal eine wirklich funktionierende demokratische EU und später letztlich eine Weltföderation, dass es darauf hinaus läuft. Das ist meine Hoffnung.
Aber im Jetztzustand, so wie die Situation jetzt aussieht, finde ich, darf man die Nationsebene als wichtige Identitätsressource nicht vernachlässigen. Es ist ein Fehler von allen Möglichen, also von Linken, aber auch von Wirtschaftsliberalen, die postnational sind, weil sie an den freien Verkehr von nicht nur Waren und Gütern, sondern auch von Personen über Nationalgrenzen hinweg glauben, es ist ein Fehler nicht dorthin zu gehen und sich nicht zu beteiligen an der Besetzung dieses Feldes.
Ein Buch gegen die Angst
Deutschlandfunk Kultur: Mit Emotionen, Herr Plamper, beschäftigen Sie sich ja wissenschaftlich. Zu Ihren Forschungsgebieten gehört die Geschichte der Gefühle. Am Alfried Krupp Kolleg in Greifswald forschen Sie momentan über Angst, genauer über gesagt, über die Angst russischer Soldaten im Ersten Weltkrieg. Angst spielt ja auch beim Thema Migration eine große Rolle, die Angst vor dem Fremden, die Angst vor den Fremden. – Ist Ihr Buch auch gemeint als Buch gegen die Angst?
Plamper: Absolut. Das Buch ist, wie gesagt, auch eine erzählende Geschichte. Das heißt, Sie werden nicht nur mit Statistiken zu tun haben, sondern es werden sehr viele Menschen, die gelebt haben und die leben, aus Oral History-Archiven, aus viel publizierter Literatur zu Wort kommen. Das heißt, Sie werden sehen, wie die hier in Deutschland ihre Leben aufgebaut haben usw. und werden sehen at the end of the day, dass es gar nicht so schlecht aussieht und dass trotz viel Gewalt, trotz viel, immer noch viel zu viel Rassismus usw., dass wir an sich schon viel weiter sind, als wir mal waren auch noch vor zehn, 15 Jahren.
Wissen Sie, das Buch gründet auf einer Differenzerfahrung. Ich war elf Jahre weg aus Deutschland, die ganzen 90er Jahre hindurch. Und mir schien, dass eigentlich, als ich zurückkehrte, das Zusammenleben, das Leben auf der Alltagsebene gar nicht so schlecht klappt, aber dass das Reden darüber oft von einer Hilflosigkeit geprägt ist, auch bei wohlmeinenden Leuten, und dass es wirklich an der Zeit ist, nicht nur zu kritisieren, sondern zumindest ein paar Vorschläge zu machen von neuen Begriffen und neuen Konzepten.
Deutschlandfunk Kultur: Eine kollektive Identität braucht ja auch Narrative, also die großen Geschichten, mit denen sich irgendwie alle identifizieren, in denen sich irgendwie alle wiederfinden können. – Ist die Geschichte der Migration für Sie eines dieser Narrative, das Alteingesessene und Zugewanderte in Deutschland zusammenbringen kann? Wie wir ja anfangs gesagt haben: Wenn man genau genug hinschaut, haben wir ja fast alle einen Migrationshintergrund.
Das Narrativ der Willkommenskultur
Plamper: Es ist eine Erfolgsgeschichte, also, die Tatsache, dass sich zum Beispiel 2015 so viele sogenannte "Gutmenschen", das ist ein Begriff, den man wirklich zurückerobern muss, der wartet nur darauf, also, dass so viele aus der Helferszene sich beteiligt haben einerseits. Dass aber andererseits auch der Kampf von Geflüchteten selbst die 90er Jahre hindurch, die ganze Refugee-Bewegung, dass die mit neuen Formen des politischen Kampfes, also ich denke an den Marsch durch die Bundesrepublik, der dann in der Besetzung des Oranienplatzes in Berlin Kreuzberg 2012 endete, ich denke an all sowas.* Also das Ineinandergreifen von diesen Bewegungen der Selbstorganisation und Verbündung von Refugees auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Helfern aus den unterschiedlichsten Gruppen, aber auch, wissen Sie, bis hin zur Vereinsebene oder denken Sie nur an die Lichterketten als Zeichen gegen die Pogrome 1992 Rostock-Lichtenhagen, Mölln usw. zurück.
Das griff ineinander und gipfelte in der Willkommenskultur von 2015. Das ist schon ein Narrativ, das sehr, sehr optimistisch stimmt.
Deutschlandfunk Kultur: Was aber vielleicht in vielen politischen Kreisen noch nicht angekommen ist. Denn wenn wir uns die politische Diskussion anschauen, dann wird Zuwanderung bestenfalls als humanitäre Pflicht gesehen, wenn es um Flüchtlinge geht, man kann die Leute ja schließlich nicht ertrinken lassen im Mittelmehr. Oder als wirtschaftliche Notwendigkeit wegen des Fachkräftemangels, wir brauchen halt leider 200.000 zusätzliche Arbeitskräfte pro Jahr. Das klingt mehr nach notwendigem Übel als nach diesem positiven Narrativ, das Sie gerade eben entwickelt haben, diesem positiv auch identitätsstiftenden Narrativ.
Und dem stellen Sie entgegen: Ja, wir sind ein Einwanderungsland, und das ist auch gut so?
Plamper: Ja und nicht nur das. Nur kurz zur Frage des Spurwechsels, die da anklang: Also, wenn Sie gucken in die Geschichte, das ist mir sehr deutlich geworden, dann sehen Sie, dass politische, religiöse und andere Gründe für eine Flucht selten fein säuberlich zu trennen sind von sogenannten wirtschaftlichen Gründen. Also, dass diese Trennung in Wirtschaftsflüchtlinge und vermeintlich echte Geflüchtete, dass das oft doch eine künstliche Trennung ist, das lehrt die Geschichte ganz klar. Und das sollte zu ein bisschen mehr Flexibilität, was die, die jetzt in den vergangenen Jahren gekommen sind, angeht, führen.
An offenen Grenzen wird kein Weg vorbeiführen
Ja, aber ich ende auch das Kapitel über die Willkommenskultur mit Nachdenken über Migrationsethik und die Frage, worauf es denn rauslaufen soll und was von offenen Grenzen zu halten ist. Und mir scheint es folgerichtig, also, wenn man darüber zumindest abstrakt nachdenkt, dass eigentlich nichts an offenen Grenzen vorbei führt. Und dass eigentlich, wenn Demokratie global gedacht wird und Freizügigkeit nicht nur ein Grundrecht der Staatsbürgernationen ist, sondern ein universelles Menschenrecht, dass es eigentlich keine Gegenargumente gibt, warum man zum Beispiel Menschen im Ganges-Delta, in Bangladesch, die gegenüber der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland eine Mehrheit darstellen - es gibt 160 Millionen Bangladeschis und ungefähr 80 Millionen Deutsche - wenn die sich irgendwann mal in Bewegung setzen, mit den Füßen abstimmen sozusagen, dann gibt’s eigentlich keine Gegenargumente, warum die sich nicht neue Lebensgrundlagen in Deutschland aufbauen sollten, wo man doch ihre eigenen im Ganges-Delta durch den Klimawandel etc. zerstört hat.
Deutschlandfunk Kultur: Und das ist für Sie auch eine ethische Frage, also nicht nur eine Frage der Mengenverhältnisse und der Bedarfe an demographischer Auffrischung, die das alte Europa hat?
Plamper: Das ist nicht nur für mich eine ethische Frage, das ist für uns alle eine ethische Frage. Und das schwingt ja auch bei den Diskussionen immer mit.
Deutschlandfunk Kultur: Herr Plamper, wir haben vor allem jetzt über Deutsche gesprochen und Plusdeutsche im Einwanderungsland Deutschland, die zu einem neuen Wir finden könnten. Gewidmet haben Sie Ihr Buch aber nicht den Deutschen und auch nicht den Plusdeutschen, sondern den Papierlosen, also Menschen, die in unser Land gekommen sind und keine Dokumente haben, die etwas über ihre Identität aussagen. – Warum diese Widmung für die Papierlosen?
Plamper: Ja, wissen Sie, wenn man so einen Vorschlag macht zu einer neuen Definition der Staatsbürgernation, die dann auch noch emotional überhöht wird, also diese beiden Bedeutungen des neuen Wir, dann ist es trotzdem so, dass andere dadurch stärker markiert sind. Es ist leider so. Und das sind Leute, die nicht Staatsbürger sind.
Deutschlandfunk Kultur: Also "markiert" sind, also eher ausgeschlossen sind?
Plamper: Genau, eher ausgeschlossen sind. Und das sind Nicht-Staatsbürger. Einerseits ist es gewissermaßen ein Hut-Abziehen vor dem, was die leisten. Jeder Neoliberale müsste die eigentlich über alles lieben, weil es Leute sind, die eben in keinerlei Sozialsysteme einzahlen, die völlig ungeschützt sind und nichts anderes haben als ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen auf einem Schattenmarkt. Aber es gibt die Erfahrung zum Beispiel Spaniens, das Papierlose alle paar Jahre durch eine Amnestie zu Staatsbürgern macht. Das wäre, finde ich, eine Richtung, in die man denken müsste.
Also, eine Widmung eines Buches reicht nicht aus, sondern man müsste in diese Richtung denken.
Deutschlandfunk Kultur: Vielen Dank für das Gespräch.
* Wir haben an dieser Stelle einen inhaltlichen Fehler korrigiert.