Emily Bell, Taylor Owen (Hg.): "Journalism After Snowden. The future of the free press in the surveillance state"
Columbia University Press
344 Seiten, ca. 25 Dollar
Starkes Plädoyer für weniger Überwachung
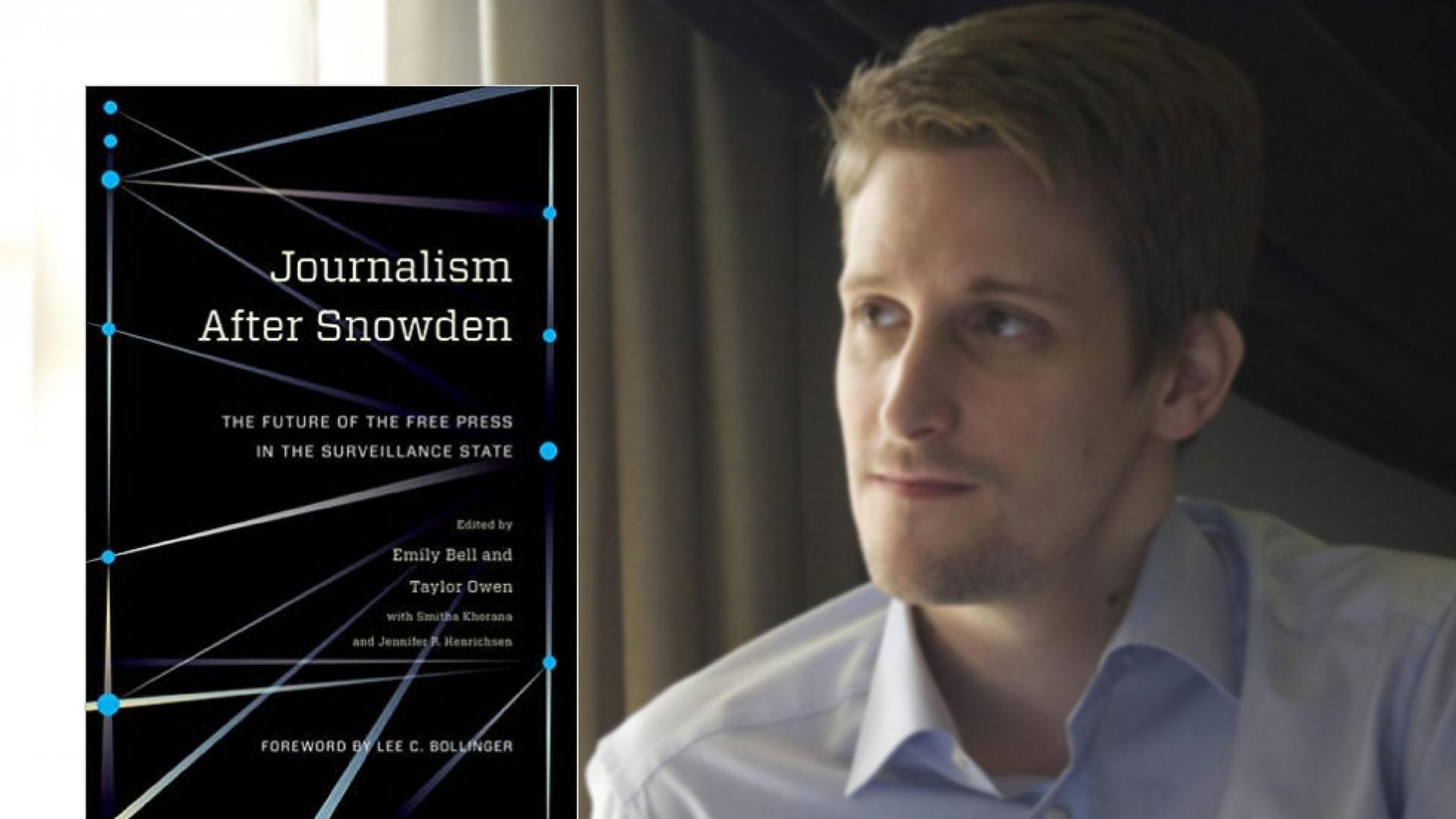
Als Edward Snowden vor vier Jahren NSA-Dokumente dem britischen Guardian zuspielte, veränderte er damit nicht nur sein eigenes Leben und die internationalen Beziehungen, sondern vielleicht auch den Journalismus. Ob dem so ist, fragt jetzt ein auf Englisch erschienener Aufsatzband.
Beim Thema Überwachung gibt es eine Zeit vor Snowden und eine Zeit nach Snowden. Diese Zeitrechnung macht sich auch das Buch "Journalism After Snowden” zu eigen. Darin gesammelt: Zwanzig Essays darüber, was "Journalismus nach Snowden” bedeutet - für die Journalisten, für die Geheimdienste und für die digitale Gesellschaft.
Die Autorenliste ist hochkarätig. Im Buch sind Akteure der Snowden-Enthüllungen vertreten, wie beispielsweise Glenn Greenwald. Also derjenige Journalist, den Snowden zuerst kontaktiert hat. Auch Edward Snowden selbst kommt in einem langen Interview zu Wort. Dazu investigative Journalisten und Pulitzer-Preisträger, führende Medienforscher und Juristen. "Journalism After Snowden” bietet damit eine Vielfalt an Perspektiven und Reflektionen. Nur ein Blickwinkel kommt dabei zu kurz:
"I think he’s a total traitor and I would deal with him harshly.”
Snowden, der totale Verräter - das denkt nicht nur US-Präsident Donald Trump, auch viele Konservative denken genauso. In "Journalism After Snowden” kommt aber nur ein einziger Kritiker zu Wort: Steven Bradbury, Berater im Justizministerium von Bush Junior. Und Bradbury kritisiert den Journalismus nach Snowden heftig:
"Wir beobachten eine neue Art der Klatschpresse, wenn große Redaktionen über die nationale Sicherheit berichten und dabei empfindliche Informationen veröffentlichen. Die Redaktionen berichten dann genüsslich über Details zu Geheimdienst-Operationen. Und sie zeigen dabei wenig Rücksicht für den Schaden, den sie dabei anrichten."
Kein Geheimdienstler wollte sich äußern
Der Hardliner Bradbury bleibt in "Journalism After Snowden” damit die einzige kritische Stimme. Die Herausgeber erklären dazu im Vorwort, dass niemand aus Geheimdienst-Kreisen bereit war, einen Essay beizutragen. Das spielt wiederum den restlichen Autoren in die Hände, denn durch alle Beiträge des Buchs zieht sich die These, dass die Geheimdienste kaum freiwillig transparenter würden. Der nächste Snowden werde nicht nur kommen, er müsse kommen. Und die Journalisten müssten dafür vorbereitet sein, trotz der Möglichkeiten der digitalen Überwachung.
So argumentiert beispielsweise der ehemalige Chefredakteur des britischen Guardian, Alan Rusbridger:
"Es ist unwahrscheinlich, dass die Geheimdienste ihr Verhalten ändern werden. Genauso ist es unheimlich schwierig für die Parlamente, Gesetze zur Überwachung zurückzunehmen, wenn sie einmal beschlossen sind. Deswegen ist die erste Lektion der Ära nach Snowden: Journalisten müssen ihr Verhalten ändern."
Wie das aussehen könne, erklären die darauf folgenden Beiträge, die sich mit ganz praktischen Aspekten beschäftigen: Beispielsweise, wie die anonyme Kommunikation mit Tippgebern möglich ist und wie die Herkunft von Dokumenten verschleiert werden kann. Insofern ist "Journalism After Snowden” auch ein praktisches Handbuch.
Seine stärksten Argumente liefert der Sammelband aber in den trockensten Bereichen wie etwa bei der verfassungsrechtlichen Frage, wer ein Journalist ist und somit im öffentlichen Interesse Geheimdokumente publik machen darf? Um diese Definitionsfrage zu lösen und Tippgeber besser zu schützen, schlägt der Verfassungsrechtler und Medienanwalt David Schulz vor:
"Anstatt den Informantenschutz als Privileg der Journalisten zu verstehen, könnten die Gerichte auch das Recht für anonyme Tippgeber stärken. Es ginge dann weniger um die beruflichen Bedürfnisse und Sonderrechte von Journalisten, sondern um das Recht der Bürger auf Informationen, die nur von anonymen Quellen kommen können.”
Lesenswert - nicht nur für Journalisten
In Kurzform ist dieses Essay eine Vorlage für ein Whistleblower-Gesetz, das die Tippgeber so vor Strafverfolgung schützt, wie die Journalisten bei der Veröffentlichung vor Strafe geschützt sind. Hier erfüllt der Sammelband auch die Erwartung: Wo Snowden draufsteht, da steckt die Forderung nach Straffreiheit für Whistleblower drin.
Obwohl das Buch "Journalism After Snowden” heißt, sind die knapp 300 Seiten nicht nur für US-Amerikaner und Journalisten lesenswert. Die gesammelten Essays sind ein starkes Plädoyer für mehr Transparenz und weniger Überwachung, für die Pressefreiheit und für das Recht auf Whistleblowing. Die Autoren agieren dabei nicht nur auf Basis von nachvollziehbaren Prinzipien, sondern belegen ihre Vision auch mit Beispielen von Watergate bis zu den Panama Papers.




