Entzauberung des charismatischen Führers
Hitler besaß kein Charisma, behauptet der Berliner Historiker Ludolf Herbst, und schlug auch kein blind folgendes Volk in seinen charismatischen Bannstrahl – Hitler war ein von anderen erfundener Messias.
Wer den Begriff Charisma verwendet, um die nationalsozialistische Diktatur zu analysieren, darf längst nicht mehr hoffen, für originell gehalten zu werden. In den Sozialwissenschaften bezeichnet charismatische Herrschaft eine instabile Beziehung zwischen Führer und Gefolgschaft, zwischen Sender und Empfängern, die wie symbiotisch miteinander verbunden sind. Seit langem wird das Konzept von der internationalen Forschung zur Analyse der nationalsozialistischen Herrschaft verwendet. Fast immer stehen die herrschaftstheoretischen Arbeiten Max Webers dafür Pate.
Die Studie von Ludolf Herbst basiert maßgeblich auf edierten und wohlbekannten Quellen. Sie behandelt mit Hitlers früher politischer Karriere ein tausendfach analysiertes Sujet, ist aber dennoch in jeder Hinsicht originell. Herbst bemüht sich allerdings weniger um eine neue Interpretation von Hitlers Charisma als um dessen radikale Entzauberung. Hitler besaß, folgt man Herbst, kein Charisma und schlug auch kein blind folgendes Volk in seinen charismatischen Bannstrahl – Hitler war ein von anderen erfundener Messias.
Herbst sieht die charismatische Sendung als eine von außen hergestellte Fiktion, einen Coup, eine Theateraufführung. Mit guten Argumenten warnt er davor, etwa die berauschenden Propagandaaufnahmen als Ausdruck von Hitlers Strahlkraft zu lesen und verweist darauf, dass auch hier der Mond nur aus Pappe war:
Natürlich kann man auch heute noch von diesen Filmstreifen hingerissen sein; denn wie schon Bert Brecht über die nationalsozialistischen Propagandainszenierungen bemerkte: 'Das ist sehr interessantes Theater.' Und der Hauptdarsteller hatte seine Rolle offenkundig gelernt: 'Er lernte zum Beispiel den Bühnenschritt, das Schreiten der Helden, bei dem man das Knie durchdrückt und die Sohle ganz aufsetzt, um den Gang majestätisch zu machen. Auch die eindrucksvolle Art, die Arme zu kreuzen, lernte er, und auch die lässige Haltung wurde ihm einstudiert.'
These und Argumentation sind so einfach wie verblüffend und man fragt sich beim Lesen, warum die These von der Konstruiertheit sozialer Realitäten, eine der wichtigen Leitideen der neueren Geschichtsschreibung, nicht schon früher so konsequent auf ein so häufig bespiegeltes Sujet angewendet wurde. Herbst hält Hitlers Charisma für einen Mythos und bemüht sich zu demonstrieren, wie dieser Mythos erfunden und feingeschliffen wurde. Seine Analyse beschränkt sich auf die frühen Jahre zwischen 1919 und 1923, also zwischen der Rückkehr des Frontsoldaten Hitler und seinem ersten Großauftritt als scheiternder Putschist in München.
Der heimlose Frontheimkehrer Hitler, der sich an den Randbereichen der Reichswehr über Wasser hielt, besaß weder den biologisch aufgeladenen Antisemitismus, noch das leuchtende Sendungsbewusstsein, für die sein Name später stehen wird. Die hier dargestellte Figur ähnelt zwischen Reichswehr und den völkischen Sumpfgebieten Münchens eher einem Schwamm denn einem Sendboten. Der 30-jährige Meldegänger und Frontsoldat, der 1919 als Spitzel und Informant im Sold der Reichswehr stand, war kein charismatischer Organisator, sondern ein Getriebener auf der Suche nach Bindung und politischer Orientierung. Hitlers Wandel "vom Trommler zum Führer" ist unzählige Male erzählt und oft brillant analysiert worden. Herbst bringt aber erhebliche Korrekturen am Bild an, weil er die gemeinschaftliche Fabrikation einer Führerfigur betont, nicht eine vermeintliche innere Leuchtkraft.
Hitler tritt 1919 nicht als charismatische Persönlichkeit auf die Bühne der Politik, sondern sein Charisma wird von der Reichswehr gewissermaßen an den Tag gefördert. Das Redetalent Hitlers, seine charismatische Begabung, wird in der Reichswehr entdeckt, geschult und auf den Weg gebracht, es wird also in einem Subsystem 'erzeugt' ....
Hitlers Zeit als Reichswehrspitzel, als politischer Informant und bezahlter Redner führte ihn zu überaus erfolgreichen Schwimmversuchen in den brodelnden und unübersichtlichen Sümpfen der völkisch-rechtsradikalen Szene des nach- bzw. gegenrevolutionären Münchens. Herbst beschreibt den Übergang zwischen Reichswehr und rechtsradikaler Szene sowie das hier herausgebildete Netzwerk an Personen als zentral für die Herausbildung dessen, was später als Sendung und Charisma deklariert wird.
In der Gefolgschaft Hitlers unterscheidet Herbst drei verschiedene Kreise – erstens eine Gruppe zumeist älterer Männer, die als Mentoren und Ratgebern fungierten. Zweitens ein Kreis zumeist gleichaltriger Bewunderer, Bodyguards und Jünger. Als dritte Gruppe identifiziert Herbst den weitgezogenen Kreis von Sponsoren, Sympathisanten, Geldgebern, Verlegern und Intellektuellen.
Auch wenn Hitler sehr früh begann, "Jünger" um sich zu sammeln, ist in der Phase bis 1923 eher der Input von außen wichtig, Hitler erscheint hier noch als Ideennehmer, nicht als Ideengeber. Für den politischen Großversuch der deutschen bzw. bayerischen Rechten, Hitler als "Führer" zu lancieren, spielt spätestens seit Mussolinis "Marsch auf Rom" im Oktober 1922, das Vorbild des italienischen Faschismus eine wichtige Rolle.
Von seinen Geld-, und Ideengebern findet Hitler in Kreise, wo er lernt, wie man ein Fischmesser hält und eine Krawatte bindet. Hier wird Hitler auf diversen Ebenen mit Mitgliedern der verschiedenen Funktionseliten verschaltet. Folgt man Herbst, so war Hitlers Charisma zu diesem Zeitpunkt wenig mehr als die Übertragung der messianischen Erwartungen anderer auf die Figur Hitler. Überspitzt gesagt, wird der frühe Hitler hier als Charisma-Beauftragter präsentiert.
Das Buch erneuert en passant die Zweifel an einer späteren rauschhaften Bindung des gesamten deutschen Volkes an seinen Führer. Herbst beschreibt keine Wohlfühldiktatur, sondern betont für die Zeit nach 1933 die Zwangsmechanismen:
(Jeder wusste) dass die Gleichheit vor dem Gesetz im 'Dritten Reich' aufgehoben war, Bagatellvergehen immer wieder unproportional hart bestraft wurden und neben dem Rechtsweg, der unsicher genug geworden war, außernormative terroristische Vollzugsorgane und Einrichtungen wie die Konzentrationslager bestanden, die Willkür ausübten, eine Willkür, die dem Amtscharisma Hitlers etwas orientalisch Unberechenbares verlieh. Jeder, der Hitler persönlich gegenübertrat oder ihn sah, besaß eine Disposition zur Angst, die ihm einen Schauer über den Rücken jagte, den 'heilig' zu nennen es erheblicher Verdrängungskünste bedurfte.
Der Autor verweist auf den bei Max Weber beschriebenen Prozess der Veralltäglichung, die auf jede Form der charismatischen Herrschaft wie Säure wirkt. Nachdrücklich verweist er zudem auf die technische Modernität und Komplexität des NS-Staates, in dem die bürokratische Herrschaft ständig stärker, der Theater-Charakter der charismatischen Komponente hingegen immer deutlicher wurde.
Ludolf Herbst klemmt mit diesem Buch eines der Hauptstromkabel ab, welche die Erklärung des Dritten Reiches seit Jahrzehnten mit Energie versorgen. Die Erklärungsfigur der charismatischen Herrschaft wird hier ausgeknipst wie eine Nachttischlampe. Sollte sich diese Deutung durchsetzen und Hitlers Charisma als Mythos entzaubert werden, wird man bald neue Leuchtquellen finden müssen.
Allerdings erscheint problematisch, das die Analyse im Kern über das Jahr 1923 nicht hinausreicht. Denn selbst wenn der Konstruktionscharakter des Charismas so hoch war, wie Herbst betont, erscheint das Konzept für die späteren Phasen – so etwa die Machtübergabe 1933, die Siegeseuphorie der Jahre 1940 bis 41 oder der Wagnerianische Untergang von 1945 bis auf weiteres unverzichtbar, wenn es gilt, die Besonderheiten dieses Regimes zu erklären. Die Figur des charismatischen Führers skeptisch, scharfsinnig und durch präzise Quelleninterpretation hinterfragt zu haben, ist die große Leistung dieses bemerkenswerten Buches.
Ludolf Herbst:: Hitlers Charisma. Die Erfindung eines deutschen Messias
Verlag S. Fischer, Frankfurt 2010
Die Studie von Ludolf Herbst basiert maßgeblich auf edierten und wohlbekannten Quellen. Sie behandelt mit Hitlers früher politischer Karriere ein tausendfach analysiertes Sujet, ist aber dennoch in jeder Hinsicht originell. Herbst bemüht sich allerdings weniger um eine neue Interpretation von Hitlers Charisma als um dessen radikale Entzauberung. Hitler besaß, folgt man Herbst, kein Charisma und schlug auch kein blind folgendes Volk in seinen charismatischen Bannstrahl – Hitler war ein von anderen erfundener Messias.
Herbst sieht die charismatische Sendung als eine von außen hergestellte Fiktion, einen Coup, eine Theateraufführung. Mit guten Argumenten warnt er davor, etwa die berauschenden Propagandaaufnahmen als Ausdruck von Hitlers Strahlkraft zu lesen und verweist darauf, dass auch hier der Mond nur aus Pappe war:
Natürlich kann man auch heute noch von diesen Filmstreifen hingerissen sein; denn wie schon Bert Brecht über die nationalsozialistischen Propagandainszenierungen bemerkte: 'Das ist sehr interessantes Theater.' Und der Hauptdarsteller hatte seine Rolle offenkundig gelernt: 'Er lernte zum Beispiel den Bühnenschritt, das Schreiten der Helden, bei dem man das Knie durchdrückt und die Sohle ganz aufsetzt, um den Gang majestätisch zu machen. Auch die eindrucksvolle Art, die Arme zu kreuzen, lernte er, und auch die lässige Haltung wurde ihm einstudiert.'
These und Argumentation sind so einfach wie verblüffend und man fragt sich beim Lesen, warum die These von der Konstruiertheit sozialer Realitäten, eine der wichtigen Leitideen der neueren Geschichtsschreibung, nicht schon früher so konsequent auf ein so häufig bespiegeltes Sujet angewendet wurde. Herbst hält Hitlers Charisma für einen Mythos und bemüht sich zu demonstrieren, wie dieser Mythos erfunden und feingeschliffen wurde. Seine Analyse beschränkt sich auf die frühen Jahre zwischen 1919 und 1923, also zwischen der Rückkehr des Frontsoldaten Hitler und seinem ersten Großauftritt als scheiternder Putschist in München.
Der heimlose Frontheimkehrer Hitler, der sich an den Randbereichen der Reichswehr über Wasser hielt, besaß weder den biologisch aufgeladenen Antisemitismus, noch das leuchtende Sendungsbewusstsein, für die sein Name später stehen wird. Die hier dargestellte Figur ähnelt zwischen Reichswehr und den völkischen Sumpfgebieten Münchens eher einem Schwamm denn einem Sendboten. Der 30-jährige Meldegänger und Frontsoldat, der 1919 als Spitzel und Informant im Sold der Reichswehr stand, war kein charismatischer Organisator, sondern ein Getriebener auf der Suche nach Bindung und politischer Orientierung. Hitlers Wandel "vom Trommler zum Führer" ist unzählige Male erzählt und oft brillant analysiert worden. Herbst bringt aber erhebliche Korrekturen am Bild an, weil er die gemeinschaftliche Fabrikation einer Führerfigur betont, nicht eine vermeintliche innere Leuchtkraft.
Hitler tritt 1919 nicht als charismatische Persönlichkeit auf die Bühne der Politik, sondern sein Charisma wird von der Reichswehr gewissermaßen an den Tag gefördert. Das Redetalent Hitlers, seine charismatische Begabung, wird in der Reichswehr entdeckt, geschult und auf den Weg gebracht, es wird also in einem Subsystem 'erzeugt' ....
Hitlers Zeit als Reichswehrspitzel, als politischer Informant und bezahlter Redner führte ihn zu überaus erfolgreichen Schwimmversuchen in den brodelnden und unübersichtlichen Sümpfen der völkisch-rechtsradikalen Szene des nach- bzw. gegenrevolutionären Münchens. Herbst beschreibt den Übergang zwischen Reichswehr und rechtsradikaler Szene sowie das hier herausgebildete Netzwerk an Personen als zentral für die Herausbildung dessen, was später als Sendung und Charisma deklariert wird.
In der Gefolgschaft Hitlers unterscheidet Herbst drei verschiedene Kreise – erstens eine Gruppe zumeist älterer Männer, die als Mentoren und Ratgebern fungierten. Zweitens ein Kreis zumeist gleichaltriger Bewunderer, Bodyguards und Jünger. Als dritte Gruppe identifiziert Herbst den weitgezogenen Kreis von Sponsoren, Sympathisanten, Geldgebern, Verlegern und Intellektuellen.
Auch wenn Hitler sehr früh begann, "Jünger" um sich zu sammeln, ist in der Phase bis 1923 eher der Input von außen wichtig, Hitler erscheint hier noch als Ideennehmer, nicht als Ideengeber. Für den politischen Großversuch der deutschen bzw. bayerischen Rechten, Hitler als "Führer" zu lancieren, spielt spätestens seit Mussolinis "Marsch auf Rom" im Oktober 1922, das Vorbild des italienischen Faschismus eine wichtige Rolle.
Von seinen Geld-, und Ideengebern findet Hitler in Kreise, wo er lernt, wie man ein Fischmesser hält und eine Krawatte bindet. Hier wird Hitler auf diversen Ebenen mit Mitgliedern der verschiedenen Funktionseliten verschaltet. Folgt man Herbst, so war Hitlers Charisma zu diesem Zeitpunkt wenig mehr als die Übertragung der messianischen Erwartungen anderer auf die Figur Hitler. Überspitzt gesagt, wird der frühe Hitler hier als Charisma-Beauftragter präsentiert.
Das Buch erneuert en passant die Zweifel an einer späteren rauschhaften Bindung des gesamten deutschen Volkes an seinen Führer. Herbst beschreibt keine Wohlfühldiktatur, sondern betont für die Zeit nach 1933 die Zwangsmechanismen:
(Jeder wusste) dass die Gleichheit vor dem Gesetz im 'Dritten Reich' aufgehoben war, Bagatellvergehen immer wieder unproportional hart bestraft wurden und neben dem Rechtsweg, der unsicher genug geworden war, außernormative terroristische Vollzugsorgane und Einrichtungen wie die Konzentrationslager bestanden, die Willkür ausübten, eine Willkür, die dem Amtscharisma Hitlers etwas orientalisch Unberechenbares verlieh. Jeder, der Hitler persönlich gegenübertrat oder ihn sah, besaß eine Disposition zur Angst, die ihm einen Schauer über den Rücken jagte, den 'heilig' zu nennen es erheblicher Verdrängungskünste bedurfte.
Der Autor verweist auf den bei Max Weber beschriebenen Prozess der Veralltäglichung, die auf jede Form der charismatischen Herrschaft wie Säure wirkt. Nachdrücklich verweist er zudem auf die technische Modernität und Komplexität des NS-Staates, in dem die bürokratische Herrschaft ständig stärker, der Theater-Charakter der charismatischen Komponente hingegen immer deutlicher wurde.
Ludolf Herbst klemmt mit diesem Buch eines der Hauptstromkabel ab, welche die Erklärung des Dritten Reiches seit Jahrzehnten mit Energie versorgen. Die Erklärungsfigur der charismatischen Herrschaft wird hier ausgeknipst wie eine Nachttischlampe. Sollte sich diese Deutung durchsetzen und Hitlers Charisma als Mythos entzaubert werden, wird man bald neue Leuchtquellen finden müssen.
Allerdings erscheint problematisch, das die Analyse im Kern über das Jahr 1923 nicht hinausreicht. Denn selbst wenn der Konstruktionscharakter des Charismas so hoch war, wie Herbst betont, erscheint das Konzept für die späteren Phasen – so etwa die Machtübergabe 1933, die Siegeseuphorie der Jahre 1940 bis 41 oder der Wagnerianische Untergang von 1945 bis auf weiteres unverzichtbar, wenn es gilt, die Besonderheiten dieses Regimes zu erklären. Die Figur des charismatischen Führers skeptisch, scharfsinnig und durch präzise Quelleninterpretation hinterfragt zu haben, ist die große Leistung dieses bemerkenswerten Buches.
Ludolf Herbst:: Hitlers Charisma. Die Erfindung eines deutschen Messias
Verlag S. Fischer, Frankfurt 2010
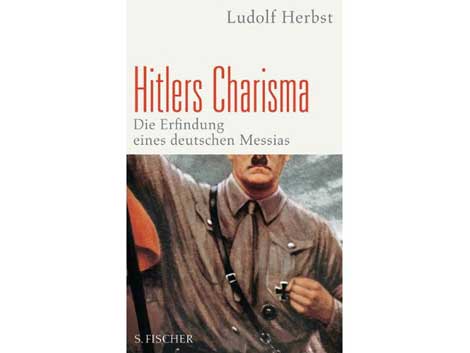
Buchcover: Ludolf Herbst - Hitlers Charisma© S. Fischer
