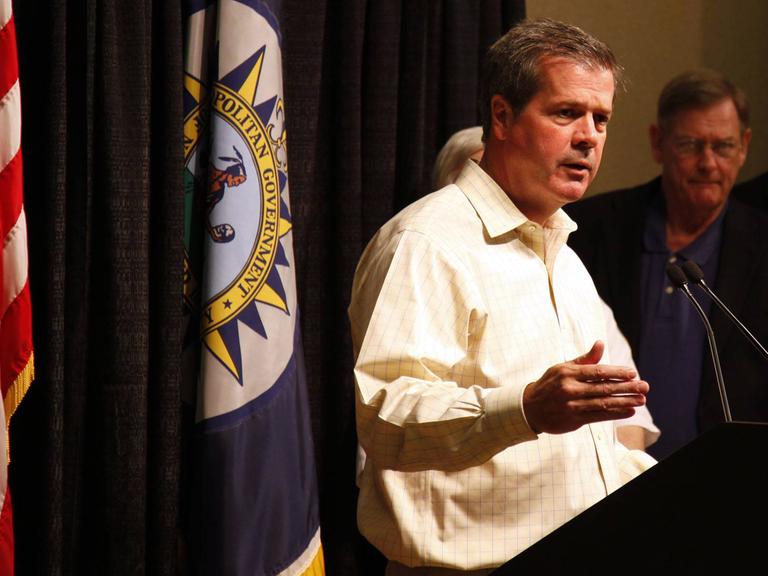"Bürgermeister können sich Ideologien nicht leisten"

Eric Garcetti, Bürgermeister von Los Angeles, setzt beim Klimawandel auf die Macht der Städte. "Washington kann meiner Stadt nicht die Möglichkeit nehmen, Elektro-Autos als Dienstwagen anzuschaffen", sagt der Hoffnungsträger der US-Demokraten.
Deutschlandfunk Kultur, Annette Riedel: Bei Tacheles im Gespräch ist heute Eric Garcetti, seit vier Jahren Bürgermeister von Los Angeles. Der Demokrat Garcetti war in dieser Woche in Berlin, aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen der deutschen Hauptstadt und der kalifornischen Metropole. Das Interview fand im Rahmen eines gemeinsam von Deutschlandfunk Kultur und dem Aspen-Institut Berlin veranstalteten Frühstücks mit geladenen Gästen im Schönberger Rathaus in Berlin statt. Das Gespräch mit dem Bürgermeister von LA drehte sich zunächst um das Thema Klimapolitik.
Herr Garcetti, müssen wir froh sein, dass Klima-Skeptiker Donald Trump "nur" US-Präsident ist und nicht Bürgermeister von Los Angeles, der zweitgrößten US-Metropole. Schließlich werden in den Metropolen der Welt 75 Prozent der Energie verbraucht und damit auch der Löwenanteil klimaschädlicher Gase ausgestoßen. Entsprechend wesentlich kommt es auf ihr Gegensteuern an.
Eric Garcetti: Ich habe tatsächlich schon immer gesagt: Ob es nun Barack Obama ist oder Donald Trump – das meiste, was gegen den Klimawandel getan werden kann, spielt sich in den Städten ab. Dort wird die meiste Energie verbraucht; dort kommen die meisten Emissionen her, und in den Städten müssen auch die Lösungen gefunden werden. Wie bewegen wir uns in den Städten? Wie erzeugen wir die Energie in den Städten? Wie können wir sicherstellen, dass die Gebäude so energieeffizient wie möglich sind? Es ist wirklich in den Händen der Städte und der lokalen Politiker, ob wir im Kampf gegen den Klimawandel Erfolg haben. Es ist natürlich gut, mit der föderalen Ebene zusammenzuarbeiten, aber wir warten nicht darauf, dass die nationale Ebene etwas tut und wir folgen. In Kalifornien ist es ganz im Gegenteil so, dass wir die Führung übernommen haben. Und Washington – egal ob demokratisch oder republikanisch regiert - folgt uns.
Deutschlandfunk Kultur: Aber ist es jetzt dringlicher denn je, dass die Verantwortlichen in den Metropolen, die Führung übernehmen?
"Bürgermeister müssen Probleme lösen"
Eric Garcetti: Keine Frage! Gerade hat sich die Konferenz der US-Bürgermeister in Miami mit dem Klimawandel befasst. Und wir haben gesehen, dass in Miami Beach, in der Nähe von Donald Trumps Residenz, Mauern gebaut werden, weil das Meer die Küste wegfrisst. Im Westen der USA sind unsere Feuerwehren mit Dürren konfrontiert, die zu einer Zunahme von Walbränden im zweistelligen Bereich geführt haben. Hier geht es nicht um ideologische oder moralische Fragen, sondern um ganz praktische. Bürgermeister können es sich nicht leisten, ideologisch zu denken, sie müssen Probleme lösen. Nachdem Donald Trump angekündigt hat, sich aus dem Pariser Klima-Abkommen zu verabschieden, haben sich schon 350 Bürgermeister verpflichtet, das Abkommen in ihren Städten umzusetzen – darunter sind auch Republikaner. Insgesamt repräsentieren sie schon 65 Millionen Amerikaner und es werden täglich mehr.
Deutschlandfunk Kultur: Aber was können Bürgermeister tun? Ist es gesetzlich zulässig, dass sie die Dinge gegen Washington vorantreiben oder auch nur an unter Obama schon Beschlossenem festhalten?
Eric Garcetti: Washington kann meiner Stadt nicht die Möglichkeit nehmen, Elektro-Autos als Dienstwagen anzuschaffen oder sich gegen Kohle-Kraftwerke und für erneuerbare Energien zur Stromerzeugung zu entscheiden oder an unseren Vorgaben für hohe Energieeffizienz bei unseren Gebäuden festzuhalten. Ich möchte, dass es auch bei den Bauten in meiner Stadt keine Energieverschwendung gibt, etwa durch schlechte Dämmung, schlechte Klimaanlagen. Nichts in unserer Verfassung gibt Washington das Recht, das außer Kraft zu setzen. Was sie können und womit sie drohen, ist, Kaliforniens strikte Abgas-Grenzwerte außer Kraft zu setzen. Ich kann nur hoffen, dass auch dieses Weiße Haus weiterhin das Recht von Staaten respektiert, ihre eigenen demokratisch-legitimierten Wege zu gehen. Ich glaube nicht, dass sie die Macht haben, diese Tradition auszuhöhlen.
Wirtschaftsnationalisten wie Trump sollten auf "grüne Jobs" setzen
Deutschlandfunk Kultur: Es gibt Anstrengungen, strenge Umwelt-Gesetze, die von früheren Präsidenten erlassen wurden, im kalifornischen Recht festzuschreiben, damit sie dem Zugriff der Trump-Regierung entzogen werden. Das geht?
Eric Garcetti: Ja. Es könnte vom Weißen Haus angefochten werden und vielleicht müssen wir es vor Gericht austragen. Es ist so absurd! Wir in Kalifornien wollen etwas tun und die föderale Regierung, zu der nicht einmal Kalifornier gehören, will uns das verbieten – aber in wessen Namen denn eigentlich? Was Kalifornien tut, ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Wirtschaft. Los Angeles ist führend in der Welt, was saubere Technologien angeht. In Kalifornien sind in zehn Jahren 500.000 "grüne Jobs" entstanden – zehn mal mehr als es in den gesamten USA im Kohle-Sektor gibt. Überlegen sie mal! In 10 Jahren! Und ich verweise immer darauf, dass unsere chinesischen Freunde nicht nur für die Umwelt auf grüne Technologie setzen, sondern weil da die Jobs sind. Wenn man schon Wirtschaft-Nationalist so wie Präsident Trump sein will und man Jobs in den Kohle-Regionen und anderswo haben möchte, sollte man auf "grüne Jobs" setzen, anstatt sie anderen zu überlassen.
Deutschlandfunk Kultur: Aber es gibt die US-Umweltbehörde, die versucht, die Umsetzung von Umwelt-Gesetzen aus der Obama-Zeit auszubremsen. Gerade hat ein US-Gericht entschieden, dass die Behörde dazu nicht berechtigt ist. Sind also die US-Gerichte auf Ihrer Seite?
Eric Garcetti: Bisher, ja. Aber das kann sich ändern, wenn Präsident Trump Richter-Posten ideologisch besetzen sollte, was ich nicht hoffe. Bisher haben wir vor den Gerichten mehr gewonnen als verloren. Aber der Direktor der Umweltbehörde, Scott Pruitt, ist der Erfolgreichste beim Anliegen der Trump-Regierung, Obamas Regulierungen außer Kraft zu setzen. Das heißt nicht, dass nicht auch Demokraten Gesetze gemacht haben, die zwar gut gemeint waren, aber nicht gut funktionieren. Die müssen wir reformieren. Die Trump-Regierung hat viel davon geredet, Dinge zurückdrehen zu wollen, aber der Chef der Umweltbehörde ist bisher einer der wenigen, der es schon gemacht hat.
Ziel für L.A.: Bis 2050 Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben die über 300 US-Bürgermeister erwähnt, die eine Resolution unterzeichnet haben, in der sie sich zur Einhaltung des Pariser Klima-Abkommens verpflichten. Aber es gibt auch Kritiker, die sagen, dass das alles "grüne Rhetorik" sei. Tatsächlich verfehlten nämlich Städte wie New York und Chicago schon die eigenen, weniger ambitionierten CO2-Reduktions-Ziele aus der Vergangenheit. Rhetorik ist das eine, Umsetzung das andere.
Eric Garcetti: Eine berechtigte Kritik, die nicht nur Städte betrifft, sondern auch nationale oder internationale Politik. Die Pariser Ziele sind ambitioniert, aber es braucht auch ambitionierte Ziele, um etwas zu erreichen. Andererseits sehen wir, wie schnell Solarenergie billiger wird, wie schnell Kalifornien seine ambitionierten Ziele sogar übertroffen hat. Los Angeles hatte mal landesweit die schmutzigsten Versorgungsunternehmen. Strom wurde fast ausschließlich mit Kohle erzeugt. Nicht nur wollen wir bis 2025 völlig auf Kohle verzichten, sondern das Ziel ist: 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien bis 2050, 75 Prozent bis 2035. Die Geschwindigkeit nimmt zu und die Kosten fallen.
Als Bürgermeister muss man zudem die Gesundheitskosten einrechnen. Ich bin nahe von zwei Autobahnen aufgewachsen, wo sich die Krebs-Fälle wegen des Bleis im Benzin häuften. Meine Mutter hatte viermal Krebs, mein Vater dreimal, meine Schwester einmal. In der Nachbarschaft erkrankten viele an Krebs. Das ist nichts Abstraktes. Jeden, der daraus einen ideologischen "Rechts-Links-Kampf" macht, kann ich nur mit den Tatsachen konfrontieren. Hier geht es um Wissenschaft und um die Gesundheit der Menschen.
Deutschlandfunk Kultur: Sie fahren schon lange selbst ein Elektro-Auto. Die CO2-Bilanz des gesamten Produktionsprozesses eines solchen Autos ist aber auch nicht die beste. Ein E-Auto muss rund acht Jahre lang fahren, bis man mit ihm tatsächlich Emissionen einzusparen beginnt. Sie haben am Beginn ihrer ersten Amtszeit 2013 gesagt, dass wir uns dem Ende des privaten Autobesitzes nähern. Wir brauchen also nicht nur elektrische Autos, wir brauchen weniger Autos?
"'Grüne Revolution' muss Kleinverdiener mitnehmen"
Eric Garcetti: Witzigerweise komme ich aus der Auto-Hauptstadt der Welt. L.A. ist der Markt für Mercedes, zum Beispiel. Früher gehörte es zum Erwachsenwerden dazu, dass man selbstverständlich mit Sechzehn seinen Führerschein machte und ein Auto bekam. Wenn man heute mit Sechzehnjährigen spricht, wollen manche gar keinen Führerschein mehr. Sie laufen, fahren Rad, machen Car-Sharing. Elektro-Autos sind aber wesentlich effizienter und besser für die Umwelt, natürlich abhängig davon, wo der Strom herkommt. Indem der aber immer "grüner" erzeugt wird, werden Elektro-Autos bei ihrer CO2-Bilanz anderen um Meilen überlegen sein. In Zukunft wird Auto-Besitz immer weniger ein Thema sein.
Interessanterweise haben wir von Paris gerade in L.A. ein Car-Sharing- Konzept für Elektro-Autos übernommen. Wir führen das jetzt in Los Angeles in Stadtteilen mit Niedrigeinkommen ein. Unsere Botschaft: Wir wollen nicht nur teure Luxus-Elektroautos oder reiche Leute mit Solaranlagen auf den Dächern ihrer Villen. Für eine "grüne Revolution" müssen wir diejenigen mitnehmen, die nicht schon umweltbewusst und engagiert sind. Kleinverdiener brauchen ihrerseits Möglichkeiten, um zum Beispiel nicht alte Dreckschleudern zu fahren, weil sie sich kein anderes Auto leisten können. Deshalb starten wir gezielt in dicht besiedelten, ärmeren Nachbarschaften Car-Sharing mit Elektro-Autos.

Eric Garcetti, Bürgermeister von L.A. im Gespräch mit DLF-Kultur-Redakteurin Annette Riedel auf dem Balkon des Schöneberger Rathauses.© Aspen Institute Deutschland / Konstantin Gastmann
Deutschlandfunk Kultur: Sie streben an, dass die Polizei von Los Angeles bald zu 100 Prozent Elektro-Autos benutzt. Wie bald ist bald?
Eric Garcetti: Wir haben uns vorgenommen, dass in drei Jahren die Hälfte aller neu gekauften Dienstwagen Elektro-Autos sind, auch bei der Polizei. Wir werden das wohl in einem Jahr schaffen. Schon im letzten Jahr sind alle neuen Polizei-Wagen, die nicht Einsatzwagen sind, elektrische gewesen – deutsche übrigens. Es sind alle BMWs. Praktischerweise gibt es die Elektro-Modelle ab Fabrik auch in Schwarz-Weiß, so dass wir sie noch nicht mal umlackieren mussten. Schon im ersten Jahr sparen wir 40 Prozent der Kosten, weil wir sie einerseits leasen aber zum anderen haben wir nicht mehr 20.000 Einzelteile wie bei den Verbrennungsmotoren. So gibt es keine Wartungskosten mehr und sie haben eine wesentliche längere Lebensdauer.
Deutschlandfunk Kultur: Bleibt nicht das Gewicht von Einsatzwagen ein Problem?
Eric Garcetti: Nein. Die Wagen sind sehr effizient und die Polizei liebt sie. Sie sind sehr schnell und sehr leise – sehr passend für Polizei-Autos. Die Kriminellen hören dich nicht kommen.
Deutschlandfunk Kultur: Was kann Berlin von Los Angelas lernen, wenn es um die Verbreitung von Elektro-Mobilität geht – abgesehen davon, ambitionierte Ziele vorzugeben?
Erich Garcetti: Man muss auf allen Ebenen daran arbeiten – angefangen von Dienstwagen, aber auch bei Schwerlastfahrzeugen. So haben wir gerade ein historisches Abkommen zwischen dem Hafen von Los Angeles und dem Schwesterhafen Long Beach unterschrieben. 43 Prozent aller Waren-Importe der USA kommen über diese Häfen. Die Häfen haben gemeinsam beschlossen, die Fahrzeuge, die die Container transportieren, auf Elektro-Antrieb umzustellen. Und Schiffe müssen künftig im Hafen auf Elektrobetrieb gehen. Wir haben bisher zugelassen, dass diese riesigen Schiffe, die jeweils so viel CO2 ausstoßen wie Zehntausende von Autos, schmutzigste, in den Häfen übel umweltverschmutzende Dieselöle verbrennen.
Wir haben außerdem mittlerweile eine Infrastruktur von Ladestationen in L.A., an Straßenlaternen, auf öffentlichen Parkplätzen. In meiner Amtszeit haben wir 1000 öffentliche Ladestationen aufgebaut, so dass auch Niedriglohnbezieher davon profitieren können.
Deutschlandfunk Kultur: Wer wird es letztlich richten – der Markt oder muss die Politik handeln?
Eric Garcetti: Die Revolution findet schon statt. Die Leute werden ihre Angst vor den Elektro-Autos und deren mangelnde Reichweite verlieren, sowie richtig gute auf den Markt kommen – dann werden sie nie wieder etwas anderes wollen.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben gerade gesagt, dass Elektro-Autos nur Sinn machen, wenn die Batterien mit Strom aus erneuerbaren Energien geladen werden. Ist vor diesem Hintergrund Donald Trumps Idee gar keine schlechte, die Mauer, die er zwischen den USA und Mexiko errichten will, zu einer "Solar-Mauer" zu machen und sie mit Sonnenkollektoren zu bestücken?
Eric Garcetti: Ich bin nicht gegen Sonnenkollektoren – wo auch immer. Aber man muss dann auch Stromleitungen haben. Einer der größten Fehler, ist, dass die Leute denken, dass man überall einfach Sonnenkollektoren aufstellen kann. Ich glaube nicht, dass es an der US-mexikanischen Grenze viele Stromleitungen gibt. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Aber Sonnenkollektoren sind uns überall recht.
"Integration von Migranten entscheidend"
Deutschlandfunk Kultur: Sie, Bürgermeister Garcetti, haben väterlicherseits mexikanische Wurzeln. Sie sprechen fließend Spanisch. Würden Sie nicht trotzdem zustimmen, dass es ein Problem für die aufnehmenden Gemeinden ist, wenn zu viele Migranten in zu kurzer Zeit kommen?
Eric Garcetti: Eines ist klar: In den meisten Industrienationen würde die Wirtschaft nicht ohne Migranten funktionieren, angesichts der Geburtenrate in reicheren Ländern. Entscheidend ist die Integration. Ja, es kann einen Zustrom geben, der die Integrationsfähigkeit überfordert und dann ist es ein echtes Problem. Aber in meiner Stadt haben wir 63 Prrozent Migranten, bzw. Kinder mit Migrationshintergrund. Und 61 Prozent unserer Unternehmer sind Migranten oder deren Kinder.
Wir sollten also am meisten besorgt über mögliche negative Konsequenzen von Migration sein, weil wir mit ihr leben. Ironischerweise sagen uns die, die nicht mit ihr leben, wie schlimm sie ist. Wir müssten uns doch am meisten um die Sicherheit unserer Straßen, unserer Familien und um unsere Wirtschaft sorgen. Aber es ist gerade eine der großen Stärken von Los Angeles, dass du aus Berlin, dem Kongo, Thailand oder Armenien kommen kannst und du findest sofort etwas, was dich an zuhause erinnert.
Einwanderungspolitik problematisch, nicht Einwanderer
Deutschlandfunk Kultur: Und dass es riesige soziale Probleme in Los Angeles gibt, hat absolut nichts mit dem Thema Migration zu tun?
Eric Garcetti: Wenn man sich einfach mal die Statistiken anschaut, dann sind es in der Regel Angehörige der zweiten oder dritten Generation, bei denen es wahrscheinlicher ist, dass sie kriminell werden oder in Armut leben. Die erste Generation, die einwandert, braucht viel Mut. Das sind in der Regel hoch motivierte, hart arbeitende Menschen. Mein Großvater kam als Einjähriger ohne Papiere auf dem Arm seiner Mutter, die vor der mexikanischen Revolution geflohen war. Erst als Soldat im Zweiten Weltkrieg wurde er US-Bürger.
Schnelle Integration erweist sich immer wieder als die weit bessere Strategie gegen soziale Probleme, die Migranten und Nicht-Migranten haben. Es ist nicht gut, zwei Parallel-Ökonomien zu haben – mit einigen, die im Schatten leben und anderen auf der Sonnenseite, mit entsprechenden Privilegien. Warum können sich extrem begabte Schüler kein Studium leisten? Das sind Probleme, die unsere Einwanderungspolitik kreiert, nicht die Anwesenheit von Einwanderern.
Deutschlandfunk Kultur: Der Titel eines Buches des einflussreichen amerikanischen Politologen, Benjamin Barber, lautet: "Wenn Bürgermeister die Welt regierten: dysfunktionale Nationen, aufsteigende Städte". Die These: Das 20. Jahrhundert war das der Nationalstaaten und das 21. Jahrhundert ist das der Städte. Sind Bürgermeister wirklich wichtiger geworden?
Eric Garcetti: Jedenfalls gefällt mir der Titel. Benjamin Barber war ein guter Freund, der in diesem Jahr an Krebs gestorben ist. Zweifellos sind Städte für die Zivilgesellschaft und für die wirtschaftliche Entwicklung deutlich wichtiger geworden. Diese Entwicklung geht weiter. Ich bin Vizepräsident des globalen Städte-Netzwerks "C40" von Ex-New-York-Bürgermeister Bloomberg, zu dem auch Berlin und Paris gehören. Egal wo ich bin – Mexiko City, Tokio, Paris – ich erlebe, dass die Fragen die gleichen sind: Wie geht man mit dem Müll um, mit der Umwelt, mit Terrorismus, mit Kriminalität? Wie mit Flughäfen? Aber das sollte ich hier in Berlin wohl eher nicht ansprechen…
Wir Bürgermeister sprechen jedenfalls eine Sprache. Ich war letztes Jahr im neuseeländischen Auckland, wie Berlin eine unserer Partner-Städte. Man sagte man mir, dass Auckland mal einen prima öffentlichen Nahverkehr hatte, den man durch Autobahnen ersetzt hat. Und sie wollten meinen Rat, wie das riesige Problem der Obdachlosigkeit zu bewältigen sei – ich fühlte mich wie zuhause! Ganz genau die gleichen Probleme erlebe ich in Los Angeles.
Ich denke nicht, dass der Nationalstaat stirbt. Der wird wichtig bleiben. Aber die Städte werden sicherlich wichtiger. Die Menschen sehen in den Bürgermeistern oft die geeignetere Führung – vor allem in meinem Land, wo die Führung in Washington zurzeit so ungeeignet scheint.
"Einer von fünf Jobs kommt in L.A. aus der Kreativwirtschaft"
Deutschlandfunk Kultur: Sie erwähnten die Obdachlosigkeit in L.A. – obwohl es schwerwiegende soziale Probleme gibt, mehren sich doch die Anzeichen, dass es wieder bergauf geht mit der Innenstadt. Welchen Anteil hat der kreative Sektor daran? Oder hat mittlerweile die Digital-Wirtschaft das größere Gewicht?
Eric Garcetti: Die beiden Bereiche sind nicht mehr wirklich voneinander zu trennen. Die Technologie hat sich von Hardware zu Software und von da zu Inhalten entwickelt. Los Angeles hat immer Inhalte produziert. Ich habe neulich eine Diskussion zwischen einem Vertreter der Filmproduktionsfirma Paramount – einem "alten" Medium – und jemandem von einem neuen digitalen Medium gehört. Letzterer sagt: "Der Film wird uns nicht überleben, den wird’s nicht mehr geben." Der Paramount-Mensch erwiderte darauf: "Moment mal, wir machen seit über 100 Jahren Filme. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber My Space wurde durch Facebook ersetzt, Facebook wird durch Twitter ersetzt. Ihr Medium gibt es vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr, aber wir werden noch immer Filme machen."
Was ich sagen will: Die Art, wie wir zusammenkommen, mag sich verändern, aber das menschliche Bedürfnis nach Austausch bleibt und auch das nach guten Geschichten. Und das ist das, was Los Angeles schon immer sehr gut gekonnt hat. Ungefähr einer von fünf Jobs kommt in L.A. aus der Kreativwirtschaft. Aber wir sind keine "Ein-Großunternehmen-Stadt". Wir haben rund zehn größere Industrien, hauptsächlich Handel, Tourismus, Technologien. Die Filmindustrie ist tatsächlich erst seit 15 Jahren unter den Top-Ten. Beispielsweise sind die Flugzeuge für die US-Luftbrücke nach Berlin seinerzeit in Los Angeles entstanden. Ob es nun die Tesla-Auto-Design-Studios sind oder Raumfahrzeug-Hersteller SpaceX – wir denken ständig die Zukunft neu. Es geht eher um die Kreativität selbst und nicht um den kreativen Sektor im Vergleich zum digitalen. Beide werden integriert und geschätzt in allen unseren Industrien.
"Renaissance des Kreativen generiert Einkommen für die nächsten Jahrzehnte"
Deutschlandfunk Kultur: Sie selbst sind Jazz-Pianist, Fotograf und Komponist – erleichtert Ihnen das die Kommunikation mit den Kreativen?
Eric Garcetti: Ganz sicher, ich habe viel begriffen, weil ich viele Freunde habe, die zum Kreativsektor gehören. Viele von ihnen mussten Los Angeles verlassen, weil in Kalifornien keine Filme mehr gedreht wurden. Also haben wir für Steuererleichterungen gekämpft, um die Filmschaffenden zurückzubringen.
In meinem Büro habe ich tatsächlich ein Klavier. Es ist gut für die Seele, wenn ich zwischen den Sitzungen spiele. Ich fotografiere auch gern, um meinen Freunden auf Instagram meine Stadt mit meinen Augen zu zeigen. Ich komme in so schräge Ecken und möchte die Eindrücke gern mit Bürgern weltweit teilen. In L.A. macht jeder irgendetwas Kreatives: Der Kellner, der schauspielert, der Unternehmer, der singt – so etwas gibt es bei uns hinter fast jeder Tür.

Eric Garcetti, Bürgermeister von L.A., auf einem Balkon des Schöneberger Rathauses während einer © Aspen Institute Deutschland / Konstantin Gastmann
Deutschlandfunk Kultur: Der Filmemacher George Lucas wird aus seiner eigenen Tasche für eine Milliarde Dollar ein Museum in Los Angeles bauen – das "Lucas Museum of Narrative Art". Sind es private Initiativen wie diese, die so wichtig sind für die Stadt? Man braucht schließlich schon "ein klein wenig Geld", wenn man die Dinge in Los Angeles in Ihrem Sinne verändern will. Sind Sie abhängig von privatem Geld?
Eric Garcetti: Mehr als anderswo, aber wir haben auch das Glück, dass wir für privates Kapital attraktiv sind. Wir wollen zum Beispiel die Olympischen Spiele nach L.A. holen und ohne staatliche Subventionen auskommen. Es ist nicht nur das Lucas-Museum. Manchmal habe ich gedacht, wenn wir alle zehn Jahre so etwas bekämen, dann würde ich das begeistert feiern. Und nun scheinen wir jedes Jahr etwas großartiges Neues zu bekommen.
Es ist ein bisschen wie New York in den 80ern – als die Künstler zu hauf dort hin zogen. Jetzt ist es dort zu teuer. L.A. ist heute ein bisschen wie Berlin in den 20er-Jahren – es gibt eine Art "L.A.-Moment". In Berlin und L.A. verstehen beide sehr gut, dass die Renaissance des Kreativen Einkommen für die nächsten Jahrzehnte generiert. Es zieht ja nicht nur die Künstler selbst an, sondern auch den kunstinteressierten Ingenieur oder Software-Entwickler beispielsweise, weil es sich in dieser Stadt großartig leben lässt. Ich glaube, da stecken mehr Chancen für die Städte drin, als riesige Stadien zu subventionieren oder große Einkaufszentren zu bauen oder Großunternehmen anzuwerben. Es sind eher die Kleinunternehmen, die davon leben, dass die Stadt aufregend ist.
L.A. baut 15 Bahn-Linien gleichzeitig
Deutschlandfunk Kultur: Sie sind seit 2013 Bürgermeister von Los Angeles. Es gab Zeiten, als Hollywood sozusagen Hollywood verlassen hat, Filmproduzenten lieber in die Studios in Potsdam-Babelsberg gingen. Waren es Steuererleichterungen, die die Filmindustrie nach Hollywood zurückgebracht haben? Bezahlt mit Geld, das Ihnen jetzt verzweifelt in ihrem Budget fehlt?
Eric Garcetti: Nein. Aber Sie haben Recht. Wir haben gesehen, dass New York niemals die Banken hätte gehen lassen, Detroit niemals die Autoindustrie hätte sterben lassen, aber wir haben die Hollywood-Produktionen ziehen lassen, abgesehen von den Unternehmens-Zentralen. England, Kanada, andere US-Staaten haben der Filmindustrie steuerliche Subventionen geboten. Ich wollte niemals so hoch subventionieren, dass es ein Verlustgeschäft wäre. Ich kann das Geld nicht den Schulen oder dem Straßenbau entziehen, um einen Film oder eine Fernsehshow zu produzieren.
Glücklicherweise mussten wir nicht allzu hoch subventionieren, weil die Filmemacher hier aus bewährter Tradition auf die Besten im Geschäft zurückgreifen können. So haben wir letztlich als Staat genauso viel Geld wieder hereinbekommen, wie wir ausgegeben haben. Und natürlich hat die Wirtschaft profitiert, wenn die Leute bei uns ihr Geld ausgeben. So sind in nur zwei Jahren 50.000 Jobs und Produktionen für über zwei Milliarden Dollar nach Kalifornien und vor allem L.A. zurückgekommen.
Deutschlandfunk Kultur: Los Angeles hat einen Infrastrukturplan von rund 120 Milliarden Dollar. US-Präsident Trump will eine Billion für die Infrastruktur in den USA ausgeben. Experten sagen aber, dass man eigentlich fünf Billionen bräuchte, um die Infrastruktur rundum zu erneuern. Was kann Los Angeles mit den 120 Milliarden anfangen und wird es reichen?
Eric Garcetti: Es ist natürlich nie genug. Aber es ist trotzdem die größte Summe in der kalifornischen Geschichte. Wir haben ein seltsames System in Kalifornien. Wenn man die Steuern erhöhen will, kann man darüber in einem Referendum abstimmen lassen. Man braucht allerdings eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Wir haben eine 71,5-prozentige Mehrheit für die Steuererhöhung bekommen – und zwar permanent, ohne Verfallsdatum. Ein Cent auf jeden Verkauf. Ich glaube, Menschen, die immer wieder im Stau stehen, begreifen, dass darüber Unsummen an Geld verloren gehen und Millionen an Stunden mit der Familie und Zeit für alles, was Spaß macht, auch. Deshalb haben sie dafür gestimmt.
Das Geld wird reichen, um 15 Bahn-Linien gleichzeitig zu bauen. Das hat es in den USA noch nie gegeben, wohl nicht einmal weltweit, vielleicht mit der Ausnahme von China. Außerdem werden wir unsere Straßen reparieren, Radwege bauen, Fußgängerwege. Eine halbe Million neuer Jobs versprechen wir uns davon. Das ist besonders wichtig in dieser Ära von ökonomischem Nationalismus - nicht nur in den USA, aber hier jetzt vor allem, unter Donald Trump.
Ich denke, wir können ihn mit seinen eigenen Argumenten konfrontieren und sagen: "Wenn du wirklich amerikanische Jobs schaffen willst, dann so", denn diese Jobs lassen sich nicht exportieren. Man kann nun mal keinen Tunnel exportieren oder Bahnlinien. Wenn wir Leute für diese Arbeit ausbilden, die arbeitslos oder unterbeschäftigt sind, schaffen wir Arbeit für 40 Jahre.
Bill Clinton: "Garcetti könnte eines Tages Präsident werden"
Deutschlandfunk Kultur: Der frühere US-Präsident Bill Clinton, wie Sie ein Demokrat, hat über Sie gesagt: "Er könnte eines Tages Präsident werden". Sie haben kürzlich in einem Interview für einen Podcast des Magazins Politico gesagt: "Ich bin nicht darauf fokussiert, für das Präsidentenamt zu kandidieren." Das ist kein "Nein".
Eric Garcetti: Ich kandidiere nicht für das Präsidentenamt. Ich glaube, alle Politiker denken immer nur an die Zukunft, spielen das Politik-Spiel und vergessen darüber, ihre Arbeit zu tun. Ich verbringe buchstäblich 99 Prozent meines Tages damit nachzudenken, wie ich meine Stadt besser machen kann; wie ich mich um Netzwerke in Deutschland und in der Welt kümmern kann, damit die Leute merken, dass wir uns engagieren, dass uns Institutionen und langjährige Freundschaften wichtig sind. Ich mache mir Sorgen um mein Land, deshalb bin ich zunehmend mit anderen Bürgermeistern in Kontakt, um ein Gegengewicht zu dem zu sein, was aus Washington kommt. Das ist wichtiger als die Frage, wer der nächste Präsident sein wird. Ich bin gerade erst letzten Samstag in meine zweite Amtszeit eingeschworen worden. Ich habe allen gesagt, dass ich meinen nächsten Job kaum erwarten kann: Ich werde erneut euer Bürgermeister sein – der beste Titel der Welt!
Deutschlandfunk Kultur: Also keine Ambitionen auf einen Sitz im Senat oder neuer kalifornischer Gouverneur zu werden? Da stehen die Wahlen bald an.
Eric Garcetti: Wenn sich Optionen bieten, muss man sie sich ansehen und sich fragen, was sie bewirken können – für meine Stadt, meine Familie, Menschen, die mir nah sind. Immer größer zu werden ist nicht unbedingt erstrebenswert. Früher dachten die Leute, es geht immer nur von einer Karrierestufe zur nächsten. Aber ich glaube wirklich, dass ich als Bürgermeister einen unglaublichen Handlungsspielraum habe. L.A. ist ökonomisch die drittgrößte Stadt der Welt, nach Tokio und New York. Wir erwirtschaften eine Billion Dollar pro Jahr. Wir haben den wichtigsten Flugplatz in den USA, den größten Hafen, das größte Stromkraftwerk. Selbst als Gouverneur kann man nicht unbedingt direkt mit all dem hantieren. Manchmal haben wir es einfach zu eilig. Machen wir unsere Arbeit, die wir heute haben, gut.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Hören Sie hier vorab das Tacheles-Gespräch mit Eric Garcetti in der englischen Original-Fassung:

Eric Garcetti, Bürgermeister von Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien bei der Veranstaltung von Deutschlandfunk Kultur und dem Aspen Institute im Schöneberger Rathaus in Berlin© Aspen Institute / Konstantin Gastmann
(mia)