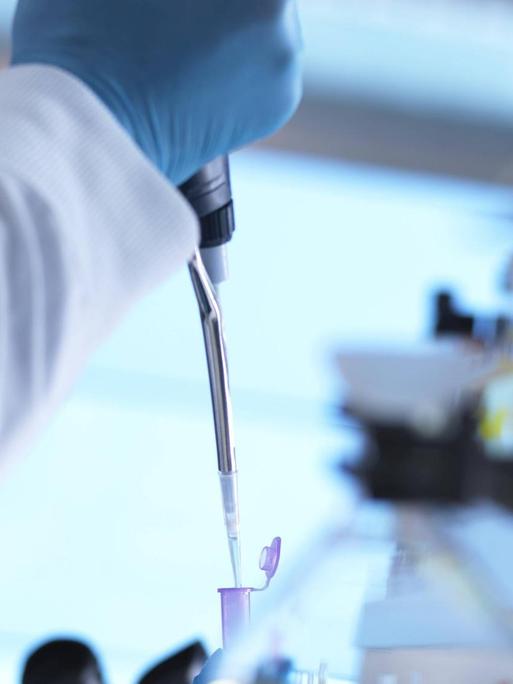"Nur in Einzelfällen vertretbar"
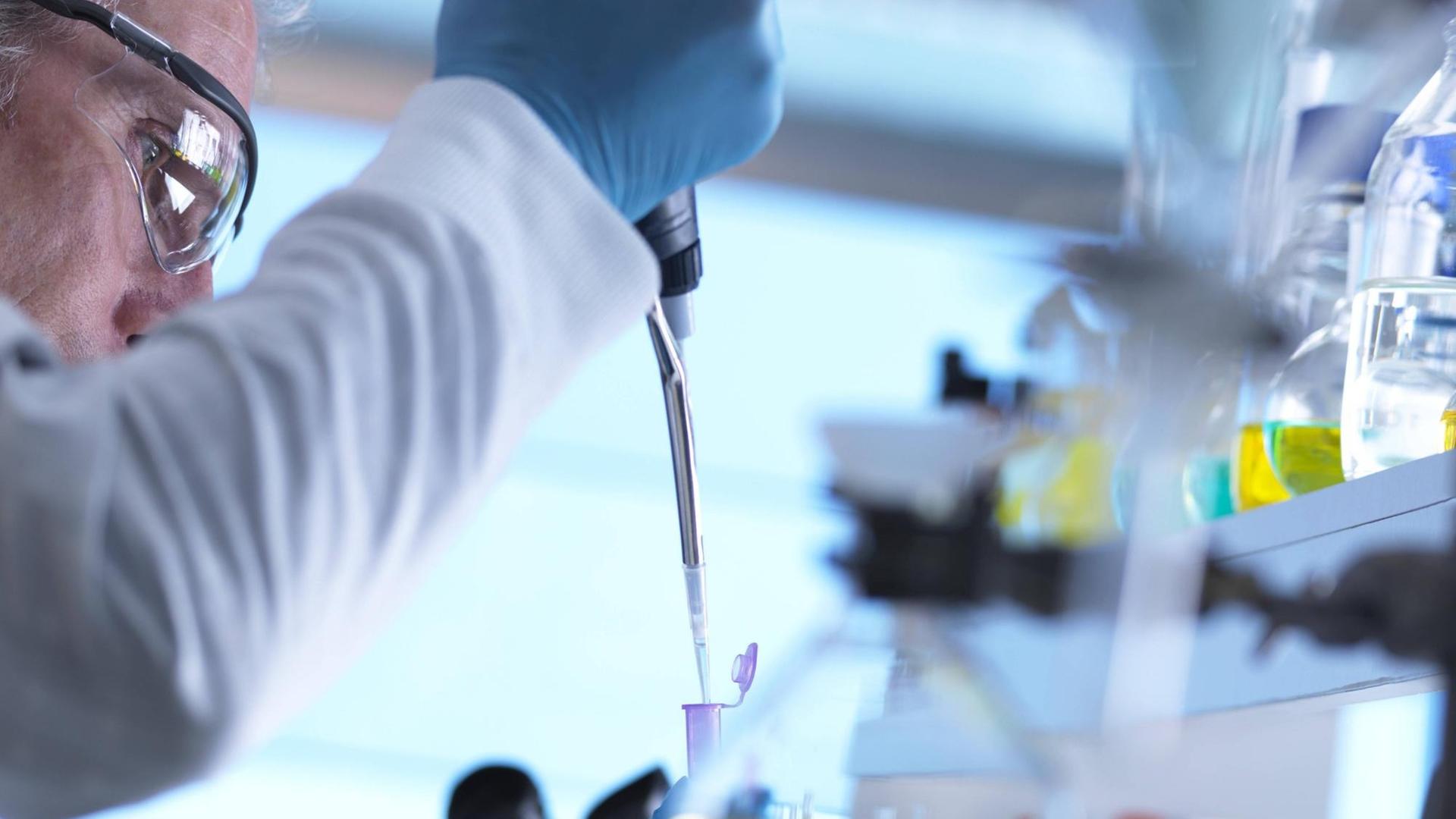
Haut- und Haarfarbe, Alter und Herkunft: All das lässt sich mit erweiterter DNA-Analyse feststellen. Die Innenminister von Bund und Ländern wollen die Methode deshalb künftig bei der Aufklärung von Verbrechen zulassen. Die Wissenschaftsforscherin Veronika Lipphardt warnt vor Diskriminierungen.
Die Befürworter der erweiterten DNA-Analyse sprechen von hohen Wahrscheinlichkeiten: So lasse sich zu 98 Prozent eine Unterscheidung von dunkler und heller Hautfarbe vorhersagen. Das sei allerdings keine Zahl, die die Ermittler bräuchten, sagt Veronika Lipphardt.
Als Beispiel führt die Wissenschaftlerin eine fiktive Dorfgemeinschaft aus 1000 hellhäutigen und zehn dunkelhäutigen Einwohnern an. Nach einem Mord würde ein Forensiker per DNA-Analyse feststellen, dass der Täter zu 98 Prozent dunkelhäutig sei. Es müsse allerdings auch die Fehlerrate von zwei Prozent berücksichtigt werden, erklärt Lipphardt:
Entspricht das den Prinzipien des Rechtsstaats?
"Von 1000 Hellhäutigen werden 20 dunkelhäutig getestet - einfach, weil der Test eine Fehlerrate von zwei Prozent hat. Nun haben Sie 20 Hellhäutige, die dunkelhäutig getestet werden und zehn Dunkelhäutige, die dunkel getestet werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Testergebnis richtig ist und auf die richtige Gruppe hinweist, beträgt gerade mal 30 Prozent."
Da frage man sich, ob das den Prinzipien eines Rechtsstaates entspreche und ob es fair sei, eine kleine Minderheit in den Fokus zu nehmen, "obwohl die Wahrscheinlichkeit genau dem entgegengesetzt ist, mit dem die Politiker gearbeitet haben". Aufhalten lasse sich die Methode wohl dennoch nicht, meint Lipphardt. In ganz speziellen Fällen sei sie auch sinnvoll: "Aber das darf nicht einfach so freischussmäßig bei jedem Mord und bei jedem Vergehen (...) von vornherein passieren. Das halte ich für nicht sinnvoll und auch wegen der Diskriminierungsgefahr für nicht vertretbar." (bth)
Das Interview im Wortlaut:
Ute Welty: Hautfarbe, Haarfarbe, Alter und Herkunft, all diese Informationen lassen sich dem menschlichen Erbgut entnehmen, wenn denn eine erweiterte DNA-Analyse durchgeführt wird. Nach einem Verbrechen sind diese Informationen für die Ermittler natürlich besonders interessant. Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich dafür ausgesprochen, in Zukunft solche DNA-Analysen nach einem Verbrechen durchzuführen. Man könne den Täterkreis eingrenzen, den eigentlichen Täter möglicherweise schneller überführen und vielleicht sogar weitere Taten verhindern. Vor allem der Mord an einer Freiburger Studentin Anfang des Jahres war als Beispiel herangezogen worden.
Aber es gibt auch Stimmen dagegen, wie die von Veronika Lipphardt. Sie ist Wissenschaftsforscherin und hat zusammen mit ihrer Schwester, der Kulturanthropologin Anna Lipphardt, eine fächerübergreifende Initiative Freiburger Hochschullehrer gegründet, die sich gegen eine erweiterte DNA-Analyse ausgesprochen haben. Guten Morgen, Frau Lipphardt.
Veronika Lippert: Guten Morgen!
Welty: Wie können Sie denn gegen diese Möglichkeit sein, wenn Sie doch in Freiburg selbst erlebt haben, wie entsetzt die Stadt war nach dem Mord an der Studentin?
Lipphardt: Zunächst ist zu bemerken, dass in Freiburg diese Technologien gar nicht sinnvoll hätten angewandt werden können. Ich hoffe, das ist ein Ergebnis unseres Gespräches, deswegen erkläre ich das jetzt nicht so lange. Wir sind vor allem aus wissenschaftlichen Gründen dagegen, denn uns ist offensichtlich, dass diese Technologien eine doppelte Diskriminierung von Minderheiten vornehmen, und zwar nicht, weil dahinter eine diskriminierende Absicht stecken würde, sondern weil es der Technologie inhärent ist und weil es in der Anwendungspragmatik angelegt ist.
Welty: Das heißt, Sie sagen, das kann gar nicht funktionieren.
Die Befürworter sprechen von sehr hohen Wahrscheinlichkeiten
Lipphardt: Das kann schon unter ganz bestimmten Bedingungen funktionieren, aber auf alle Fälle nicht so, wie sich das die Befürworter vorstellen. Die Befürworter sprechen ja von sehr hohen Wahrscheinlichkeiten der Vorhersage, also etwa 98 Prozent Wahrscheinlichkeit für die Unterscheidung zwischen dunkler und heller Hautfarbe, und das ist auf alle Fälle nicht die Zahl, die die Ermittler brauchen. Die Ermittler brauchen nämlich eine Wahrscheinlichkeitsangabe, die die Häufigkeit der jeweiligen Merkmale in der Bevölkerung berücksichtigt. Und die kann ganz enorm anders aussehen. Also, die Wahrscheinlichkeiten, mit denen in der Öffentlichkeit operiert wird, das sind Wahrscheinlichkeiten aus laborinternen Testvalidierungen, und die erreichen Sie aber in der wirklichen Ermittlungssituation nicht.
Welty: Aber selbst, wenn die statistischen Chancen vielleicht kleiner sind als gemeinhin angenommen – muss nicht jedes Mittel recht sein, um ein Verbrechen schnell aufzuklären?
Lipphardt: Lassen Sie mich das ganz kurz an einem Beispiel erklären, wie viel diese Fehlerrate eigentlich ausmachen kann. Stellen Sie sich ein Dorf vor in Schleswig-Holstein, in dem tausend hellhäutige Einwohner wohnen und zehn dunkelhäutige Einwohner, und stellen Sie sich vor, es passiert ein Mord, und die Polizei findet eine DNA, und der DNA-Test der erweiterten Analysen ergibt, dass es ein dunkelhäutiger Spurenleger sein muss. Dann würde der Forensiker, wenn er von unserem Problem des Prävalenzfehlers nichts weiß, ins Gutachten schreiben, dunkelhäutig, und zwar mit 98 Prozent, denn das ist ja die Wahrscheinlichkeit, die der Test angeblich kann, und die Polizei würde sich absolut berechtigt fühlen, die kleine Gruppe in den Fokus zu nehmen.
Aber wenn Sie die Prävalenzanpassung durchführen, müssen Sie auch die Fehlerrate von zwei Prozent bei den Hellhäutigen berücksichtigen, und das heißt, von tausend Hellhäutigen werden 20 dunkelhäutig getestet, einfach, weil der Test eine Fehlerrate von zwei Prozent hat. Nun haben Sie 20 Hellhäutige, die dunkelhäutig getestet werden, und zehn Dunkelhäutige, die dunkel getestet werden, und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Testergebnis richtig ist und auf die richtige Gruppe hinweist, beträgt gerade einmal 30 Prozent. Wenn Sie jetzt sagen, okay, 30 Prozent reicht uns immer noch, würde ich mich schon sehr wundern. Ich glaube, die Polizei kann mit einem Gutachten, in dem drinsteht "dunkelhäutig, und zwar zu 30 Prozent", nicht unbedingt so viel anfangen.
Wenn Sie sich dann aber die Haarfarbe angucken, die nur zu 90 Prozent in bestimmten Fällen gut erkannt werden kann, dann ist die Fehlerrate zehn Prozent, und bei tausend Hellhäutigen heißt das immerhin hundert Hellhaarige werden falsch als dunkelhaarig diagnostiziert, und dann haben Sie hundert zu zehn, und die Wahrscheinlichkeit beträgt gerade noch zehn Prozent, dass das Testergebnis dunkelhäutig korrekt ist. Und da fragt man sich schon, ob das den Prinzipien eines Rechtsstaats entspricht und ob das fair ist, eine kleine Minderheit in den Fokus zu nehmen, obwohl die Wahrscheinlichkeit genau dem entgegengesetzt ist, mit dem die Politiker gearbeitet haben.
Welty: Die Fehlerquote ist das eine, aber Sie haben eingangs auch erwähnt, dass das Verfahren im Freiburger Fall, der ja so viele Schlagzeilen gemacht hat, gar nicht hätte angewendet werden können, also grundsätzlich nicht hätte angewendet werden können. Warum war das dann ausgerechnet dieser Freiburger Fall, der die Diskussion losgebrochen hat?
In einer multiethnischen Stadt wie Freiburg kaum anwendbar
Lipphardt: Lassen Sie mich kurz erklären, warum wir denken, dass es grundsätzlich nicht möglich wäre. Es sind in Freiburg 220.000 Einwohner, und es ist eine multiethnische Stadt. Für die Polizei hätte das Testergebnis dunkelhaarig, dunkelhäutig – oder nein, es ist gar nicht dunkelhäutig - dunkelhaarig, dunkeläugig, leicht dunkler Teint und vielleicht biogeografische Herkunft nicht unbedingt westeuropäisch, keine sinnvolle Eingrenzungsstrategie gebracht. Das ist mal das eine. Experten sagen uns auch immer wieder, in städtischen Kontexten muss man ganz vorsichtig sein, diese Technologien lassen sich dort sehr schwer anwenden und nur für ganz spezielle Fragestellungen. Das hat zumindest im Freiburger Fall niemand getestet.
Der Freiburger Fall ist insofern interessant, als die Debatte, die wir sehr genau verfolgen und zu der wir auch forschen, von Anfang an mit der Migrationsdebatte verknüpft war, und zwar leider zu Beginn auch auf einer ganz deutlich explizit diskriminierenden Perspektive. Das muss gar nicht so sein, man hätte sich ja auch vorstellen können, dass die Debatte einfach nicht aus der Ecke kommt, aber von Anfang an kam sie eben eigentlich aus dem diskriminierenden Bereich.
Ich denke, dass ganz viele Bürger glauben, sie würden sich gegen die Wissenschaft stellen, wenn sie sich gegen diese Technologien aussprechen, weil ja die Zahlen so toll sind. Die Zahlen haben unheimlich überzeugend gewirkt, und wenn ich mir anschaue, wie die Befürworter hier in Freiburg und auch dann regional und am Ende dann auch auf der bundespolitischen Ebene den Fall benutzt haben und diese Wahrscheinlichkeiten benutzt haben, um Überzeugungen zu schaffen, dann ist das zumindest ziemlich bemerkenswert, und es hat eigentlich mit den Gegebenheiten hier in Freiburg wenig zu tun.
Welty: Glauben Sie, dass trotz aller Bedenken, die Sie jetzt aufgeführt haben und ausgeführt haben, dass sich dieses Instrument tatsächlich noch aufhalten lässt? Der Druck nach einem solchen Mord wie in Freiburg ist ja schon sehr groß, und normalerweise ist das, was machbar ist, dann auch zu machen.
Lipphardt: Ich denke, es lässt sich nicht aufhalten, auch, weil noch andere Interessen dahinter zu stehen scheinen.
Das Ziel ist eine größere DNA-Vergleichsdatenbank
Welty: Welche sind das?
Lipphardt: Es gibt im Moment drei Gesetzesänderungen, die alle auf denselben Paragrafen der Strafprozessordnung zugreifen. Und eine Gesetzesänderung möchte gerne die Erhebung des genetischen Fingerabdrucks dem des daktyloskopischen Fingerabdrucks angleichen. Das heißt, es geht darum, möglichst viel DNA von möglichst vielen Menschen zu erheben, um eine größere DNA-Vergleichsdatenbank zur Verfügung zu haben. Und wenn man sich anschaut, was diese Änderungen alle zusammen mit dem Paragrafen machen, dann stehen wir einfach vor einer sehr starken Ausweitung der DNA-Analysen im forensischen Bereich. Das ist das eine.
Das andere ist, es werden ja sehr gern die Niederlande und Großbritannien als Länder herangezogen, in denen das schon möglich ist. Es ist aber dort unter extrem strengen Vorkehrungen möglich, in ganz seltenen Einzelfällen, extrem gut beraten von multidisziplinären Gremien, auch unter ethischen Gesichtspunkten. Und all das ist in Deutschland überhaupt nicht vorgesehen. Unsere Haltung ist ja auch nicht, wir wollen auf gar keinen Fall, dass diese Technologien zugelassen werden, sondern wir möchten, dass sie, wenn sie zugelassen werden, möglichst gut und unter den allerhöchsten Standards zugelassen werden. Davon sieht man leider im Moment im politischen Prozess gar nichts.
Welty: Ganz kurz: Können Sie auch noch einen Nutzen der erweiterten DNA-Analyse erkennen?
Lipphardt: Wie gesagt, in ganz speziellen Fällen ja. Im Moment laden wir uns Leute aus Großbritannien und den Niederlanden zum Vortrag nach Freiburg ein, um genau das zu klären, in welchen Fällen haben sie das sinnvoll gefunden, diese Technologien anzuwenden. Und das sind wirklich sehr wenige. In den Niederlanden wurde es gerade mal seit 2003 in zehn Fällen angewandt. Das ist also extrem selten. Aber wenn sich eine ganz klare Fragestellung ergibt, dann können diese Technologien in der Tat einen sinnvollen Beitrag leisten. Aber das darf nicht einfach so freischussmäßig bei jedem Mord und bei jedem Vergehen, vielleicht sogar bei anderen Delikten, von vornherein passieren. Da halte ich es für nicht sinnvoll und auch wegen der Diskriminierungsgefahr für nicht vertretbar.
Welty: Die politische und gesellschaftliche Diskussion über die erweiterte DNA-Analyse hat viele Facetten, und einige davon konnten wir im Gespräch mit der Freiburger Wissenschaftsforscherin Veronika Lipphardt erläutern. Haben Sie dafür herzlichen Dank!
Lipphardt: Danke auch!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.