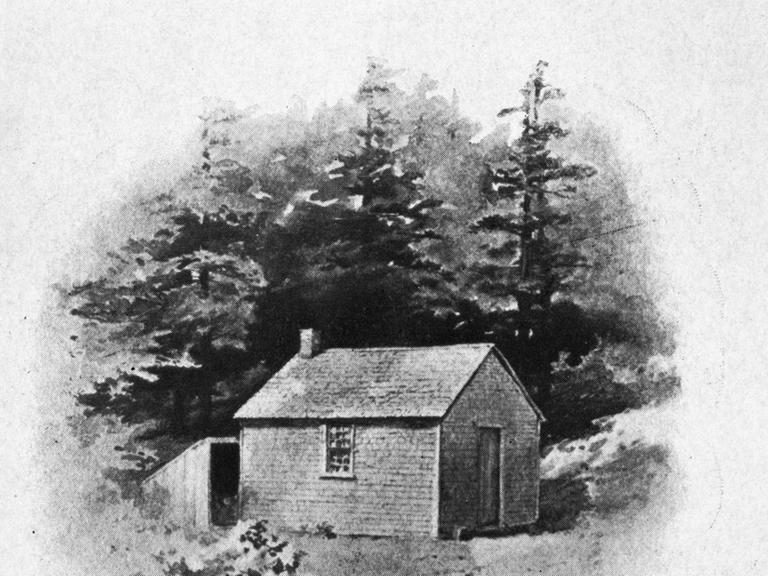Esther Kinsky: "Schiefern"
Gedichte
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020
103 Seiten, 24 Euro
Unterwegs in scherbigem Gelände
06:02 Minuten
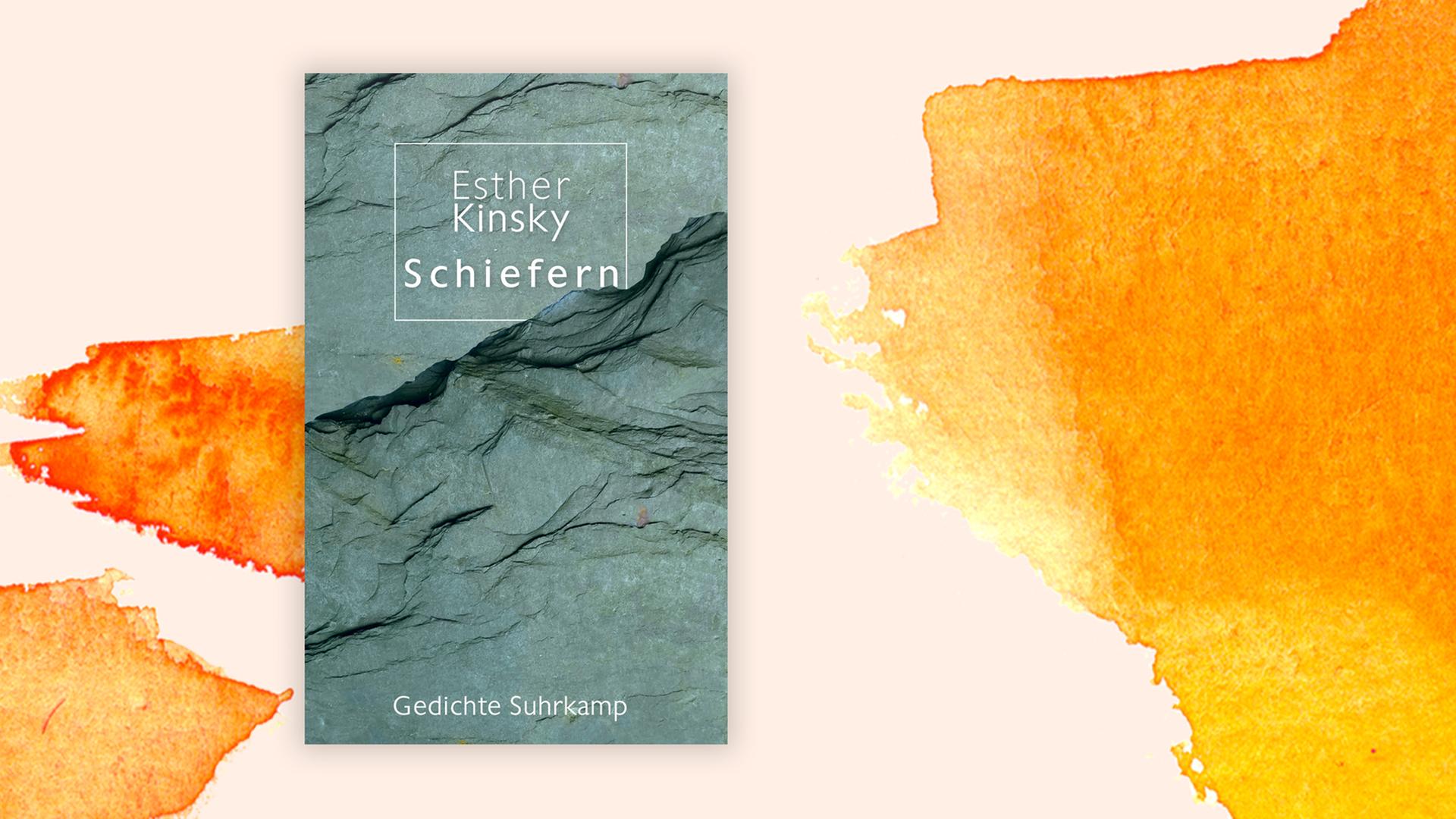
Für ihren Lyrikband "Schiefern" hat Esther Kinsky die schottischen Slate Islands bereist. Hier wurde seit Jahrhunderten Schiefer abgebaut. Die postindustrielle Landschaft verwandelt die Vorstellung von Zeit - wird zu einer Erinnerungsgegend.
Im späten Kambrium, vor etwa 490 Millionen Jahren, waren die Meere voll von Kleinstlebewesen. Trilobiten besiedelten den Meeresboden, winzige Gliederfüßer, die sich bisweilen von Sedimenten ernährten, daneben hausten Tierchen, die den späteren Muscheln und Schnecken ähnelten. Durch das Wasser bewegten sich tintenfischartige Kopffüßer.
Zu den wichtigsten Meeresbewohnern jedoch zählten die Graptolithen, auch Schrifttierchen genannt. Organismen, die in Bechern lebten und verästelte Kolonien bildeten – und deren Bezeichnung sich dem Umstand verdankt, dass ihre Versteinerungen heute an Schriftzeichen erinnern.
Bildmomente ineinander stauchen
Die Schrifttierchen sind nicht nur die Leitfossilien jener erdgeschichtlichen Periode, sie sind auch die geheimen Bildspender in Esther Kinskys neuem Gedichtband. Mehrere Male war sie auf den Slate Islands unterwegs, den Schieferinseln, die zu den Inneren Hebriden vor der Küste Schottlands gehören.
Jahrhundertelang wurde dort Schiefer abgebaut, in der Hochphase mithilfe von trichterförmigen Gruben, die über Sprengungen ins Gestein getrieben wurden. Es ist diese postindustrielle Landschaft mit ihren Stauchungen und Brüchen, die Kinsky interessiert, ein gestörtes Gelände nach Abbau und "gewinnungseingriff", wie es einmal heißt, das zugleich eine Erinnerungsgegend ist.
Der Schiefer mit seinen unterschiedlichen Lagen bietet ihr eine andere Form von Erzählung und eine andere Vorstellung von Zeit an. Einerseits entdeckt sie im Stein "gepresste geschichtete zeit", andererseits lässt sie sich von den Spuren der Schrifttierchen anregen, alles als "texturen" auszulegen und entsprechend lesen zu wollen.
Das Gedicht mit seiner Möglichkeit, Sprache zu schichten, Bildmomente ineinander zu stauchen und über Klang und Rhythmus die Idee einer linear verlaufenden Zeit zu brechen, kommt ihr dabei entgegen. Und so deutet sie die Insel als versehrte und "verzerrte" Landschaft oder spielt mit Gesteinsnamen wie "Tuff", Mergel" und "Pyrit".
Wie die Adern im Stein
Wie schon ihren Geländeroman "Hain" hat Kinsky den Gedichtband als Triptychon angelegt. Nach einer ausführlichen Sondierung der Gegend macht sie im Mittelteil die Stimmen von 36 Kindern und einem Fotografen hörbar, die sie einer alten Schulfotografie ablauscht:
"Nachts stößt der wind ums haus von
allen seiten ich schlafe dann nicht ich höre
die wellen und wie die steine scharren
und auch einen kiebitz im wind."
allen seiten ich schlafe dann nicht ich höre
die wellen und wie die steine scharren
und auch einen kiebitz im wind."
Zwischen den Gedichten verlaufen wie die Adern im Stein zwei Textbänder, die von der Erinnerung sprechen und vom "geruch von rost und salz".
Es ist das intensivste Kapitel dieses Bandes, der in seinem dritten Teil vielleicht allzu oft auf die Lesbarkeit der Landschaft abzielt. Vieles erscheint nun gleich als "zeichen der vergangenheit", auch wenn es manchmal "nichts zu deuten" gibt. Da sind die großen Begriffe leicht zur Hand, wird ein Schieferstück zum "wahrzeichen unbekannter wahrheit" oder ist "auf jeder fläche ein gesteinsgeheimnis eingeschrieben".
Viel stärker ist Esther Kinsky, wo sie das metaphorische Potenzial von Pflanzennamen wie "Heidekraut" und "Mannsblut" auslotet. Hier wird in wundersam splittrigen Versen ein "scherbichtes gelände" aufgefaltet.