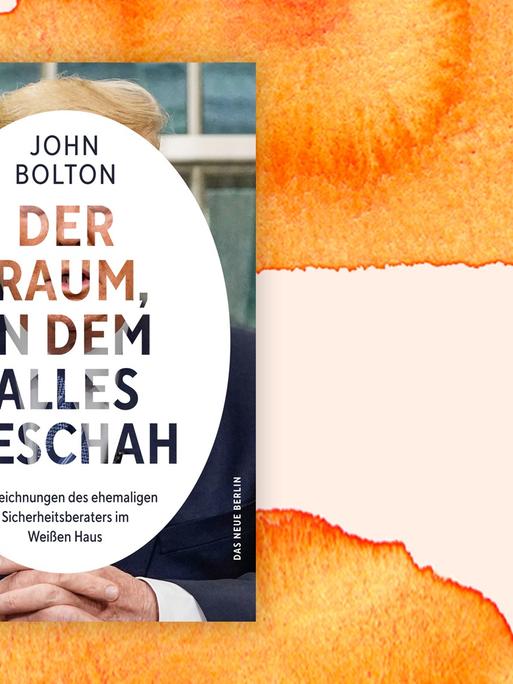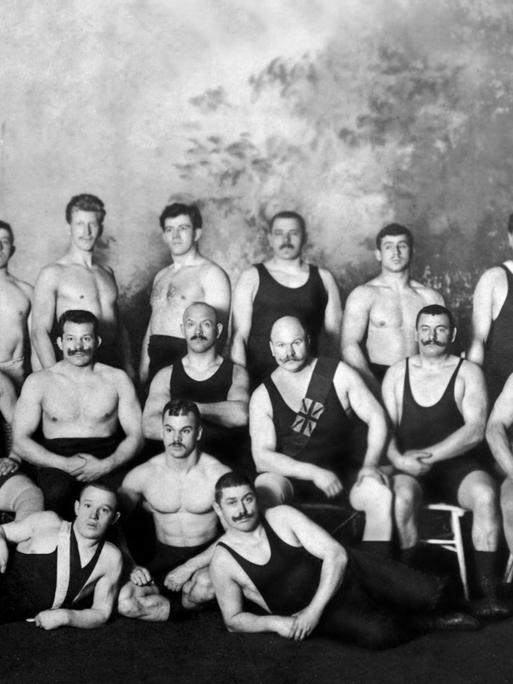Der republikanische US-Außenpolitikexperte, John Bolton, war ab April 2018 bis zu seinem Rücktritt im September 2019 US-Präsident Trumps Sicherheitsberater und hatte damit maßgeblichen Einfluss auf die US-Außenpolitik.
Er gilt als Hardliner. Über seine Zeit im Weißen Haus hat er einen Bestseller mit dem Titel "Der Raum in dem alles geschah" geschrieben. Von 2005 bis 2006 war Bolton der Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen. Der 1948 geborene Bolton hatte auch führende Positionen unter den republikanischen US-Präsidenten Ronald Reagan, George Bush Senior und George W. Bush.
"Irreparabler Schaden" durch zweite Trump-Amtszeit
29:26 Minuten

"Trumpismus" habe die amerikanische Politik deformiert, sagt John Bolton. Erstmals will der Ex-Sicherheitsberater von Trump seine Stimme nicht einem Republikaner geben. Aber ebenso wenig dem Demokraten Biden, denn der sei schlecht für die US-Außenpolitik.
"So oder so werde ich am Wahltag nicht glücklich sein", sagt der konservative Republikaner, Diplomat und Autor John Bolton. In seinen 519 Tagen als Donald Trumps Sicherheitsberater mutierte Bolton von einem seiner einflussreichsten Unterstützer und Berater zu einem seiner härtesten Kritiker.
Er habe es nicht für möglich gehalten, dass Trump sich unter dem Eindruck der großen Verantwortung des Amtes in keiner Weise ändern würde. Er habe sein Buch gegen den Widerstand des Weißen Hauses vor den Wahlen veröffentlichen wollen, so Bolton, weil er den Amerikanern die Möglichkeit geben wollte, "Dinge zu erfahren und sich ihre eigene Meinung" zu bilden.
Regime-Wechsel in Iran und Nordkorea?
Trumps Außenpolitik gleiche "einer Insellandschaft, mit vielen unverbundenen Punkten". So seien viele Chancen vergeben worden, global mehr zu bewegen. Viele Staatenlenker hätten den Präsidenten als jemanden gesehen, der "leicht übers Ohr zu hauen ist" und das auszunutzen versucht.
Er selbst, so John Bolton, habe seit Jahren dafür plädiert, in Iran einen "Regime-Wechsel" herbeizuführen und auch gegen andere "Schurken-Staaten" wie Nordkorea militärisch vorzugehen, wenn sie Atomwaffen anstrebten. Dafür habe er Trump aber nicht gewinnen können.
Bolton empfiehlt, Donald Trump als eine Anomalie zu betrachten. Das Beste, was sich von einem Präsident Biden aus seiner Sicht erhoffen ließe, wäre, dass mit ihm eine zweite, potenziell extrem schädliche, Amtszeit von Trump verhindert werden würde und dass er die "deformierte" Politik der USA zurück zur "Normalität" führen könnte.
Dazu gehöre auch, dass Washingtons Verbündeten wieder eine größere Wertschätzung entgegen gebracht werden dürfte. Gleichzeitig warnt er davor, die Verteidigungsausgaben zurückzufahren, was bei Biden zu erwarten wäre.
Demokraten haben es vermasselt
Der republikanische Hardliner weist sämtliche Vorwürfe zurück, er habe beim Amtsenthebungsverfahren als Zeuge gegen Donald Trump in der Affäre um zurückgehaltene Militärhilfe für die Ukraine eine wesentliche Rolle spielen können, wenn er ausgesagt hätte.
John Bolton sieht die Schuld für das Scheitern des Verfahrens beim schlechten Timing und beim schlechten Management des Prozesses durch die Demokraten. So habe am Ende ein rein "politischer" Freispruch Trumps gestanden, der wenig mit dessen tatsächlichen Verfehlungen zu tun habe.
Das Interview im Wortlaut:
Deutschlandfunk Kultur: Über Ihre 17 Monate im Weißen Haus als Sicherheitsberater haben Sie, John Bolton, ein Buch geschrieben, das seit seinem Erscheinen in den Bestseller-Listen steht, auch in Deutschland. Es ist eine schonungslose Abrechnung mit Präsident Donald Trump, an dessen Amtsführung Sie kein gutes Haar lassen. Die deshalb vielleicht schwierigste Frage gleich am Anfang unseres Gesprächs: Was schätzen Sie an Donald Trump?
Bolton: Während seiner Präsidentschaft hat Donald Trump den Republikanern erheblichen Zulauf von Menschen gebracht, die wir hoffentlich halten können, auch wenn er von der Partei-Szene abtritt. Vor allem Arbeiter sind von den Demokraten und deren Linksruck geflohen. Vielleicht wäre das auch mit einem anderen Präsidenten passiert, aber tatsächlich sind sie mit Trump gekommen. Das ist etwas Positives.
Deutschlandfunkt Kultur: Das bezieht sich aber nicht auf seine Politik.
Bolton: Stimmt.
Deutschlandfunk Kultur: Können Sie sonst nichts Positives finden? Seinen Instinkt etwa? Oder sein Bauchgefühl? Oder seine für Washington ungewöhnliche, unkonventionelle Art? Oder dass er seine Meinung nicht hinter diplomatischen Floskeln versteckt hat?
Hören Sie das Interview auch im Original, ohne Übersetzung:
Audio Player
Bolton: Er hat immerhin das Verteidigungsbudget auf rund 750 Milliarden Dollar angehoben. Es war viel zu niedrig unter Präsident Obama. Allerdings fürchte ich, dass das Budget in einer zweiten Amtszeit von Trump, sollte er die Wahlen gewinnen, sinken könnte. Sicher sinkt es, wenn Biden gewinnt. Wer auch immer Präsident sein wird – ein Absenken des Verteidigungshaushalts hätte sehr negative Konsequenzen für die USA.
Deutschlandfunk Kultur: Das Buch, das Sie über Ihre Monate im Weißen Haus geschrieben haben – "Der Raum, in dem alles geschah" – ist sehr erfolgreich. Was war Ihre Motivation, das Buch zu schreiben, abgesehen davon, dass Sie legitimer und verständlicher Weise damit gutes Geld verdienen wollten?
Bolton: Wenn ich damit Geld verdiene – gut. Und wenn nicht – auch gut. Es ist wirklich keine leichte Aufgabe, 500 Seiten zu schreiben, aber ich wollte zu Papier bringen, was in meiner Zeit in der Trump-Regierung passiert ist und was ich gesehen habe. Ich wollte, dass die Amerikaner vor den Wahlen die Möglichkeit haben, diese Dinge zu erfahren und sich ihre eigene Meinung über diese Regierung zu bilden.
Natürlich enthält das Buch auch in Teilen meine Meinung. Aber ich habe versucht, das so weit wie irgend möglich zu begrenzen und mich auf die Fakten zu konzentrieren, auf das, was wirklich geschah, und die Menschen ihre eigenen Schlüsse ziehen zu lassen. Außerdem werden in 50 Jahren alle Akteure von heute nicht mehr leben. Das Buch aber bleibt.
Begreifen, was zur Loyalität verpflichtet – und was nicht
Deutschlandfunk Kultur: Für wen haben Sie das Buch geschrieben, denn Trump kann in den Augen seiner Anhänger nichts verkehrt gemacht haben. Und die anderen muss man nicht erst überzeugen.
Bolton: Ich bin nicht Ihrer Meinung. Es stimmt, dass die amerikanische Politik in den vergangenen Jahren genau aus dem Grund, den Sie beschreiben, deformiert worden ist. Es geht alles immer um Donald Trump. Er hat damit angefangen, unter dem Motto: Wenn du nicht seiner Meinung bist, bist du ein Versager. Aber andere haben diese Haltung übernommen. Inzwischen bedeutet Politik nicht mehr, dass man eine politische Philosophie entwickelt und nach Zustimmung sucht. Es ist immer nur: "Trump sagt dies, Trump sagt das". Und du kannst nur zustimmen oder eben nicht. Das ist eine Verzerrung von Politik. Wenn Trump die Wahlen verliert, werden die Republikaner sich fragen, wie man den Schaden, den er angerichtet hat, reparieren kann und wie wir den Klotz am Bein loswerden.
Deutschlandfunk Kultur: Können Sie sich an den Moment oder die Situation erinnern, die Ihren Wandel ausgelöst hat: von einem Anhänger und einem der wohl wichtigsten Berater von Donald Trump in Sachen Außenpolitik zu einem seiner schärfsten Kritiker? Was hat den Wandel ausgelöst?
Bolton: Es gab nicht den einen Moment oder das eine bestimmte Ereignis. Als ich im April 2018 zum White House Team gestoßen bin, hatte ich all die Kritik an Trump gehört und gelesen. Ich war also nicht naiv und sehr wohl informiert darüber, was die Leute von ihm dachten. Als ich den Job als Sicherheitsberater annahm, wurde ich von Trumps Kontrahenten kritisiert und von seinen Unterstützern gelobt.
Der Grund, warum ich so optimistisch war anzunehmen, dass ich etwas bewirken könnte, war, dass ich geglaubt habe, dass das Gewicht der Präsidentschaft und die Schwere der Verantwortung, mit der sich jeder Präsident konfrontiert sieht, einen Effekt auf Trump haben würde. Und das Buch beschreibt, wie ich in den 17 Monaten im Weißen Haus herausgefunden habe, dass das einfach nicht stimmt.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben also den Einfluss, den Sie als Berater haben würden, überschätzt? Sie wussten doch, worauf Sie sich eingelassen haben. Es hat sich aber gezeigt, dass Sie nicht den erhofften Einfluss hatten?
Bolton: Ich wusste nicht wirklich, auf was ich mich eingelassen hatte. Es wäre mir einfach nicht in den Sinn gekommen, dass Trump nicht den geringsten philosophischen Kompass hat, keiner wahrnehmbaren umfassenden Strategie folgt, ja nicht einmal in politischen Kategorien denkt, wie man sie gemeinhin versteht. Er fällt seine Entscheidungen auf der Grundlage von Instinkt, Bauchgefühl, persönlichen Beziehungen zu ausländischen Regierungschefs. Ich beschreibe die Entscheidungen, die er gefällt hat, als eine Inselgruppe einzelner, unverbundener Punkte. So kann man vielleicht im New Yorker Immobilienmarkt Erfolge erzielen – sicherlich ein Gebiet, von dem ich nichts verstehe – aber es ist, aus meiner Sicht, nicht der Weg, um eine erfolgreiche nationale Sicherheitspolitik zu betreiben.
Deutschlandfunk Kultur: Das US-Justizministerium hat versucht, das Erscheinen Ihres Buches zu verhindern und will noch immer gerichtlich die Streichung oder Änderung einiger Passagen erzwingen, mit dem Hinweis auf Geheiminformationen, die sie enthalten sollen. Aus Ihrer Sicht gibt es keine geheimen Informationen – nur indiskrete. Ist es aber nicht nachvollziehbar, dass Trump findet, dass Unterhaltungen mit dem Präsidenten immer als geheim einzuschätzen sind?
Bolton: Es hat schon sehr lange immer wieder Menschen gegeben, die über ihre Erfahrungen als Regierungsmitglieder geschrieben haben. Schon aus George Washingtons Regierung sickerten Dinge nach außen. Sein Finanzminister Alexander Hamilton und sein Außenminister Thomas Jefferson haben jeweils zum Beispiel mit Steuergeldern konkurrierende Zeitungen finanziert, in denen sie sich dann gegenseitig beharkt haben. Irgendwie ist es dem armen Washington gelungen, das politisch zu überleben.
So war es bei jedem anderen US-Präsidenten auch. Zuletzt hat Robert Gates, Verteidigungsminister unter Obama, ein Buch während der Obama-Regierung veröffentlicht. Ex-CIA-Chef George Tennant veröffentlichte sein Buch während der Präsidentschaft von George W. Bush. Ich glaube schon, dass Loyalität wichtig ist, aber wichtiger ist noch zu begreifen, wer oder was zur Loyalität verpflichtet. Bei Regierungsmitarbeitern ist das die Verfassung. Wir sind doch nicht im 12. Jahrhundert in Europa. Wir leben nicht in einer Feudalherrschaft. Und schließlich – wenn Trump selbst ein ehrenwerter Mann wäre, hätte das Buch vielleicht anders ausgesehen.
Trump wollte Erscheinen des Buches stoppen
Deutschlandfunk Kultur: Hätten Sie mehr enthüllen können und haben Sie sich dagegen entschieden, um keine Gründe zu liefern, das Erscheinen des Buches zu verbieten?
Bolton: Man kann in Amerika kein Buch verbieten. Trump wollte die Veröffentlichung vor den Wahlen verhindern. Die angeblich "geheimen Informationen" waren nur ein Vorwand. Er wusste, das Buch könnte einflussreich sein und tatsächlich peinlich für ihn. Es ist eindeutig, dass ich niemals geheime Informationen enthüllen wollte. Ich habe mit dem Buch vor der Veröffentlichung einen zweimonatigen Rezensionsprozess im Nationalen Sicherheitsrat durchlaufen. Die verantwortliche leitende Mitarbeiterin hat am Ende des Prüfungsprozesses entschieden, dass es keine geheimen Informationen in meinem Buch gibt.
Jedem, den die Einzelheiten interessieren, würde ich einen 18-Seiten langen Brief empfehlen, den ihr Anwalt gerichtlich zu Protokoll gegeben hat. In dem ist die Prüfung beschrieben und die Anstrengungen, die Trumps Anwälte unternommen haben, damit sie ihre Einschätzung ändert. Sie haben sie in fünf Tagen, insgesamt über 18 Stunden in Sitzungen festgehalten. Sie wollten erreichen, dass sie eine Erklärung unterschreibt, dass es doch geheime Informationen gäbe. Sie hat das abgelehnt. Das wird alles im laufenden Gerichtsverfahren herauskommen. Wir werden demonstrieren können, dass das Buch nichts enthält, was gerechtfertigter Weise als geheim einzustufen ist.
Deutschlandfunk Kultur: Mehrere Republikaner, darunter einige bekannte, haben sich zuletzt offen gegen Donald Trump positioniert. Sie wollen nicht mehr zu den Beifallsspendern des Präsidenten gehören. Aus der Ferne betrachtet, scheint das ziemlich risikolos, wenn nicht sogar opportunistisch, sich zum jetzigen Zeitpunkt gegen Trump zu stellen. Schließlich lassen die Meinungsumfragen seine Niederlage vermuten.
Bolton: Ich hätte mir sicherlich gewünscht, dass einige von ihnen das früher gemacht hätten. Aber lassen Sie mich Folgendes sagen: Nach der Travestie der Präsidentschaftswahlen 2016, als alle maßgeblichen Meinungsforscher, Kommentatoren und Politikanalytiker in den USA allesamt zu dem Schluss kamen, dass Hilary Clinton gewinnen würde, war es für sie alle ernsthaft peinlich, als sich das als nicht richtig herausstellte. In mancherlei Hinsicht denken beide Lager – Demokraten und Republikaner –, dass wir jetzt 2020 das gleiche Szenario haben könnten. Aber wissen werden wir das erst am Ende der Auszählungen.
Ich denke, niemand kann eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt sicher sein, wie es ausgeht. Ein demokratischer Abgeordneter wurde kürzlich mit der Aussage zitiert, dass er sich immer, wenn er auf die Zahlen schaut, die ganz nach einem Sieg von Joe Biden aussehen, selbst eine Ohrfeige verpasst, um sich daran zu erinnern, dass die Vorhersagen 2016 nicht gestimmt haben und auch jetzt wieder nicht stimmen könnten. Das mag metaphorisch sein, aber niemand kann tatsächlich wissen, wie es ausgeht. Wenn also jetzt Republikaner öffentlich kritische Dinge über Donald Trump sagen, ist das nicht ohne politische Gefahren für sie. Ich wünschte, mehr hätten es früher getan. Aber: besser spät als niemals.
Deutschlandfunk Kultur: Sie bestätigen in Ihrem Buch, dass Donald Trump 400 Millionen Dollar Militärhilfe zurückgehalten hat, um Druck auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj auszuüben, gegen den Demokraten Joe Biden und dessen Sohn wegen Korruptionsvorwürfen zu ermitteln. Warum haben Sie das nicht beim Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump ausgesagt? Das hätte vielleicht wirklich etwas bewirken können und Sie hätten Trump möglicherweise stoppen können.
Bolton: Das ist nicht der Fall. Ich habe angeboten im Senat auszusagen…
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben gesagt, Sie würden aussagen, wenn Sie vorgeladen würden. Es war klar, die republikanische Mehrheit würde das nie tun.
Bolton: Davon weiß ich nichts. Im Übrigen – wie wär’s, wenn Sie mich ausreden lassen? – Also, ich habe gesagt, ich würde im Senat aussagen. Der Senat hat aber beschlossen, keine Zeugen zu laden, vor allem, weil es keine Rolle spielen würde. Denn selbst alle, die glaubten, dass alles stimmt, was jene, die die Amtsenthebung anstrebten, vorgebracht haben, hielten das Verhalten von Trump zwar für anstößig – aber nicht in dem Maße, dass es eine Amtsenthebung gerechtfertigt hätte. Deshalb haben Sie Trump freigesprochen. Meine Zeugenaussage hätte also keine Rolle gespielt. Die Demokraten im Repräsentantenhaus, die das Amtsenthebungsverfahren wollten, haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Sollte Trump jetzt gewinnen, werden die USA und der Rest der Welt damit die negativen Folgen des Fehlers zu spüren bekommen.
Die Demokraten haben das Verfahren zusammen mit ihrem Nominierungsprozess für die Wahlen gesehen. Sie wollten auf keinen Fall eine zeitliche Verzögerung und haben sich darum nur auf die Ukraine-Affäre konzentriert. Und so kam es auch dazu, dass sie das Verfahren so gemanagt haben, dass die Republikaner nur abgeschreckt sein konnten. Die wurden damit so in eine politische Ecke getrieben, dass am Ende nur eine rein politisch motivierte Entscheidung stehen konnte. Und genau das war Trumps Freispruch im Senat.
Verfehltes Amtsenthebungsverfahren
Die Demokraten im Repräsentantenhaus hatten geglaubt, es würde Trump politisch schaden, wenn sie dieses Verfahren gegen ihn anstrengen. Ein fundamentaler Irrtum! Denn der Freispruch im Senat führte zu einem 180-Grad anderen als dem erwünschten Ergebnis: Anstatt Trump Fesseln anzulegen, haben sie ihn gestärkt.
Deutschlandfunk Kultur: Haben die Republikaner nicht erklärt, dass die Amtsenthebung daran scheitern würde, dass es keine Zeugen für die Vorwürfe gab? Sie hätten ein Zeuge sein können. Trotzdem sagen Sie, dass hätte nichts verändert?
Bolton: Haben Sie gehört, was die Republikaner im Senat gesagt haben? Jemand wie Senator Lamar Alexander? Der hat gesagt, dass man gar keine Zeugen braucht. Denn selbst wenn Trump militärische Hilfe mit der Aufnahme von Ermittlungen gegen die Bidens verbunden hätte – gefällt uns das nicht, aber es reicht nicht für eine Amtsenthebung.
Deutschlandfunk Kultur: Es hätte also andere, triftigere Gründe für eine Amtsenthebung gegeben, die die Demokraten nicht benutzt haben, weil es nicht zu ihrem Wahlkampfzeitplan passte?
Bolton: Sie haben im Grunde dasselbe getan, was sie Trump vorgeworfen haben – also, die legitimen Machtbefugnisse der Regierung, Militärhilfe zu vergeben, für politische Zwecke zu nutzen und die Ukrainer dazu zu bewegen, den Korruptionsvorwürfen gegen die Bidens nachzugehen. Was die Demokraten gemacht haben, war, das legitime und größte Machtbefugnis, das das Repräsentantenhaus besitzt, zu nutzen, um ein Amtsenthebungsverfahren auf den Weg zu bringen, das ihren politischen Zwecken dienen sollte.
Sie wollten nicht, dass der zeitliche Ablauf dabei diejenigen demokratischen Senatoren behindert, die zu der Zeit um die Nominierung als Präsidentschaftskandidat ihrer Partei noch im Rennen waren. Deshalb der Zeitdruck unter dem alles lief. Der einzige vergleichbare Fall in der US-Geschichte war der Watergate-Fall. Aber da war es schließlich seine eigene Partei, die Republikaner, die Nixon überzeugt hat, dass er nicht zu halten sein würde und der daraufhin zurücktreten musste. Eine solche Chance haben die Demokraten ignoriert.
Deutschlandfunk Kultur: Niemand wird daran zweifeln, dass Sie ein erfahrener Außenpolitiker sind, der herausragende Positionen in mehreren US-Regierungen hatte. Es hat also Gewicht, wenn Sie Trump als unprofessionell, unklug, sprunghaft, unwissend und ohne jede Strategie beschreiben. Sie sind dementsprechend kaum der Meinung von US-Außenminister Pompeo, der beim Nominierungskongress der Republikaner eine lange Liste von Trumps außenpolitischen Leistungen vorgebracht hat. Wofür würden Sie denn Trump loben – für nichts?
Bolton: Ich habe ja schon von der Erhöhung des Verteidigungshaushalts gesprochen …
Deutschlandfunk Kultur: Abgesehen davon …?
Bolton: Wenn Sie mich unterbrechen wollen, kann ich Sie nicht stoppen – aber höflich ist das nicht!
Warum die Erhöhung des Verteidigungshaushalts so wichtig ist, hat damit zu tun, dass das Auswirkungen hat auf andere Bereiche der US-Sicherheitspolitik. Das Budget ist wichtig Grundlage für vieles andere. Eine weitere wichtige Errungenschaft Trumps ist der Rückzug aus dem grob fehlerhaften Iran-Atom-Deal von 2015, dass er aus dem Vertrag mit Russland über die Begrenzung von nuklearen Mittelstreckenraketen ausgestiegen ist, den die Russen ständig verletzt haben und der weder China, noch Nordkorea, noch Iran eingebunden hat. Dass er aus dem "Offener Himmel"-Vertrag zwischen der NATO und Russland ausgestiegen ist, den die Russen missbraucht haben.
Die Tragödie der Trump-Regierung ist, dass wir global in vielerlei Hinsicht nicht mehr tun konnten. Trumps spontane und erratische Entscheidungen und seine Art an Außenpolitik heranzugehen, haben verhindert, mehr aus den vielen Gelegenheiten seiner Amtszeit herauszuholen.
Nicht warten, bis eine Atombombe Nordkoreas Chicago zerstört
Deutschlandfunk Kultur: Stimmt es, dass Sie sowohl im Falle Nordkoreas als auch Irans für präventive Militärschläge argumentiert haben, um einer potenziellen nuklearen Bedrohung vorzubeugen? Dass Sie eine wesentlich aggressivere Herangehensweise von Trump gewollt hätten, die dessen Art Politik wie einen "Deal" zu begreifen, widersprach?
Bolton: Ich vertrete seit Jahren, dass die Antwort auf das Atomproblem mit dem Iran, seine Unterstützung für Terrorismus und die anderen unheilvollen Aktivitäten im Nahen Osten und anderswo ein Regime-Wechsel wäre, um die islamische Revolution von 1979 zu kippen und die Kontrolle über das Land den Menschen zurückzugeben. Das war nicht das, was die Regierung Trump angestrebt hat. Sollte Iran letztlich Atomwaffen haben, wäre das eine große vergebene Chance gewesen.
Ähnlich ist es mit einer Reihe von Dingen, die wir hätten tun können, auch im Falle Nordkoreas oder auch Chinas. Ich denke, wir müssen China in die Pflicht nehmen für Nordkoreas Atomwaffenprogramm, für das sie, denke ich, verantwortlich sind. Ich habe die Möglichkeit diskutiert, gegen Schurkenstaaten militärisch vorzugehen, die versuchen Atomwaffen zu bekommen.
Ich glaube einfach nicht, dass die USA warten müssen, bis Nordkorea mit einer Atombombe Chicago in Schutt und Asche legt, bevor wir aktiv werden, um uns zu verteidigen. Keiner wünscht sich das natürlich. Aber meine Sichtweise ist der von General Joseph Dunford vergleichbar, der unter Obama zum Vorsitzenden des Generalstabs der Streitkräfte berufen wurde. Er hat gesagt: "Es ist undenkbar, dass die amerikanische Zivilbevölkerung Geisel dieser Bedrohung ist". Man kann doch nicht unnötig amerikanische Zivilisten opfern, nur, weil wie nicht die notwendigen Verteidigungsmaßnahmen ergreifen.
Deutschlandfunk Kultur: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Trump eine widersprüchliche Haltung zu Russland hat. Würden Sie sagen, er war zu nachgiebig gegenüber Moskau, dass Putin ihn um den Finger gewickelt hat? Haben Sie denn Grund zu der Annahme, dass er in Putins Schuld steht? Oder nur eine gewisse Seelen-Verwandtschaft mit ihm empfindet?
Bolton: Für Trump haben ausländische autoritäre Führungspersönlichkeiten eine gewisse Anziehungskraft. Ich verstehe das nicht, aber ich bin auch nicht sein Therapeut. Es ist jedenfalls schädlich für die amerikanische Außenpolitik. Ausländische Staatenlenker wie Putin, Chinas Xi Jinping, Nordkoreas Kim Jong Un oder der türkische Präsident Erdogan betrachten ihn als jemanden, der leicht über’s Ohr zu hauen ist und versuchen, das auszunutzen.
Es sagen immer alle: "Putin muss irgendetwas gegen Trump in der Hand haben", finanzielle Druckmittel, zum Beispiel. Aber noch niemand hat dafür irgendwelche Beweise vorgelegt. So etwas wäre extrem gravierend, und das allein hätte schon ausgereicht, ihn seines Amtes zu entheben. Wenn jedoch immerzu solche Vermutungen angestellt werden und sich keine Beweise dafür finden, dann ist es doch ein Einfaches für Trump zu sagen: "Alles Fake News."
Das Problem ist, dass viele Menschen eine so große Antipathie gegenüber Trump empfinden, dass sie bereit sind, ziemlich alles zu glauben, um ihn kritisieren zu können. Das macht es Menschen wie mir schwerer, die ihn für die eindeutigen, offensichtlichen Fehler seiner Politik zu kritisieren versuchen, wie sie aus seinen eigenen Worten hervorgehen, wenn andere von Gründen träumen, für die es keine Beweise gibt.
John Bolton: "Der Raum, in dem alles geschah: Aufzeichnungen des ehemaligen Sicherheitsberaters im Weißen Haus"
Aus dem Englischen von Shaya Zarrin und Patrick Baumgärtel
Das neue Berlin, 640 Seiten, 28 Euro
Deutschlandfunk Kultur: In Ihrem Buch schreiben Sie, dass es solche Beweise gibt, dass Trump seine Beziehung zu Chinas Xi Jiping versucht hat, für seine Wahl einzuspannen.
Bolton: Genau das sage ich doch gerade! Ich lege die Beweise auf den Tisch – in Hinsicht auf die Türkei, in Hinsicht auf China. Wenn denn jemand Beweise für Korruption hätte, was es ja wäre – sei es in Trumps Beziehung zu Putin oder zu anderen – dann auf den Tisch damit! Anstatt zu fragen, ob da etwas ist. Sollen Reporter es recherchieren und gegebenenfalls veröffentlichen.
Trump bekommt seine Stimme nicht – Biden auch nicht
Deutschlandfunk Kultur: In Ihrem Buch geben Sie der Welt den Rat, Donald Trump als eine Anomalie zu betrachten. Was wäre, wenn wir diese "Anomalie" vier weitere Jahre im Weißen Haus hätten?
Bolton: Der Schaden, den Trump angerichtet hat in den vergangenen vier Jahren, kann ziemlich schnell repariert werden. Da bin ich optimistisch. Aber eine zweite Amtszeit könnte diesen Schaden irreparabel machen. Deshalb werde ich zum ersten Mal in meinem Leben nicht für einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten stimmen. Ich werde aber auch nicht für Joe Biden stimmen. Ich werde den Namen eines konservativen Republikaners auf den Wahlzettel schreiben, von dem ich gehofft hätte, dass er Kandidat geworden wäre.
Deutschlandfunk Kultur: Was könnte denn außen- und sicherheitspolitisch besser sein mit einem Präsident Biden? Dass Politik wieder professioneller würde? Und das Amtsverständnis ein weniger autoritäres?
Bolton: So oder so werde ich am Wahltag nicht glücklich sein. Wenn Biden zu der Außenpolitik der Obama-Regierung zurückkehrt, bedeutete das einen Rückschlag für die amerikanische Außenpolitik. Es könnte noch schlimmer kommen – je nachdem wie stark der Einfluss der Linken bei den Demokraten sein wird. Der ist zuletzt sehr groß gewesen, wenn er sich auch mehr auf die Innenpolitik konzentriert hat.
Ich bin auch besorgt, was passiert, wenn die Demokraten den Republikanern die Mehrheit im Senat abnehmen. Dann würden sie den gesamten Kongress und das Weiße Haus kontrollieren.
Das Beste, was man vielleicht über Biden sagen kann, ist dieses: Warren Harding, der republikanische Präsidentschaftskandidat vor genau 100 Jahren, hatte seinen Wahlkampf nach dem Ersten Weltkrieg unter das Motto "Rückkehr zur Normalität" gestellt. In mancher Hinsicht wird Biden – obwohl ihm der Vergleich nicht gefallen wird – hoffentlich eine solche "Rückkehr zur Normalität" darstellen.
Deutschlandfunk Kultur: Würden Sie denn begrüßen, dass es mit Biden wieder mehr Dialog mit Freund und Feind gäbe? Und vielleicht auch eine Wiederbelebung der NATO?
Bolton: Das wäre Teil einer Rückkehr zur Normalität. Das hängt wirklich vom Einfluss der Linken bei den Demokraten ab. Gegen die sehen einige sozialdemokratische Parteien in Europa konservativ aus. Genau aus dem Grunde werden viele Republikaner, die Trump überhaupt nicht mögen, ihn trotzdem wählen. Und darum ist der Ausgang der Wahlen trotz anderslautender Meinungsumfragen sehr zweifelhaft.
Wahlergebnisse anzuzweifeln ist das Recht jedes Kandidaten
Deutschlandfunk Kultur: Es könnte sein, dass Donald Trump eine mögliche Niederlage nicht eingesteht, sollte er nur knapp verlieren. Was sagt das aus über die amerikanische Demokratie, dass es tatsächlich ernsthaft als Möglichkeit diskutiert wird, dass jemand einen Wahlausgang nicht akzeptiert?
Bolton: Lassen Sie uns die Dinge auseinanderhalten. Unsere nationalen Wahlen in den USA werden nicht auf der föderalen Ebene durchgeführt. Jeder US-Staat hat gesetzlich für sich die Fragen von Neuauszählungen oder Wahlanfechtungen geregelt. Wenn das Wahlergebnis in einem bestimmten Staat sehr eng ist, wie etwa 2000, als Al Gore das Ergebnis in Florida anzweifelte, wo Bush damals mit kaum 600 Stimmen Vorsprung gewann, dann kann es bis zum Obersten Gerichtshof gehen.
Es war Gores gutes Recht, das Wahlergebnis anzuzweifeln. Das Gleiche würde auch für Trump gelten. Es kann also durchaus sein, dass Donald Trump nichts anderes tut, als es Al Gore 2000 gemacht, dass er nämlich nicht sofort am Wahlabend die Ergebnisse anerkennt, sondern erst viel später. Das wäre, wie gesagt, sein gutes Recht. Uns gefällt vielleicht die Verzögerung nicht und die bestehende Unsicherheit, aber so sieht es das Gesetz nun mal vor.
Etwas anderes wäre es, wenn der ganze juristische Prozess durchlaufen ist, und er würde das Ergebnis noch immer nicht anerkennen. Das wäre dann komplett inakzeptabel.
Deutschlandfunk Kultur: Beunruhigt es Sie, dass sich Trumps Fans von ihm ermuntert fühlen, Wähler vor den Wahllokalen einzuschüchtern? Das passiert ja momentan schon bei den Frühwählern, wie einige US-Bürgermeister bereits gewarnt haben.
Bolton: Das beunruhigt mich sehr! Damit wird illegales Verhalten befürwortet. Wenn irgendjemand dabei beobachtet wird, dass er Wähler einschüchtern will, dann sollte er festgenommen und angeklagt werden. Wenn es also diesen Bürgermeistern, die da warnen, ernst ist und nicht eher eine politische Agenda dahintersteckt – das passiert nämlich, dass Bürgermeister politisch werden – dann sollten sie die Leute finden, die sich verabreden, Wähler einzuschüchtern und sie verhaften.
Deutschlandfunk Kultur: Ich finde es schwer verständlich, dass Sie einerseits schreiben, dass der Trumpismus an den Wahlurnen besiegt werden muss. Und gleichzeitig aber sollen die Leute aus Ihrer Sicht auch nicht Joe Biden wählen. Was sollen die Leute also tun?
Bolton: Die Leute sollen tun, was sie wollen. Ich sage ja nur ich werde für keinen der Kandidaten stimmen. Ich folge damit der Tradition des langjährigen amerikanischen Arbeiter-Führers George Meany. 1972 sagte er zu Richard Nixon, dass er zum ersten Mal in seinem Leben seine Stimme nicht dem Kandidaten der Demokraten geben würde. Aber er hat Nixon auch gesagt, dass er seine Stimme auch nicht bekommen würde. Und so mache ich das auch.
Deutschlandfunk Kultur: Wenn aber eine Menge Leute Ihrem Beispiel folgen würden, dann würden eine Menge Leute gar keinen Präsidenten wählen.
Bolton: Ich habe 2016 für Trump gestimmt. Wenn ich ihn jetzt nicht wähle, heißt das, er bekommt eine Stimme weniger. Wir haben ja das Wahlmännersystem. Ich lebe in Maryland. Ich könnte ganz und gar zu Hause bleiben, ohne dass es eine Bedeutung hätte. Die letzten Umfragen sehen Joe Biden 30 Prozent vor Donald Trump. Biden wird Maryland gewinnen – egal ob ich für ihn stimme oder nicht.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.