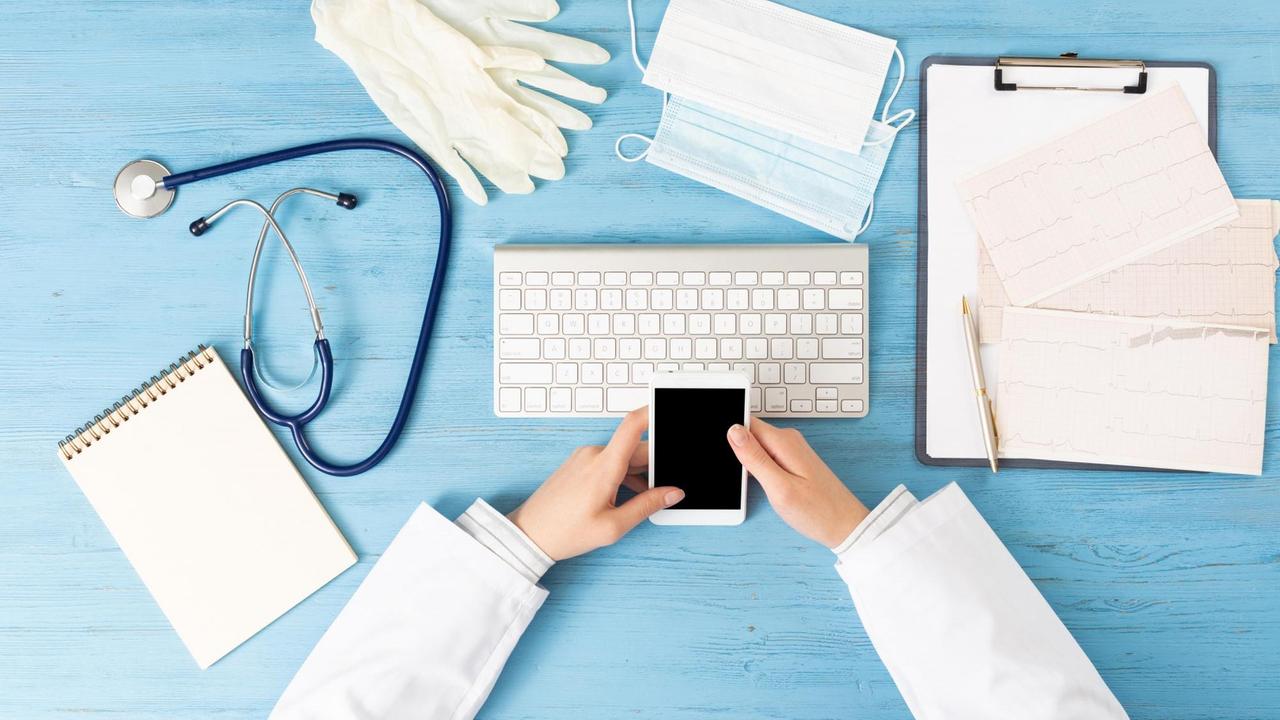Eine ungewöhnliche Ausstellung erwartet die Besucher der Alten Mälzerei in Berlin-Lichtenrade im Frühjahr 2022. An den Wänden hängen bizarr verfremdete, knallbunte Badekappen, übersät mit Stacheln, Trinkhalmen oder Wattestäbchen. Aber hier geht es nicht um Pop-Art.
Beate Kothe verfolgt mit ihren Exponaten ein ganz persönliches Anliegen. „Die Geschichte dazu ist, dass ich eine Erkrankung habe und seit zehn Jahren auf Diagnosesuche bin. Ich habe in dieser Zeit, um mein Gedankenkarussell zu stoppen, angefangen Badekappen zu bekleben.“
Beate Kothe leidet an einer ungeklärten, zunehmenden Muskelschwäche.
„Das ist so eine Art Vibrieren in den Beinen. Man hat keine richtige Kraft mehr, als ob das alles wattig ist. Man bekommt die Beine gar nicht hoch beim Rennen. Wenn mal eine S-Bahn gekommen ist, habe ich versucht, dahin zu rennen. Ich habe gedacht, ich kriege die Beine gar nicht angehoben“, erzählt sie.
„Es sind alle Messungen gemacht worden“
Alle möglichen diagnostischen Hebel wurden in Gang gesetzt, um die Sache abzuklären.
Es sind eben alle Messungen gemacht worden. Ich war ja auch mehrmals in Kliniken und habe mich da komplett durchchecken lassen und die ganzen Untersuchungen: EMG, MRT, Nervenwasserentnahme, zwei Muskelbiopsien. Genetisch untersucht.
Beate Kothe
Alles ohne Befund. Immerhin, kein erblicher Muskelschwund, wie anfangs befürchtet. Beate Kothe leidet an “Medically unexplained symptoms”, so der Fachausdruck: medizinisch nicht erklärbaren Symptomen. Keine Seltenheit, denn jeder fünfte Arztbesuch erfolgt wegen solcher unklarer Beschwerden. Treten diese Beschwerden chronisch auf, dann spricht die Psychosomatik von somatoformen oder neuerdings auch von funktionellen Störungen.
„Dann sitzt man natürlich auch und weint, weil man ja verzweifelt ist. Es muss doch eine Erklärung dafür geben. Dann kriegt man eben ein Antidepressivum. Das war das Erste, was ich dann verschrieben bekommen habe. Mit der Botschaft: Also so Frauen wie sie, die kenne ich. Dann kriegen sie von mir mal Cipralex“, erzählt Beate Kothe.
Am Anfang fanden die Ärzte ihren Fall spannend. Doch plötzlich nur noch Desinteresse. Sie wird abgewimmelt und bekommt kaum noch Arzttermine. Den Grund hierfür entdeckt sie zufällig in ihrer Krankenakte.
Gesicherte Diagnose: Somatisierungsstörung
„Da habe ich mir mal eben einen Ausdruck zukommen lassen. Da steht dann auch drin: Diagnose F 45.0. Gesicherte Diagnose, dass ich eine Somatisierungsstörung habe“, erzählt Beate Kothe. „Das ist eben der Schlüssel, den der Arzt dann da reingestellt hat, wahrscheinlich für die anderen Kollegen, die sich dann die Akte nehmen. Wenn ich da wieder mal nach einem Jahr aufschlage: Aha, Somatisierungsstörung! Gesicherte Diagnose.“
Der Begriff Somatisierungsstörung meint, dass Beschwerden nur dem Anschein nach auf körperlichen Ursachen beruhen. Da keine medizinische Ursache gefunden wurde, nimmt man an, dass dem Patienten die eigene Psyche einen Streich gespielt hat.
Beate Kothe kann mit solchen Erklärungen nichts anfangen. Ein Versuch mit Psychotherapie scheiterte. Ihre Beschwerden sind für sie real. Die Ursache sei nur noch nicht gefunden.
Doch genau diese Überzeugung sei typisch für die Somatoforme Störung, erklärt die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrer bisher gültigen internationalen Klassifikation der Krankheiten, kurz ICD genannt.
„Das Charakteristikum ist die wiederholte Darbietung körperlicher Symptome in Verbindung mit hartnäckigen Forderungen nach medizinischen Untersuchungen, trotz wiederholter negativer Ergebnisse und Versicherung der Ärzte, dass die Symptome nicht körperlich begründbar sind.“
Dass Ärzte auch einmal etwas übersehen können, dass Befunde inkompetent ausgewertet werden oder dass die Medizin einfach noch nicht so weit ist, um bestimmte Krankheiten zu erkennen, all dies ignoriert die WHO-Definition der Krankheiten.
Ein idealer Lückenfüller
„Die Diagnose, die ich habe, ist nicht die Diagnose, die zu mir passt“, sagt Beate Kothe. „Ich habe eine, sage ich jetzt mal, Art Arschdiagnose. Na ja, das ist wirklich so. Es ist eine Diagnose für Menschen, wo die Ärzte nicht wissen: Was hat die Patientin? Und dann kann es eben nur das sein. Hauptsache, wir haben eine Diagnose für die Patientin. Wir können irgendwas eintragen.“
Über 69.000 medizinische Diagnosen sind im internationalen Krankheitsverzeichnis der WHO, dem ICD, aufgeführt. Die Diagnose “Medizinisch unklare Erkrankung” existiert allerdings nicht. Da bietet sich die somatoforme Störung als idealer Lückenfüller an.
„Also man muss eigentlich auch in der Lage sein, seine Diagnosen offenzuhalten, wenn man sie erst mal noch nicht klären kann. Aber wenn einem dann aus Abrechnungsgründen aufgezwungen wird, irgendeine Diagnose zu stellen, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass dann zum Beispiel so eine F 45-Diagnose viel zu ungeprüft gestellt wird“, erklärt er. „Das sehe ich auch als ein echtes Problem. Die Stellung dieser Diagnose muss auf einer adäquaten Diagnostik beruhen und die kann nicht nur im Nichtfinden einer organischen Erklärung bestehen.“
Deshalb sei auch die bisherige ICD-Definition für psychosomatische Störungen problematisch, meint Henningsen.
Klare Faktoren für die Diagnose
„Da gibt es ganz klare Faktoren: Zum Beispiel die Tatsache, dass jemand mehrere solcher unklaren Beschwerden gleichzeitig hat. Wenn es biografische und andere Belastungsfaktoren, wie zum Beispiel Traumatisierungen in der Vorgeschichte gibt, dann erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit. Wenn es begleitend eine erhöhte Depressivität und Angst gibt, erhöht das die Wahrscheinlichkeit. Also es gibt viele Faktoren, die diese Diagnose absichern“, erklärt er.
Bei einer psychosomatischen Diagnose sind ganz klare Faktoren zu beachten, erklärt Peter Henningsen.© picture alliance / Zoonar / Khakimullin Aleksandr
Und nur, wenn solche Kriterien erfüllt seien, sei es legitim, die Psyche des Patienten als Ursache mit ins Spiel zu bringen. Psychosomatische Diagnosen beanspruchen zudem keinen Absolutheitsanspruch.
Bei den sogenannten funktionellen Erkrankungen halten wir uns immer offen, ob sich nicht doch irgendein therapierelevanter, biologischer Befund, eine Entzündung, irgendetwas findet. Gleichzeitig behandeln wir die Patienten aber psychotherapeutisch, körperlich aktivierend und eben insgesamt psychosomatisch und erreichen damit auch deutliche Besserungen, aber eben auch in einem biopsychosozialen Gesamtverständnis.
Peter Henningsen
Fünf Jahre dauert die Ausbildung zum Facharzt für psychosomatische Medizin. Rund 2300 dieser Fachärzte gibt es in Deutschland. Ihre Diagnosen sind zuverlässig. Das belegen zahlreiche Studien.
Abklärung durch Facharzt nicht notwendig
Nur – und das ist der springende Punkt: Die überwiegende Zahl der psychosomatischen Diagnosen wird nicht von Fachleuten, sondern von Hausärzten, Orthopäden oder Gynäkologen gestellt. Denn jeder Arzt, egal wie qualifiziert, kann in Deutschland eine psychosomatische Diagnose stellen. Die Abklärung durch einen Facharzt für Psychosomatik ist nicht notwendig.
Dementsprechend ist auch die Qualität der Befunde, wie eine Studie 2003 belegt.
„Die Ergebnisse sprechen für eine dringend erforderliche, bessere Ausbildung in der Diagnostik von niedergelassenen nicht psychiatrischen Fachärzten. Zwischen den Krankenschein-Diagnosen und den Fach-Diagnosen bestand nur eine geringe Übereinstimmung. Die diagnostizierenden Ärzte waren in der Regel nicht spezialisiert auf psychische Störungen, sondern Allgemeinmediziner und Gynäkologen. Am häufigsten wurden somatoforme Störungen genannt.“
Doch genau diese Diagnose war in sechs von sieben Fällen falsch. Ein Desaster. Nun sollen Kurse zur psychosomatischen Grundversorgung für ambulant tätige Ärzte Abhilfe schaffen. 20 Theoriestunden, ergänzt durch Rollenspiele, das Ganze größtenteils auf freiwilliger Basis.
Doch noch nicht einmal die Bundesärztekammer weiß, wie viele Ärzte diesen Grundkurs in Psychosomatik absolviert haben. Hat sich die Diagnosequalität dadurch verbessert? Es fehlen entsprechende Daten. Eine erneute Kontrollstudie steht bisher aus.
Frauen erhalten Diagnose auffällig häufiger
Psychosomatische Diagnosen werden mit Abstand am häufigsten bei Frauen gestellt. Ein Befund, für den es offiziell keine schlüssige Erklärung gibt.
Die amerikanische Feministin Maya Dusenbery sieht hier unbewusst diskriminierende Denkschemata am Werk. Ihr Buch “Doing Harm” zu Deutsch “mit Absicht schädigen” hat in den USA ein enormes Medienecho ausgelöst.
„Ich denke, dass die Medizin Frauen generell und systematisch benachteiligt. Bei dieser Voreingenommenheit geht es nicht um bewusste Vorurteile oder böswillige Absichten, sondern um unbewusste Denkmuster“, erklärt sie. Es ist eben nicht egal, ob ein Mann oder eine Frau über Beschwerden klagt, meint die Autorin.
Gerade bei Frauen gibt es eine Tendenz zur Psychologisierung, wenn sie über ihre Symptome berichten. Ihnen wird seltener geglaubt. Frauen müssen beweisen, dass ihnen wirklich etwas fehlt. Das geht auf das althergebrachte Konzept der Hysterie zurück. Nach dem Motto: Symptome, die sich nicht körperlich erklären lassen, müssen eben eine psychische Ursache haben.
Maya Dusenbery
Ihre Thesen untermauert Dusenbery mit Dutzenden von klinischen Studien, die genau diese Voreingenommenheit gegenüber weiblichen Patienten dokumentieren. Besonders eindrucksvoll bei der Diagnostik von Hirntumoren.
Systematische Benachteiligung von Frauen
„Eine Studie aus dem Vereinigten Königreich analysierte bei Hirntumorpatienten die geschlechtsspezifische Diagnoseverzögerung. Wie viele Arztbesuche waren zur Diagnosestellung notwendig? Es hat sich gezeigt, dass Frauen mehr Ärzte aufsuchen mussten und dass ihnen oft gesagt wurde, es sei nur Stress oder sie seien einfach müde“, erzählt sie.
Hirntumore wurden bei Männern nach höchstens einem Jahr, bei Frauen dagegen erst nach bis zu drei Jahren entdeckt. Mit erheblichen Konsequenzen für die Prognose. Aber auch beim Herzinfarkt, bei Krebsleiden und selbst bei Corona lässt sich die systematische Benachteiligung von Frauen klar belegen.
Um diese Diskriminierung zu umgehen, entwickeln Frauen eine Gegenstrategie.
„In meinen Interviews haben mir die Frauen erzählt, dass sie in der Arztpraxis ihrer Symptome bewusst zurückhaltend schildern, um ja nicht als hysterisch abgestempelt zu werden. Aber das ist natürlich zwiespältig. Wenn jemand zu gleichmütig ist, dann denken die Ärzte: Da ist es nichts wirklich Ernsthaftes“, sagt Maya Dusenbery.
Frauen schilderten Ärztinnen und Ärzten ihre Symptome bewusst zurückhaltend, sagt Maya Dusenbery.© imago / Ikon Images
Aber auch bei Männern gibt es die Tendenz, unklare Befunde der Psyche zuzuschreiben. Es geht um die Herzneurose. Anfallartige Herzschmerzen, die sich wie ein Herzinfarkt anfühlen, aber keiner sind. Doch die eigentliche Ursache ist nicht selten ein unerkanntes organisches Leiden.
Vorschnelle Diagnose bei unklaren Herzbeschwerden
„Oft ist das dann so, wenn der Rettungsdienst oder der Notarzt vor Ort sind und den Patienten noch in die Klinik bringen, dass dann eben keine Befunde, die auf ein Herzproblem hinweisen, mehr zu finden sind“, sagt Professor Peter Ong, Kardiologe am Stuttgarter Robert Bosch Krankenhaus.
Und weiter: „Dann sagt der Hausarzt, wir haben alles untersucht. Ich glaube, sie haben ein psychisches Problem, gehen sie mal zum Psychologen. Der Psychologe sagt: Ja, sie haben auch viel Stress und jetzt machen wir mal eine Psychotherapie und die Patienten haben immer noch Beschwerden. Es geht Ihnen nicht besser. Und so geht das dann über Jahre. Das sind dann wirklich berührende Geschichten, wo man sich fragt: Wahnsinn, wie diese Menschen über einen so langen Zeitraum damit zurechtgekommen sind.“
Denn die Ursache dieser Herzbeschwerden sind nicht Stress oder Angst. Dahinter steckt nicht selten ein Koronarspasmus: die krankhafte Neigung der Herzkranzgefäße, sich spontan zu verkrampfen. Nach wenigen Minuten endet die schmerzhafte Episode, ohne Spuren zu hinterlassen. Bis zur Hälfte der Patienten, bei denen sich der Verdacht auf Herzinfarkt im Krankenhaus nicht bestätigt, könnten hiervon betroffen sein.
„Ich würde sagen, ich sehe das also jede Woche, dass Patienten eine psychosomatische oder psychiatrische Diagnose haben, das ist oft nicht nur Herzneurose, sondern auch Begriffe wie zum Beispiel Angststörung oder Panikattacken, die da diagnostiziert werden“, erzählt Peter Ong.
Endgültige Klarheit schafft nur eine spezielle Herzkatheteruntersuchung. Die Diagnose Koronarspasmus ist für die Betroffenen meist eine Erlösung. Denn die Krankheit lässt sich hervorragend medikamentös behandeln.
Wir haben hier Patienten aus ganz Deutschland, die zu uns kommen und die hier sitzen und den Tränen nahe sind, wenn wir denen dann nach fünf Jahren Leidensgeschichte sagen: Jetzt wissen wir endlich, was sie haben.
Peter Ong
Beharrlichen Kampf gegen Fehldiagnose
Triathlon im oberfränkischen Roth. Die “Roth-Challenge” ist ein internationales Event. Mit dabei die marathonbegeisterte Krankenschwester Sabine Schüler. Dass sie jetzt wieder mitläuft, verdankt sie ihrem beharrlichen Kampf gegen eine psychosomatische Fehldiagnose. Angefangen hat alles mit merkwürdigen Symptomen.
„Also ich hatte unwahrscheinliche Kopfschmerzen. Mir war ständig übel. Was aber am auffälligsten war, dass ich psychisch sehr auffällig war. Also ich habe ja eher wie depressiv gewirkt oder schizophren, war eigentlich nicht mehr ich selbst. Na ja, es war damals die Trennung von meinem Mann und ich habe berufsbegleitend studiert. Und da hat man irgendwann gedacht, ob es nicht ein Burn-out wird“, erzählt Sabine Schüler.
Zur Sicherheit hat Ihre Hausärztin sie in einer Klinik durchchecken lassen. Alles unauffällig. Für die Klinikärzte war der Fall damit klar und das wurde Sabine Schüler auch drastisch nahegelegt.
„Das bilden sie sich alles nur ein und sie müssen jetzt einfach damit mal leben, dass das alles psychisch ist. Irgendwann hieß es dann: Ich soll jetzt mal friedlich sein. Man hat ja gesagt, ich habe mir diese Symptome alle in irgendeinem Fachbuch ausgesucht, weil ich da Zugriff hatte“, erzählt sie.
„Im Entlassbericht steht tatsächlich drin, die Diagnose F 45.0, dass das alles psychosomatisch ist, als Erstdiagnose. Das kriegt auch eine Rentenversicherung, das kriegt die Krankenkasse, das kriegt der medizinische Dienst. Es kriegt jeder. Also ich finde es eine Frechheit, dass man so was reinschreibt und keine entsprechende Hilfe anbietet.“
Einschneidende soziale Folgen
Die Klinik brauchte eine Diagnose. Nicht nur um abrechnen zu können, sondern auch, damit ihr Bett wieder frei wurde, vermutet die fränkische Krankenschwester. Die eigentliche Katastrophe waren aber die sozialen Folgen der Fehldiagnose.
„Die haben sich sowieso schon distanziert, weil ich halt nur noch wirres Zeug erzählt habe. Das war halt auch noch so erschreckend, dass das Krankenhaus der Meinung war: Es ist alles gut bei mir. Ich spinne halt“, sagt Sabine Schüler.
Sie erzählt weiter: „Die anderen haben sich halt gedacht: Um Gottes willen, was ist mit der los? Dann wurde das noch von zu Hause aus alles bedeckt gehalten, dass ja keiner merkt, dass ich nicht mehr ganz rund laufe. So stand ich halt ganz schnell allein da. Also ich hatte weder Freunde noch Familie, die mir irgendwie in der Zeit geholfen haben.“
Gerettet hat sie der pure Zufall. In einem Wartezimmer der Klinik erzählte eine Mitpatientin nebenbei von einer neu entdeckten Krankheit. So eine Art „Rheuma des Gehirns“, ausgelöst durch Autoimmunantikörper. Sie solle das mal mit den Ärzten besprechen. Unsinn meinten die. Viel zu selten. Nach ihrer abrupten Klinikentlassung ging ihr dieses Gespräch nicht mehr aus dem Kopf.
Rettung durch einen Zufall
Ich habe dann wirklich in meiner Verzweiflung nachts im Internet recherchiert, was es mit diesen Antikörpern überhaupt auf sich hat. Und: Dass es in Deutschland drei Ärzte gibt, die sich zum Thema Autoimmunhirnentzündungen befassen. Gut, jetzt soll man natürlich keine Diagnose im Internet suchen. Aber für mich war es die Rettung.
Sabine Schüler
Ihre Verdachtsdiagnose hat sich bewahrheitet. Die Autoimmunenzephalitis beginnt typischerweise mit einer schweren Depression und führt im schlimmsten Fall als Schizophrenie in die Psychiatrie. Wird die Krankheit jedoch erkannt, dann lässt sie sich mit üblichen Rheumamedikamenten gut behandeln. Nach wenigen Tagen war der Spuk vorbei. Selbst Marathonlaufen geht nun wieder.
Auf die Klinik ist sie nicht mehr gut zu sprechen. Entschuldigt hat sich niemand bei ihr und korrigiert wurde die falsche psychosomatische Diagnose auch nicht. Ein extremer Einzelfall? Wahrscheinlich nicht, wie neuere Forschungsergebnisse vermuten lassen.
Die Psychiatrische Abteilung der Uniklinik Freiburg.
Professor Ludger Tebartz van Elst und sein Team sind einem spektakulären Verdacht auf der Spur: Fälle wie der von Sabine Schüler könnten viel häufiger sein als bisher vermutet. Die Spuren dieser Entzündungen finden sich im Hirnwasser, das im Rahmen einer harmlosen Routinepunktion entnommen werden kann. Bisher wurde das noch nie systematisch geprüft.
Unerkannten Entzündungen auf der Spur
„Wir haben Patienten mit Psychosen, aber durchaus auch mit Depressionen angeboten diese Gehirnwasseruntersuchung zu machen und haben jetzt geguckt: Finden wir denn tatsächlich auch im Gehirnwasser Hinweise auf die Entzündungsreaktion? Da haben wir festgestellt: Hinweise auf Entzündungsreaktionen, die fand man bei ungefähr 20 Prozent, sowohl der depressiven Patienten, als auch der Patienten mit Psychosen“, sagt Ludger Tebartz van Elst.
Über die Ursachen schwerer psychischer Erkrankungen wird seit Jahrzehnten spekuliert. Sollten sich die Freiburger Befunde bestätigen, dann müssten gleich reihenweise psychosomatische und psychiatrische Krankheitsbilder neu definiert werden. Chronische psychische Erkrankungen wären plötzlich heilbar, zum Beispiel mit entzündungshemmendem Kortison.
Der Freiburger Psychiater mit einem Fall aus seiner Klinik: „Das war eine Patientin mit einer klassischen Schizophrenie. Sie hat Stimmen gehört. Und sie hatte auch noch eine Vorgeschichte mit Depressionen. Sodass ich dachte: Na dieses Muster ist wirklich so klassisch Schizophrenie. Ich hatte immer mal überlegt, sollen wir ihr Cortison geben oder nicht. Habe aber immer davon abgesehen, weil ich dachte: Das ist jetzt so klassisch bei ihr. Weil wenn wir ihr jetzt Cortison geben, dann müssen wir ja allen Cortison geben. Wir haben es gemacht und eine Woche später war sie symptomfrei. Das war ein sehr, sehr eindrückliches Erlebnis für mich und macht klar: Vom Typ an sich, der kann so klassisch psychiatrisch aussehen, wie er will. Das schließt es nicht aus.“
Mehr Umsicht bei der Diagnostik ratsam
Chronische Abgeschlagenheit, Gedächtnisstörungen bis hin zur Demenz, selbst unklare Lähmungen. Eine Entzündung des Gehirns kann alle möglichen Symptome verursachen. Symptome, die schnell auch als psychosomatisch fehlinterpretiert werden. Noch ist viel Forschung notwendig, um die Zusammenhänge abzuklären. Doch aufgrund der aktuellen Erkenntnisse hält Tebartz van Elst mehr Umsicht bei der Diagnostik für angebracht.
Bei relevanten schweren psychischen Störungen, wie einer schweren Depression, sollte man nach meinem Dafürhalten breit diagnostizieren. Damit man solche Ursächlichkeit nicht übersieht, weil man die dann ja Erfolg versprechend behandeln kann.
Ludger Tebartz van Elst.
Oft sind es sogenannte seltene Erkrankungen, die nicht erkannt werden und die dann zu psychosomatischen Störungen erklärt werden. 35 Zentren gibt es mittlerweile in Deutschland, die sich auf seltene Erkrankungen spezialisiert haben.
Professor Jürgen Schäfer vom
Zentrum für seltene Erkrankungen an der Uni Marburg erklärt: „Es gibt allerdings über etwa 6000 bis 8000 verschiedene seltene Erkrankungen, sodass die Summe aller Betroffenen, die an einer seltenen Erkrankung leiden, im Bereich von 4 Millionen in Deutschland liegt, also etwa 5 Prozent unserer Bevölkerung.“
Ratlosigkeit angesichts unklarer Befunde, das verträgt sich nicht unbedingt mit dem Selbstverständnis von Medizinern. Doch der bequeme Griff zur Verlegenheitsdiagnose „psychosomatische Störung“ ist meist die schlechteste Lösung, gibt Schäfer zu bedenken.
Herausforderung der seltenen Erkrankungen
„Wir müssen in der Medizin realisieren, dass wir vieles wissen, aber noch lange nicht alles. Da ist ein gewisses Maß an Demut wirklich angebracht. Viele Erkrankungen, die wir heute überhaupt nicht kennen oder als psychisch einsortieren, haben sich dann in den letzten Jahren zum Beispiel als Autoimmunerkrankung oder als eine Infektionserkrankung herausgestellt“, erklärt er.
Und weiter: „Also da tut sich im Moment sehr, sehr viel und für uns als wissenschaftlich orientierte Mediziner ist es halt wichtig, uns jeden Tag klarzumachen, dass wir noch viel zu lernen haben.“
Die Marburger Spezialisten können durchaus Erfolge vorzeigen. Bei etwa der Hälfte ihrer Patienten wurde eine seltene Erkrankung diagnostiziert. Die meisten dieser Krankheiten sind allerdings nicht therapierbar. Wozu dann der ganze Aufwand?
Was aus unserer Erfahrung den Patienten immer hilft, ist die Klarheit. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Patienten zum Teil diffamiert werden als Simulant, als Psycho, als jemand, der Rentenbegehren als Motivation hätte oder was auch immer. Zum Teil gehen da Freundschaften kaputt und Beziehungen, weil die Patienten einfach nicht fair betrachtet und fair behandelt werden.
Da sind fast alle Patienten froh und dankbar, wenn Sie wissen, was sie haben, selbst wenn man dieses Beschwerdebild nicht behandeln kann. Dann kann man zumindest sagen: Ich habe das und jenes und es ist verbrieft und so ist es.
Jürgen Schäfer
Das Gehirn rückt in den Fokus
Psychosomatische Diagnosen stoßen beim Patienten auf wenig Akzeptanz. Da schwingt das Vorurteil von der Psychomacke mit. Doch weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die Psychosomatik längst auf dieses Problem reagiert. Moderne psychosomatische Konzepte distanzieren sich ausdrücklich von der Idee, dass unklare Symptome ein Hilferuf der Seele sind.
Unklare Krankheitssymptome wie Schmerzen oder Lähmungen sind für ihn nicht Ausdruck einer kranken Seele, sondern eines kranken Gehirns. Eine völlig neue Sichtweise in der Psychosomatik.
„Jeder Gedanke, jede Wahrnehmung, die wir haben, die wir denken, die wir empfinden, spielt sich nun mal in einem Organ ab, in dem Gehirn und in allen anderen damit verbundenen Körpersystemen“, erklärt er.
Die Ursache vieler Probleme sind demnach falsch verarbeitete, meist körperliche Traumata. Eine Art Softwarefehler des Gehirns also.
Man kann das manchmal ganz genau nachvollziehen: Wie eine körperliche Verletzung zum Beispiel nach einem Autounfall zu starken Schmerzzuständen führt und sich aus einer ganz reflektorischen, normalen Schonhaltung heraus im Verlauf eine funktionelle Lähmung entwickeln kann: jenseits der bewussten Kontrolle.
Aber in solchen Fällen wäre es ein Irrweg, die unmittelbare Verbindung zu vorausgegangenen Kindheitstraumata oder Ähnlichem zu suchen.
Stoyan Popkirov
Mit Tricks die Störung erträglich machen
Bestes Beispiel: Tinnitus. Die Software, mit der unser Gehirn akustische Signale verarbeitet, wurde beschädigt. Durch ein zu lautes Geräusch oder einen entzündlichen Prozess im Mittelohr. Dieser Softwarefehler führt dazu, dass es nun dauerhaft im Ohr klingelt oder zischt.
„Es verselbstständigt sich ein möglicherweise anfangs sehr nützlicher als defensiver, aber auf jeden Fall natürlicher Automatismus oder Reflex, zum Beispiel im Rahmen von Schonhaltung, von Erstarren unter starker Belastung. Aus irgendeinem Grund verselbstständigt sich diese Empfindung oder diese Handlungsweise, ohne dass man das bewusst steuern kann – und vor allem, ohne dass man bewusst gegensteuern kann“, erläutert Stoyan Popkirov.
Beim Computer lässt sich ein defektes Betriebssystem einfach löschen und neu aufspielen. Beim Gehirn ist das leider nicht möglich. Aber es gibt Tricks, die Störung erträglich zu machen.
„Es gibt die Verhaltenstherapie, die zum Beispiel aus dem Teufelskreis Angst und Vermeidung sehr schön wieder herausführen kann. Es gibt körperorientierte psychotherapeutische Verfahren, bei denen wir lernen, mit den Signalen und den Empfindungen unseres Körpers besser umzugehen, sodass bei vielen funktionellen Störungen die Psychotherapie tatsächlich ein sehr gutes Therapieverfahren ist“, sagt Stoyan Popkirov.
Sinneswandel in der Psychosomatik
Dieses Umdenken in der Psychosomatik kommt für viele Patienten wahrscheinlich zu spät. Die Berlinerin Beate Kothe mit ihrem Muskelproblem zum Beispiel reagiert nur noch allergisch auf alles, was mit Psychosomatik und Psychotherapie zu tun hat. Zu viele schlechte Erfahrungen.
„Ich glaube auch nicht, dass man es heilen kann bei mir. Ich glaube es nicht. Das wird weiter voranschreiten. Ich muss es weiter aushalten. Ich habe auch eben wirklich Phasen, wo es eben nicht so gut ist, das auszuhalten, kämpfe mich dann da psychisch wieder raus und muss eben gucken, dass ich das Beste daraus mache“, sagt sie.
Eigentlich ein Armutszeugnis für die Psychosomatik, die sicher nicht nur bei Beate Kothe einen so verheerenden Eindruck hinterlassen hat. Doch das Fach beginnt, sich zu wandeln. Die Weltgesundheitsorganisation hat die aktuelle ICD-Definition grundlegend überarbeitet. Die Definition der somatoformen Störungen wurde abgeschafft.
Von nun an spielt es keine Rolle mehr, ob körperliche Beschwerden medizinisch erklärbar sind oder nicht. Stress durch Körpersymptome lautet in der Neufassung die Diagnose. Im Fachjargon somatische, also körperliche, Belastungsstörung. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Sinneswandel auch dazu führt, dass psychosomatische Verlegenheitsdiagnosen und das Vorurteil von der hysterischen Patientin bald der Vergangenheit angehören.
Autor: Horst Gross
Sprecherin: Monika Oschek
Regie: Beatrix Ackers
Technik: Hermann Leppich
Redaktion: Kim Kindermann und Gerhard Schröder