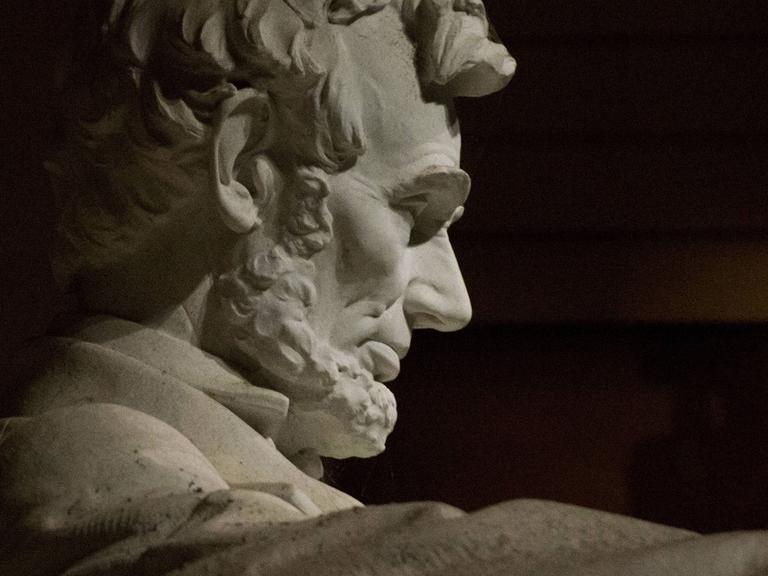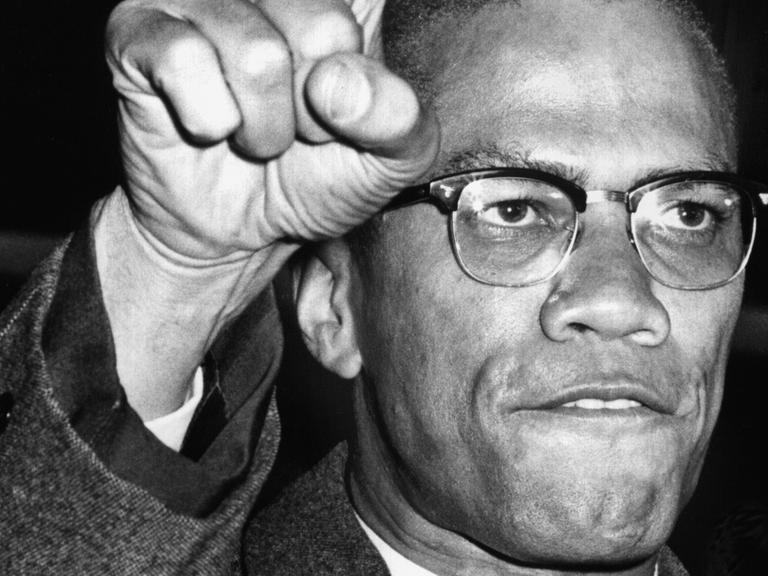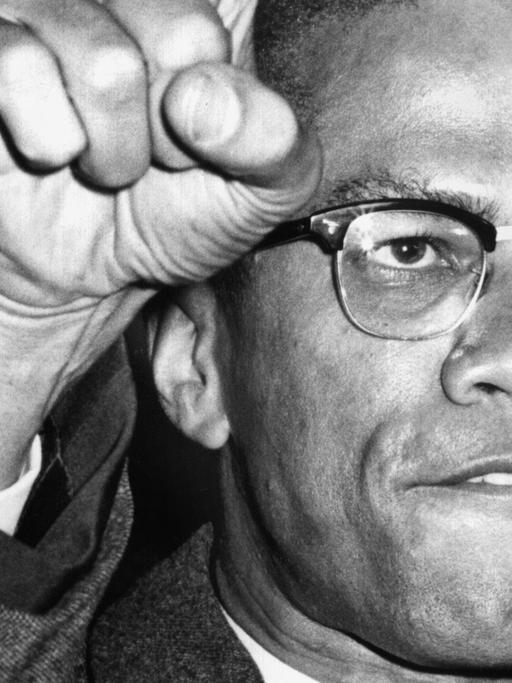Zu Besuch in einer gespaltenen Stadt

Die "Rassentrennung" wurde in den USA zwar vor 50 Jahren abgeschafft, Rassismus ist damit aber nicht verschwunden. 2014 wurde etwa in Ferguson ein 18-jähriger schwarzer Schüler von einem weißen Polizisten erschossen - maßgeblich war seine Hautfarbe. Das ist in den USA kein Einzelfall.
Wenn ich von der West Florissant Avenue in den Canfield Drive in Ferguson einbiege, vorbei an dem immer noch kaputten, mit Leichtbauplatten vernagelten und Sprüchen von "Black Lives Matter" bis "Hands up, don´t shoot" besprühten Quick Trip-Laden, dann höre ich den Nachhall der Schüsse, das Brummen der gepanzerten Einsatzfahrzeuge, das Schreien der Demonstranten im August 2014 und dann wieder ein Jahr später im August 2015.

Michael Browns Mutter Lesley McSpadden bei der Beerdigung ihres Sohnes im August 2014.© afp / Richard Perry
Dann sehe ich das Blumenmeer mitten auf der Straße, die Teddybären, die gerahmten Fotos von Michael Brown, dem unbewaffneten schwarzen Jungen, der am 9. August von dem weißen Polizisten Darren Willson erschossen wurde, der dafür nicht ins Gefängnis musste. Dann sehe ich jetzt eine in den Bordstein eingelassene Bronze mit dem Bild des Jungen, den sie hier im Viertel "Gentle Giant" nennen, den sanften Riesen.
"In Erinnerung an Michael O.D. Brown, geboren am 20. Mai 1996, gestorben am 9. August 2014. Ich wünsche mir, dass die Erinnerung an Michael Brown fröhlich ist. Er hinterließ ein Nachleuchten seines Lachens, als das Leben zu Ende war."
Es ist ruhig geworden hier in der Gegend mit den Apartmenthäusern. Kameras und Reporter sind längst weg. Jayden Black ist noch da. Der bärtige Glatzkopf ist 30, trägt Jogginghose und abgewetzte Turnschuhe.
Jayden Black: "Als sie Mike Brown umbrachten, wehrte sich die Gemeinschaft. Rate mal, was die Poizei jetzt macht. Sie verprügeln Nigger. Das ist die Wahrheit. Sie halten Leute wie Mike Brown auf der Straße an. Da sind wir wieder angekommen."
Jayden grinst bitter. Die Gewalt geht weiter, die Hoffnungslosigkeit steht ihm ins Gesicht geschrieben. Kein Job, keine Ausbildung, keine Perspektive. Die Stadt St. Louis, einmal eine der prächtigen Metropolen des Landes, ächzt unter Arbeitslosigkeit, Strukturwandel, immer wieder aufflammender Gewalt.

Die Polizei in der US-Kleinstadt Ferguson sieht sich mit Rassismusvorwürfen konfrontiert - und geht nach Ausschreitungen hart gegen Demonstranten vor.© AFP / Michael B. Thomas
Der Vorort Ferguson mit seinen 21000 Einwohnern ist eine ganz normale amerikanische Kleinstadt, die wie zahllose andere Kleinstädte über eine unsichtbare Grenze verfügt. Östlich der West Florissant Avenue sind die Menschen schwarz, arm und arbeitslos, westlich der Verkehrsader wohnen hauptsächlich weiße Angehörige der Mittelschicht. "I love Ferguson" steht auf den Schildern, die Bewohner trotzig in ihren Vorgärten ausstellen. Wir kommen doch gut zurecht, erzählt mir Brian Fletcher, der mit "I love Ferguson" T-Shirts, Tassen und Kinderspielzeug einen guten Schnitt gemacht hat.
Brian Fletcher: "....Schilder, Magneten, Sticker, Buttons. Verkauft sich alles. Wir sind so eine Art Touristenattraktion geworden. Leute aus den Vereinigten Staaten, aus der ganzen Welt kommen hierher. Wir waren viel in den Nachrichten. Einiges davon war nicht zutreffend. Tatsache ist: Es gibt ein Interesse an dieser Geschichte. Und die muss erzählt werden."
Ich möchte gerne wissen, wie er diese Geschichte erzählen will. Fletcher ist weiß, ein Geschäftsmann, der fast nie Kontakt zu den Menschen im Canfield Drive hat. Polizistin Domenica Fuller ist eine von vier schwarzen Beamten bei der 54-köpfigen Polizei von Ferguson. Sie trägt ihre glattgebügelte Uniform, Dienstmarke, Orden und Körperkamera mit Stolz. Ich spüre ihren inneren Konflikt. Einerseits ist ihre Arbeit schwierig und gefährlich. Im Land der großzügigen Waffengesetze kann ein Routineeinsatz schnell lebensbedrohlich werden. Andererseits geht die weiße Polizei anders mit Afroamerikanern als mit Weißen um. Immer noch.
Domenica Fuller: "Wir haben alle akzeptiert, dass es immer noch Spannungen unter den Rassen gibt, dass der Rassismus immer noch da ist. Nicht nur hier in St. Louis. Alle, die immer noch mit dem Finger auf Ferguson zeigen müssen verstehen: Rassismus gibt es überall."
Die Geschichte von Michael Browns Tod ist nach 1,5 Jahren verblasst, viele schwarze Amerikaner kamen danach gewaltsam ums Leben. Freddie Gray in Baltimore, die Opfer des Kirchenattentats von Charleston und viele mehr. Aber nach Ferguson begann die Debatte über den Umgang der weißen Polizei mit Afroamerikanern, die Initiative "Black lives matter" gab keine Ruhe, wenn es um Gewalt und Diskriminierung ging. Michael McMillan treffe ich bei der Urban League von St. Louis. Der hochgewachsener, weiße Chef der Bürgerrechtsorganisation saniert den kaputten Quick Trip-Laden am Canfield Drive und macht daraus ein Ausbildungszentrum.

Protestmarsch in Gedenken an den erschossenen Michael Brown in Ferguson/ Missouri am 13. Oktober 2014. © AFP / Foto: Joshua Lott
Michael McMillan: "Es geht ja immer weiter mit diesen Vorkommnissen. Wir präsentieren uns gern als die größte Demokratie der Menschheitsgeschichte und den 'Melting pot'. Aber wir sehen jetzt: Es gibt noch viel zu tun, um das wahr werden zu lassen."
Als ich die West Florissant Avenue überquere, vom Schwarzen in das Weiße Ferguson einbiege, wird mir klar. McMillan hat Recht. Der Vorort von St. Louis ist ein amerikanisches Paradebeispiel dafür, dass es in Amerika immer noch ein Nebeneinander und wenig Miteinander gibt. Das macht es 150 Jahre nach Abschaffung der Sklaverei, 50 Jahre nach dem gesetzlichen Ende der Rassentrennung schwer, die Probleme zu benennen und zu überwinden. Drastische Bildungsdefizite bei weiten Teilen der schwarzen Bevölkerung, miserable Berufschancen, Armut und Kriminalität. Lang eingeübte Ignoranz bei vielen weißen Amerikanern, die ihre Vorurteile abstreiten und die amerikanische Schande von Sklaverei, Rassentrennung und Unterdrückung verdrängen. Ich fürchte, die Situation der Menschen im Canfield Drive in Ferguson, Missouri wird sich auf Sicht nicht verbessern.