Wie der Klimawandel Heimat frisst

Steigender Meeresspiegel, Wirbelstürme, Extremwetter: Im pazifischen Inselstaat Fidschi leiden die Menschen schon stark unter den Folgen des Klimawandels. Die ersten Küstenbewohner sind bereits weiter ins Landesinnere gezogen -
mit zum Teil erheblichen negativen Konsequenzen.
Sailosi Ramatu steht auf einem Zementquadrat, das von den Wellen des Pazifiks umspült wird. Es ist der Rest seines ehemaligen Badezimmers.
"Das hier ist unser altes Dorf Vunidogoloa. Es war ein sehr schönes Dorf mit großen Bäumen. Als der Klimawandel kam, wurden uns der steigende Meeresspiegel, Überflutung und Erosion zum Verhängnis. Deshalb mussten wir von hier wegziehen.
Außer dem Zementquadrat ist von Ramatus Haus nichts mehr übrig. Verschluckt von den Wellen des Meeres oder versunken im Sand.

Das Zementquadrat war einmal das Badezimmer von Ortsvorsteher Sailosi Ramatu. Sein gesamtes restliches Haus im früheren Dorf Vunidogoloa ist vom Meer verschluckt oder im Sand versunken.© Tini von Poser
Von einem anderen Haus lugt nur noch das Wellblechdach aus dem Boden hervor. Dieses Dach und eine Handvoll leer stehender, herunter gekommener Holzhäuschen erinnern daran, dass hier mal ein Dorf gestanden hat. Vunidogoloa ist eines der ersten Dörfer in der Welt, die aufgrund des Klimawandels umgesiedelt wurden. Es liegt an der südlichen Seite auf Fidschis lang gestreckter, zweitgrößter Insel Vanua Levu, wo sich das Meer immer mehr ins Land frisst. Der 57-jährige Sailosi Ramatu ist das Oberhaupt von Vunidogoloa. Schlank, kurz geschorene schwarze Haare, freundliches Gesicht. Er strahlt eine sanfte Autorität aus. Das hellblaue Hemd hebt sich von seiner dunklen Hautfarbe ab. Und um seine Hüften trägt er, wie üblich in Fidschi, einen dunkelgrauen Wickelrock, den sogenannte Sulu.
"Früher hatten wir hier temporäre Fluten, die nur zu einer bestimmten Zeit kamen, doch mit diesem Klimawandel sind die Fluten unberechenbar geworden. Sie drangen jeden Tag ins Dorf ein, so dass uns manchmal das Wasser bis zu den Knien stand. Das waren die schlechteren Tage, als wir hier noch lebten."
Der Klimawandel kam schleichend nach Vunidogoloa
Mit gemächlichen Schritten und nachdenklichem Gesicht schreitet Ramatu über den nassen Sand. Sein Sulu weht im Wind. Manchmal kommt er noch hierher in das alte, ausgestorbene Dorf, hängt etwas wehmütig seinen Erinnerungen nach, gedenkt der Toten, die hier begraben liegen. Der schmale Küstenstreifen gleicht einem Schlachtfeld: Umgestürzte Bäume, Zweige von Kokosnusspalmen sind querbeet verstreut. Etwa zehn Meter vor der Küste ragen Baumstämme aus dem Wasser. Zeugnis dafür, wie stark der Meeresspiegel angestiegen ist.
"Ich bin hier geboren, habe mein ganzes Leben hier verbracht, bin hier zur Schule gegangen. Wenn ich über die Geschichte der Umsiedlung spreche, ist es sehr schwer für mich, denn all die Erinnerungen meines ganzen Lebens kommen hoch. Auch meine Eltern sind hier geboren. Ich erinnere mich daran, wie ich als Kind an sonnigen Tagen glücklich durch die Gegend rannte. Die Auswirkungen des Klimawandels machten sich erst schleichend bemerkbar. Als wir geboren wurden, so haben es unsere Eltern erzählt, spürten sie schon die Folgen des Klimawandels. Seit 2006 wurde es hier dann richtig bedrohlich, und da ist dieser ganze Prozess der Umsiedlung in Gang gekommen. Zu dieser Zeit versanken bereits viele Häuser im Meer, obwohl die Regierung Schutzwälle errichtet hatte: den ersten 1978, der wurde von den Wellen niedergerissen, einen weiteren in den 80er-Jahren, auch der fiel dem Meer zum Opfer."
Weitere 100 Dörfer allein in Fidschi müssen in den nächsten Jahren umgesiedelt werden, schätzt Wulf Killmann von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ. Ein Großteil der Fidschianer lebt nämlich direkt an der Küste. Killmann ist Projektleiter für Klimaanpassung im Südpazifik. Der Meeresspiegelanstieg hat verschiedene Ursachen, erklärt er:
"Wenn es wärmer wird, dann dehnt sich das Meerwasser aus, und das andere ist das Abschmelzen der Landgletscher: Grönland, Antarktis usw."
Dabei steigt der Meeresspiegel nicht überall auf der Welt gleich an.
"Im Schnitt sechs Millimeter pro Jahr, aber im Westen, im sogenannten Westpazifik Warm Pool - hier Melanesien, Papua-Neuguinea, Palau, Salomonen -, da kann es bis zu ein Zentimeter sein, und wenn Sie mehr Richtung Osten gehen, wo das Meer tiefer und kühler ist, vier Millimeter, fünf Millimeter. Im Schnitt sechs Millimeter. In zehn Jahren sind es sechs Zentimeter. Ist auch noch nicht viel, sieht man nicht, aber in 100 Jahren sind es 60 Zentimeter. Und wenn Sie eine Insel haben, eine kleine Atollinsel, die nur 2,5 Meter über dem Meeresspiegel rausguckt, dann sind plötzlich 60 Zentimeter weg, da verlieren sie allerhand an Landmasse.
Klimaveränderungen bedrohen Nahrungssicherheit
Antoine de Ramon N'Yeurt: "Je nachdem, ob die Inseln hoch sind oder niedrige Atolle, ist die Bedrohung unterschiedlich. Für ein Atoll sind es die Überschwemmungen und die Versalzung. Für Orte wie Fidschi vor allem Küstenerosion, Zyklone, heftige Regenfälle",
ergänzt Antoine de Ramon N'Yeurt, Klimaexperte der Südpazifik-Universität in Fidschis Hauptstadt Suva. Das erwärmte Meer sei wie eine Wiege für Zyklone, die in den letzten Jahren immer heftiger auftreten.
"Normalerweise entstehen die Zyklone nahe dem Äquator und folgen dann einer Spur warmen Wassers, daraus speisen sie sich. Die Energie entsteht aus dem Wärmeunterschied zwischen Luft und Meer. Die Atmosphäre reagiert also auf die Bedingungen im Ozean."
Wulf Killmann: "Zyklon ist das, was woanders Taifun oder Hurrikan heißt, bei uns heißt es Wirbelsturm. In der Vergangenheit hatte man alle zehn Jahre einen extremen Zyklon. Extrem heißt Kategorie 4, 5. Hier haben wir in den letzten vier Jahren drei gehabt, eine Häufung. Erst der Zyklon Even 2013/2014, der Samoa verwüstet hat, Kategorie 4. Dann Pam 2015, Vanuatu, und dann letztes Jahr Winston, Kategorie 5, Fidschi. Das sind so wesentliche Auswirkungen des Klimawandels. Und die haben natürlich Auswirkungen auf Wassersicherheit, Nahrungssicherheit.
Zyklon Winston, der im Februar vergangenen Jahres auf den Fidschi-Inseln wütete, war die schwerste Sturmkatastrophe in der Geschichte des Landes. 44 Menschen verloren ihr Leben. Mehr als 40.000 Gebäude wurden zerstört oder beschädigt. Nukubalavu war eines der am stärksten betroffenen Dörfer. Die 54-jährige Lusiana Racani lebt hier.
"Alles kam zur gleichen Zeit: Wellen, Regen, die Flut und der Wind. Es flogen Steine herum, die direkt vor meinen Augen drei Vögel trafen, die tot zu Boden fielen. Ich danke Gott, dass niemand von uns sein Leben verloren hat, und auch ich überlebt habe. Das ganze Dorf war überflutet, die Wellen haben alles überspült. Ich habe eine derartige Katastrophe noch nie zuvor erlebt."
Auch knapp zwei Jahre nach Zyklon Winston halten die Reparaturen an Häusern noch an. Einige Dorfbewohner leben immer noch in Zelten. Eigentlich hätte auch Nukubalavu längst umgesiedelt werden sollen, denn auch ohne Zyklone ist das Dorf ständigen Überflutungen ausgesetzt.
"Ich denke, es war so ein Monat nach Winston, als der Premierminister kam und uns sagte: Ihr müsst einen Ort finden, der höher gelegen ist, wo wir das Dorf hin verlegen können. Wir sagten ihm: Wir wollen das, wir wollen das. Sie kamen, um den Ort zu inspizieren, doch wir warten immer noch darauf, dass irgendetwas passiert."
Hilfsprojekte für Anpassung an Klimawandel
Neben Wirbelstürmen und dem Anstieg des Meeresspiegels machen den Fidschianern noch andere Auswirkungen des Klimawandels zu schaffen: Extreme Regenfälle oder extreme Hitze, Verschiebung der Fruchtzyklen, Versalzung der Böden, Absterben der Korallen. Wie Fidschi sind auch andere Entwicklungsländer sehr verwundbar gegenüber diesen Phänomenen.
Sabine Minninger: "Einen Zyklon kann man in Deutschland vielleicht noch aushalten, aber ein Zyklon in Bangladesch hat immer mit großen humanitären Katastrophen zu tun."
Bringt es Sabine Minninger auf den Punkt - Referentin für Internationale Klimapolitik bei "Brot für die Welt". Diese Auswirkungen haben die Industrienationen lange Zeit nicht wahrgenommen.
"Die Klimaverhandlungen gibt es jetzt seit 23 Jahren, und am Anfang war das eher so die Spielwiese für Umweltorganisationen. Klimawandel wurde ganz stark mit Umweltfragen in Verbindung gebracht. Und vor etwa zehn Jahren hat man erkannt, dass der Klimawandel so weit fortgeschritten ist, dass die Entwicklungszusammenarbeit davon betroffen ist. Der Auftrag von Brot für die Welt ist, Hunger zu bekämpfen. Der Klimawandel aber hat unsere Arbeit sabotiert, untergraben und eher noch Hunger und Armut verschärft."
Es laufen zahlreiche internationale Hilfsprojekte in Entwicklungsländern, um sich an den Klimawandel anzupassen. Sabine Minninger nennt Beispiele aus der Landwirtschaft:
"Hier hat man in Indonesien versucht, schwimmende Beete in der Projektarbeit umzusetzen. D.h., wenn Überschwemmungen kommen, war meistens der Acker dann geflutet, die Ernte war damit weg. Jetzt hat man Beete, die auf Gestrüpp wachsen und mit einer Sturmflut steigen die Beete einfach mit dem Wasser hoch und sinken dann auch wieder ab. Eine andere Form der Anpassung an die Landwirtschaft hat man z.B. in Äthiopien gemacht gegen das Vertrocknen von Äckern, die man dann eben abdeckt. Oder in Bangladesch, indem man eben Deiche gebaut hat, um die Fluten fernzuhalten von der Ackerfläche."
Auf den pazifischen Inseln dagegen hat man keine guten Erfahrungen mit Deichen oder Strandmauern gemacht, erläutert der fidschianische Klimaexperte Antoine de Ramon N'Yeurt.
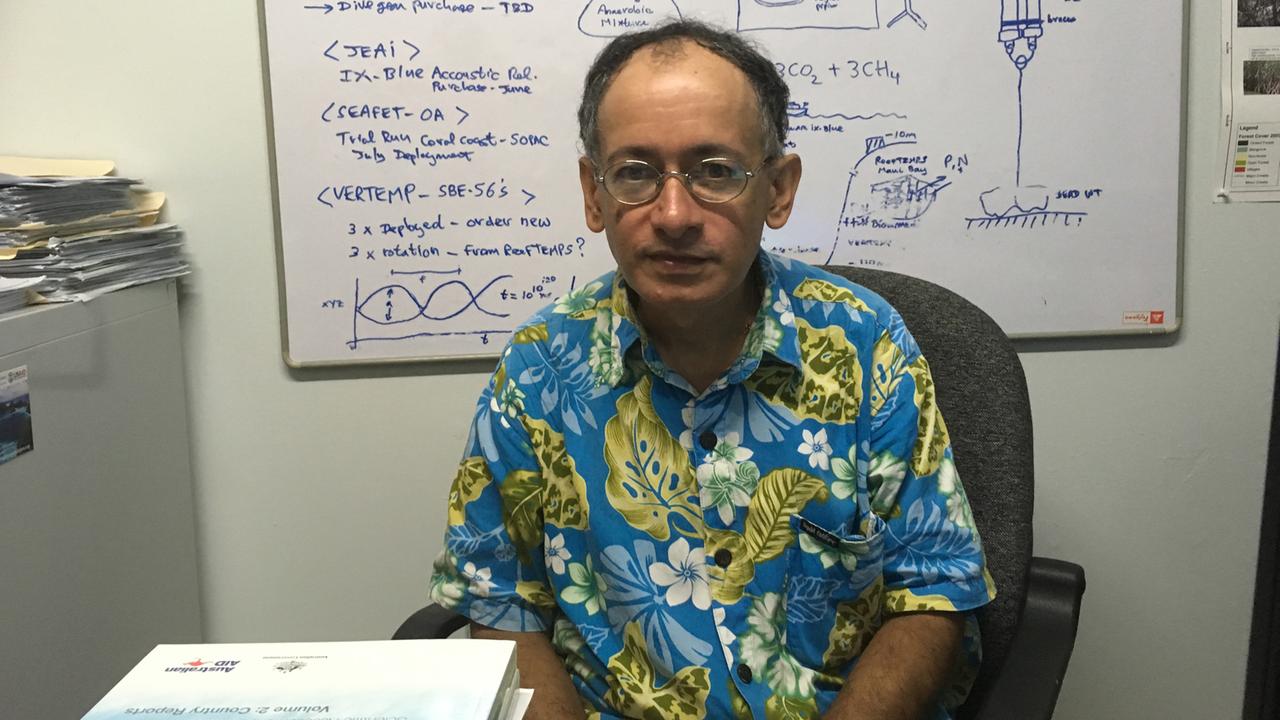
Der fidschianische Klimawissenschaftler Antoine de Ramon N'Yeurt© Tini von Poser
"Mauern an der Küste sind nicht so üblich, weil sie die Wellen eher zurückwerfen, als ihre Energie aufzunehmen. Daher eignen sich eher weiche Materialien, die die Energie der Wellen absorbieren können. Wenn die Mauer die Wucht der Wellen zurück wirft, können sie Deinem Nachbarn zum Verhängnis werden, und sein Land mehr überschwemmen."
Migration vom Land in den Slum vermeiden
Wulf Killmann: "Das Beste gegen die Küstenerosion ist, dass sie die Mangroven rehabilitieren, da wo eben Mangroven wachsen und wo es auch früher schon Mangroven gab. Und daran arbeiten wir auch. Die Mangroven haben eine vielfältige Funktion. Sie schützen die Küste, sind Windfang und auch ein Wellenfang. Und sie sind auch die Kinderstube für marine Organismen. Für Muscheln und Krebse und Fische. Und dann sind sie natürlich eine Kohlenstoffsenke."
Anbau von Mangroven, Umstellen auf anderes Saatgut, Errichten zyklonfester Häuser - doch die Anpassung hat Grenzen. Schon längst wurde ein neues Kapitel in der Geschichte des Klimawandels aufgeschlagen: das Kapitel der klimabedingten Migration, das Kapitel der Umsiedlungen. Dieses Kapitel hat genauso schleichend begonnen wie der Klimawandel selbst.
"Diese ganze Frage der Umsiedlung - wir sind ja erst am Anfang dieses Prozesses. Das ist ein Thema, was sich immer weiter und stärker entwickelt, und eines der Themen für die Länder mit größerer Landmasse in der Region in der Zukunft werden wird."
Zurück am früheren Standort von Vunidogoloa späht Sailosi Ramatu auf den Ozean hinaus. Der Himmel ist wolkenverhangen. Am Horizont erheben sich bergige Inseln. Meer, Berge, Himmel verschmelzen zu einer Einheit in verschiedenen Blautönen. Das Meer – eine Naturgewalt mit zwei Gesichtern: Freund und Feind. Nahrungsquelle und Bedrohung. Die Umsiedlung war teuer, sagt der Dorfoberste, aber:
Sailosi Ramatu: "Wenn wir hier länger geblieben wären, hätten wir am Ende sogar mehr Geld ausgeben müssen: immer wieder Häuser reparieren, neue Schutzwälle errichten."
Sabine Minninger: "Die Dorfbewohner von Vunidogoloa waren so unter Not umzuziehen, dass sie es auch in Kauf genommen haben, erstmal selbst das Geld aufzubringen. Das haben sie gemacht, indem sie ihre Waldbestände vermietet haben an die Regierung. Damit haben sie zwei Drittel der Kosten bestritten, das andere Drittel hat die Regierung übernommen."
Sailosi Ramatu: "Ich denke es ist nicht fair, dass wir irgendetwas zahlen mussten, wenn es doch der Klimawandel war, der uns dazu zwang, unsere Heimat zu verlassen. Doch wie kann man über dieses unaussprechbare Ding, diesen Klimawandel reden. Wir haben keine Chance, mit irgendjemanden zu verhandeln. Das einzige, was uns übrig blieb, war wegzurennen, unsere Heimat zurückzulassen, um nicht zu sterben."
Und dabei geht es um viel mehr, als den Menschen, die umziehen müssen, nur das Geld zur Verfügung zu stellen, sagt Sophia Wirsching, Migrationsexpertin von Brot für die Welt:
"Schlecht ist es, wenn die Migrationsprozesse nicht begleitet werden und wenn die Leute dann vom Land in den Slum migrieren und dort genauso anfällig sind für Umweltereignisse oder noch schlimmer exponiert sind als vorher. Man kann Migration so gestalten, dass es eine Anpassungsmaßnahme ist, aber man muss aufpassen, dass sie nicht zynisch wird und jede Migration im Kontext von Klimawandel als Anpassung beschreibt. Oft gibt es keine andere Möglichkeit, dann ist es keine Anpassung. Und eine Überlebensstrategie als Anpassung zu bezeichnen, kann man wahrscheinlich machen, wenn man von Tieren spricht, aber wenn du den Menschen und seine Würde und auch die Selbstbestimmung noch mit einbeziehst, dann ist es schwierig."
Umsiedlungen haben viel Konfliktpotential
In der Vergangenheit gab es bereits Versuche, Menschen umzusiedeln, die schief gelaufen sind. Wie zum Beispiel in Papua-Neuguinea. Bewohner der vom Untergang bedrohten Carteret-Inseln wurden auf die höhere Insel Bougainville umgesiedelt.
Wulf Killmann: "Natürlich ist es so: Land gehört jemanden. Es gibt kein freies Land, und Land ohnehin im Pazifik ist ein ganz wichtiger Asset. Und da gab es natürlich sofort erhebliche Konflikte zwischen den Alteingesessenen und den Umgesiedelten. Viele der Umgesiedelten sind dann zurückgegangen."
Zurzeit berät Wulf Killmann die Bewohner eines Dorfes auf der Fidschi-Insel Kandavo im Südosten der Inselgruppe bei ihrer Umsiedlung.
"Sie müssen ja sicher sein, wenn Sie die Leute umsiedeln, dass das Land verfügbar ist, und die Leute, denen das Land gehört, sie da auch darauf lassen."
Hinzu kommen psychologische und soziokulturelle Aspekte: Selten tun sich Menschen leicht, ihre Heimat zu verlassen. Und im Pazifik ist die Verwurzelung mit dem Boden besonders stark.
Sophia Wirsching: "Im Pazifik liegt es mit daran, dass es keine andere Möglichkeit gibt, seiner Vergangenheit zu erinnern und Geschichte ist ganz stark mit dem Boden verwurzelt. Identität ist sehr stark über den Boden verwurzelt, da sind die Ahnen drin, da sind die Geister drin. Es gibt da ja keine Bücher, sondern den Boden, der die Geschichte erzählt und prägt, wer du bist, deine Identität ausmacht. Und das ist etwas, was man nicht mitnehmen kann, wenn man migriert, zumal es auch noch dauerhaft verschwindet. Ich glaube aber, dass es das auch in anderen Weltregionen gibt, gerade da, wo jetzt nicht diese Form von Globalisierung zugeschlagen hat, die uns jetzt so prägt."
Sabine Minninger: "Man muss natürlich auch vermeiden, dass die Leute so frustriert sind, dass sich das in Alkoholismus und häuslicher Gewalt dann niederschlägt. Von daher ist dieser Beratungsprozess ein sehr, sehr wichtiger und in Vunidogoloa konnte man sehr gut ablesen, dass es sehr gut gelungen ist."
Zwei Kilometer weiter den Berg hoch, im Landesinneren, steht nun das neue Vunidogoloa. Die miteinander identischen, mint-grün gestrichenen Holzhäuschen verteilen sich über einen Hügel. Das neue Dorf ist eingebettet in eine üppige Vegetation. Kokosnusspalmen, Gemüsegärten, Ananasfelder.

Das neue Dorf Vunidogoloa© Tini von Poser
Sailosi Ramatu: "Vorher, als wir noch im alten Dorf lebten, sind wir schon hierher gekommen, um Knollenfrüchte zu ernten, und so für unsere tägliche Nahrungssicherheit zu sorgen. Wir betrieben hier also schon Landwirtschaft."
Die neuen Häuser in Vunidogoloa hatten keine Küche
Der Boden im alten Dorf war so sehr versalzen und versandet, dass dort nichts mehr wuchs, erklärt Ramatu. Dafür müssten sie jetzt auf den täglich frischen Fisch verzichten, wendet die Dorfbewohnerin Sera Naidrua ein, eine zierliche 70-Jährige mit grün gemustertem Kleid und zahnlosem Mund.
Sera Naidrua: "Im alten Dorf hatten wir guten Zugang zur Nahrung, wir gingen fischen. Seitdem wir hierher gezogen sind, ist der Weg weit zum Fischen, es ist ein größerer Aufwand. Dafür war es vom alten Dorf aus schwieriger, in die Stadt zu gelangen, weil wir von dort lange zur Hauptstraße laufen mussten, wo der Bus fährt."
Das neue Dorf dagegen ist direkt angebunden an die Straße, die bis in die nächstgrößere Stadt Savusavu führt. Die Bewohner erreichen nun also schneller die Geschäfte, den Markt, das Krankenhaus.
"Es gibt immer noch Dinge, die hier geregelt werden müssen. Als wir umgesiedelt wurden, hatte die Regierung schon die Häuser gebaut. Doch als wir da einzogen, fehlten noch die Küchen. Eigentlich hatten sie uns versprochen, dass alles fertig sein würde. Doch alle Häuser in Vunidogoloa hatten keine Küchen. Die Frauen mussten ihre Männer bitten, die Häuser größer zu machen, um eine Feuerstelle einzurichten, damit wir für unsere Familien kochen konnten."
Unterm Strich überwiegen die Vorteile des neuen Standorts von Vunidogoloa, sagt Sera Naidrua. Aber:
"Es war ein harter Prozess, weil die meisten von uns in dem alten Dorf geboren und aufgewachsen sind. Die Verbindung zum Land und die Umgebung - da waren so viele Erinnerungen dran geknüpft, die wir zurücklassen mussten. Umsiedeln war hart, aber vernünftig wegen der Auswirkungen des Klimawandels. Aber wir fühlen immer noch den Schmerz darüber, das Land aufgegeben zu haben."
Keiner wollte das Dorf verlassen
Sera Naidrua sieht, wie viele Dorfbewohner, den Klimawandel als eine Strafe Gottes an.

Dorfbewohnerin Sera Naidrua© Tini von Poser
Der Umzug von Vunidogoloa erfolgte nach langer Vorbereitung 2014. Es sei eine harte Aufgabe gewesen, die Menschen hier über den Klimawandel aufzuklären, sagt der Provinzbeamte Sekaia Melani:
"Keiner wollte das Dorf verlassen. Es hat lange gedauert, sie zu überzeugen, mehr als ein Jahr. Wir mussten sehr klug vorgehen, wir haben ihnen erklärt: Da ist dieser Klimawandel, der nicht aufzuhalten ist. Und wir malten ihnen aus, wie bedrohlich der Ozean erst in zehn Jahren sein wird. Ihr müsst nur zustimmen, und wir werden alles in die Wege leiten. Ich war auch am Sonntag vor ihrem Umzug im letzten Gottesdienst im alten Dorf. Es war wie eine Beerdigung, alle weinten. Am Montag danach haben wir den Umzug gemacht. Es war alles andere als leicht."
Sophia Wirsching: Wenn man auf den Jahresdurchschnitt schaut, dann ist es so, dass jedes Jahr 25,3 Millionen Menschen aufgrund von extremen Umweltereignissen ihre Heimat verlieren. Letztes Jahr 26 Millionen. Das gibt das Internal Displacement Monitoring Centre, die geben immer sehr präzise Daten raus. Das ist gar kein Zukunftsszenario mehr, sondern schon heute Fakt."
Migrationsbewegungen finden zum großen Teil regional statt, erklärt Migrationsexpertin Sophia Wirsching. Doch es sei davon auszugehen, dass auch transkontinentale Migration zunimmt im Zuge des fortschreitenden Klimawandels.
"Weil es z.B. Regionen wie Bangladesch besonders stark trifft, also der Klimawandel und Meeresspiegelanstieg, die z.B. fast ganz von Indien an der Landesgrenze umschlossen sind. Und wenn du einen Rückgang der Fläche von mindestens einem Fünftel bis 2050 hast, aber das Land ohnehin schon sehr stark bevölkert ist, dann bleibt gar keine andere Möglichkeit als die internationale Migration, und die ist dann halt nach Indien. D.h. diese Form von Migration wird mit Sicherheit auch zunehmen."
Begriff "Klimaflüchtling" negativ besetzt
Auch für die südpazifischen Inselstaaten Kiribati und Tuvalu sagen Klimaexperten eine düstere Zukunft voraus: Bevor diese niedrigen Atolle physisch untergehen, werden sie zunehmend vom Meer überspült werden und ihr Boden versalzen. Schon jetzt sind Landwirtschaft und Trinkwasserversorgung auf diesen Inseln stark eingeschränkt. Trotzdem wollen die Bewohner ihre Heimat nicht verlassen. Die Vorgängerregierung Kiribatis hat auf Fidschi Land aufgekauft, um zumindest im Ernstfall die Option zu haben, die Bewohner dorthin umzusiedeln. Doch in Tuvalu, so die Erfahrung der Klimareferentin Sabine Minniger, wollen die Bewohner lieber mit ihrer Insel untergehen, als irgendwo anders als Menschen zweiter Klasse zu leben.
"Alle Akteure von Regierung, Zivilgesellschaft, Kirche, die ich gesprochen habe, die lehnen selbst die Migration in Würde ab. Die bestehen immer noch darauf, dass die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad gehalten werden muss, weil sie ihre Inselatolle nicht verlassen wollen, und sie gehen auch davon aus, dass es selbst eine Migration in Würde gar nicht geben kann, verbunden mit all den Verlusten, ökonomische, wie nicht-ökonomische, und im Leid, das damit verbunden ist für die Bevölkerung."
Der Begriff "Klimaflüchtling" gilt im Pazifik als negativ besetzt, vor allem seit der Flüchtlingskrise in Europa. Vunidogoloas Oberhaupt Sailosi Ramatu runzelt die Stirn.
"Ich mag den Begriff nicht. Wenn man über Flüchtlinge redet, klingt es nach Streitereien, wegen denen man von zu Hause weglaufen muss."
Sophia Wirsching: "Es gibt Menschen, die sagen, ich bin ein Klimaflüchtling, das habe ich in Westafrika schon erlebt, weil sie Unterstützung erwarten, weil sie einen Schutzanspruch stellen wollen. Es gibt andere, das ist im Pazifik sehr häufig, die den Begriff total ablehnen, weil es eine Stigmatisierung und eine Viktimisierung ist und weil es den Würdecharakter nimmt."
Wulf Killmann: "Der Begriff 'Klimaflüchtling', ich glaube nicht, dass man den schon anwenden kann. Es gab zwei oder drei Fälle von Leuten, ich glaube, in Neuseeland, die um Asyl gebeten haben wegen Klimafragen, und die wurden abgelehnt. Langfristig, wenn sich die Sache so weiter entwickelt, wird es zu einem Thema werden, ohne Zweifel. Es gibt ja eine Flüchtlingskonvention. Die Flüchtlingskonvention sieht aber andere Gründe vor. Verfolgung wegen Rasse oder Religion. Aber die Sache des Klimas ist bisher in die ganze Flüchtlingsdebatte nicht reingekommen."
Sabine Minninger: "Wir brauchen dafür einen tiefen gesellschaftlichen Diskurs, wir brauchen Verhandlungen auf internationaler Ebene, wir brauchen die Bereitstellung von Mitteln, um Klimaflucht zu vermeiden. Und entweder wenn es noch geht, die Anpassung an den Klimawandel, oder wenn es nicht mehr geht, eine geordnete Migration."
Für Fidschis Küstenbewohner, die Staaten Tuvalu oder Kiribati ist es wohl schon zu spät. Doch an vielen Orten der Welt könne man durch Maßnahmen der Anpassung noch Migrationen vermeiden, sagt Sophia Wirsching.
"Aber momentan ist es nicht so, dass die Staatengemeinschaft den entsprechenden Willen dafür zeigen würde. Also weder den Willen noch die finanziellen Mittel dafür aufbringt. Weil wir gerade sehr Krisen gerüttelt sind: Wir haben die Hungersnöte in Afrika; ich glaube, neun intensive Konflikte mit extremen Todeszahlen und sehr vielen Verwicklungen von Staatenkonflikten oder Stellvertreter-Kriege. Es ist nicht so, dass diese Krisen das System nicht genug belasten würden. Und allein dafür kriegst du ja nicht genug Geld zusammen. Und die Bereitschaft, jetzt auch noch präventiv zu denken und dafür Ressourcen zu mobilisieren, ist tatsächlich gering. Und das ist tragisch."
Darüber hinaus sei der Klimawandel für die Europäer noch zu wenig greifbar, weshalb sie das Problem nicht wirklich ernst nähmen, vermutet der fidschianische Klimaexperte Antoine de Ramon N'Yeurt. Auf dem Universitätsgelände in Suva regnet es gerade in Strömen, obwohl in Fidschi eigentlich zu dieser Zeit die trockene Jahreszeit herrscht.
Antoine de Ramon N'Yeurt: "Die Auswirkungen des Klimawandels sind hier viel sichtbarer, denn wir leben auf Inseln, haben mit dem steigenden Meeresspiegel zu tun, den Zyklonen und anderen Dingen. In Europa dagegen kann der Klimawandel sogar von Vorteil sein. Denn wenn es wärmer wird an einigen Orten, können Feldfrüchte gedeihen, die vorher nicht gewachsen sind. Zwar beginnen auch die Menschen in der nördlichen Hemisphäre die Auswirkungen zu spüren, denn auch dort treten diese Superstürme auf, wie etwa in den USA. Doch die meisten Menschen, die in Deutschland oder Frankreich leben, sie sehen den Klimawandel nicht wirklich, er berührt nicht ihr tägliches Leben, jedenfalls nicht direkt. Sie haben immer noch ihr Essen auf dem Teller und tun die Dinge, die sie sonst tun."
Die Autorin Tini von Poser wurde bei Ihrer Recherche vom evangelischen Entwicklungsdienst "Brot für die Welt" und Tourism Fiji (Urban Adventures) unterstützt.






