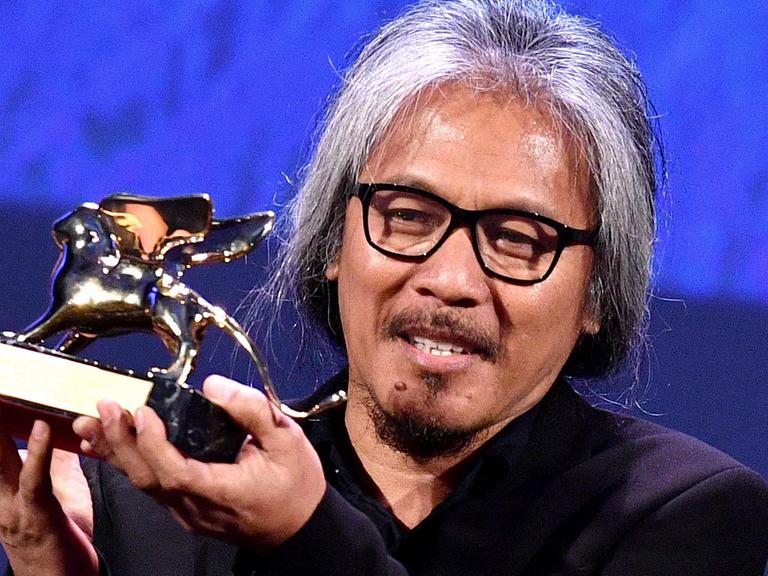Auffällig viele Männer in der Identitätskrise

Beim Filmfestival Toronto dominieren Filme mit Männern, die aus den verschiedensten Gründen ihre Gefühle unterdrücken. Unter all den Filmen über kaputte Protagonisten sticht einer besonders hervor.
Der richtig große Oscarbuzz ist bisher ausgeblieben. Kein "12 Years A Slave", kein "The Kings Speech", kein "Slumdog Millioniare" oder "The Imitation Game". Kein Film, der ausnahmslos Talk of the Town ist. Es scheint fast so, als sei das Festival in einer kleinen Krise – die Rolltreppe, die jeden Tag Tausende von Cineasten in das größte Kino der Stadt bringt war die ersten drei Festivaltage kaputt. Laufen war angesagt, Treppen steigen.
Es ist eine Notlage, die sich auch auf der Leinwand zeigt. Testosterongeschwängert. Es gibt auffällig viele Männer in einer Identitätskrise, die sich hier präsentieren. Männer, die aus den verschiedensten Gründen ihre Gefühle unterdrücken. Da ist Bryan Cranston in "Wakefield", der als gelangweilter Bilderbuch-Ehemann aus der Vorstadt eines Abends einfach nicht ins Haus geht, zu Frau und Töchtern, sondern sich in der Garage versteckt und ein Jahr lang dort wohnen bleibt, zum Beobachter des eigenen Familienalltags wird.
Cranston verwahrlost, wird zum Penner im eigenen Vorgarten. In einem inneren Monolog mit Rückblenden und Tagträumen sehnt er den heilen, glücklichen Familienalltag herbei. Dabei hätte einfach mal drüber reden helfen können.
"If you can take one guy to an Island with you and you knew you would be safe, because he was the best man. If it was between you and my father, who would you take. My Daddy. I think you are wrong about that."
Unterdrückte Gefühle
Kein Mann der großen Worte ist Casey Affleck als Lee Chandler in dem Familiendrama "Manchester by the Sea". Nach dem Tod seines Bruders soll er sich um seinen pubertierenden Neffen kümmern, doch hat er alles andere im Sinn, als sich um einen 16-jährigen Waisen zu kümmern.
"I dont understand. Which part do you not understand? I can't be his guardian. Your brother provided for your nephew."
Affleck spielt wortkarg einen Mann, der seine Gefühle nicht nur versteckt, sondern unterdrückt, nicht darüber spricht. Über seine Trauer, seine Schuld, seine Vergangenheit. Der auf die Gegenwart genauso wenig Lust hat wie auf die Zukunft, der gefangen in seiner eigenen, unausgesprochenen Gefühlswelt lebt.
Er presst seine Sätze heraus, als würde jedes einzelne Wort wehtun wie ein Nadelstich. Trotz all der Rauheit hat "Manchester by the Sea" eine berührende Zärtlichkeit.
"I am just a backup. Lee, nobody can appreciate what you’ve been through. And if you really feel you can't take this on, thats your right."
Auf der Suche nach seiner Identität
Probleme mit der Vergangenheit hat auch Saroo Brierly, gespielt von Dev Patel, in "Lion". Als Fünfjähriger fährt der indische Junge mit den Kulleraugen bei einem nächtlichen Ausflug versehentlich über 1600 Kilometer mit dem Zug durch sein Heimatland, irrt verlassen durch die Straßen Kalkuttas, landet in einem Waisenhaus und wird von einem australischen Paar adoptiert.
25 Jahre später ist eben jener junge Mann auf der Suche nach seiner Identität, seinen Wurzeln, sucht über Google Earth Anhaltspunkte über sein Heimatdorf.
"Films like this give you a good dose of perspective. It really does I get. Sarrou as a character, he is a young man who is experiencing so much. He has a lot of guilt to bear."
Filme wie dieser böten einen Perspektivwechsel, sagt Dev Patel im Interview. Saroo habe viel durchgemacht im Leben, müsse mit der Schuld klar kommen, dass sein Bruder und seine Mutter noch immer auf ihn warten, ihn suchen würden, während er einem Zufall geschuldet ein westliches Leben mit Grillabenden, Ausbildung und Freundin habe. Das sei das, was ihn quälen würde.
"He is plagued by the thought that his mother and his brother are scowering this traintracks looking for him, searching for him, whilest he is doing barbecues and his hotelmanaging course, dating this beautiful girl, that is really his struggle."
Ein perfides Schauspielerduell
Die Produzenten von "The Kings Speech" haben mit Regisseur Garth Davis, Nicole Kidman und eben Dev Patel einen herzzerreißend trauriges, geradliniges Feelgoodmovie gemacht. "Una" hingegen, mit Rooney Mara und Ben Mendelsohn in den Hauptrollen, ist ein doppelbödiger, ein zweideutiger Film, der mit Erwartungshaltung und Vorurteilen spielt.
Mendelsohn und Mara liefern sich ein perfides Schauspielerduell. Er, ein Freund ihrer Eltern, soll sie mit 13 Jahren missbraucht haben, wurde verurteilt. Sie konfrontiert ihn in der Gegenwart erneut damit, verlangt eine Entschuldigung. Regisseur Benedict Andrews verwebt die beiden Ansichten und spielt die Figuren gegeneinander aus. Wer ist Opfer, wer ist Täter? Es ist ein ständiger Perspektivwechsel, der gerade ihn in eine Identitätskrise stürzt und sein neues Leben wie ein Kartenhaus einstürzen lässt.
Dabei ist der beste, der überraschendste, der einnehmendste Film "Moonlight" von Barry Jenkins. In drei Kapitel erzählt er die Geschichte von Chiron, einem schwarzen Jungen mit drogenabhängiger Mutter in den kriminellen Randgebieten von Miami. Kindheit, Jugend und die Zeit als Anfang Zwanzigjähriger sind hier die drei Stadien des Erwachsenwerdens.
Chiron wächst vaterlos auf, ein benachbarter Drogendealer ist sein einziges, männliches Vorbild. In der Schule wird er gemobbt, ihm wird unterstellt schwul zu sein. Noch ehe er sich selbst klar ist über seine eigene Sexualität wird er genau deswegen verprügelt. Beiläufig, poetisch verhandelt "Moonlight" Homosexualität im afroamerikanischen Milieu.
Es ist ein schmerzhaftes, ganz kraftvolles, melancholisches Coming-Of-Age-Drama über einen Jungen auf der Suche nach seiner eigenen Identität. Unter all den kaputten Männern hier auf dem Festival ist sein Schicksal das Emotionalste. Weil er die Krise meistert. Und gestärkt aus ihr hervorgeht. Im Kino nicht immer eine Selbstverständlichkeit.