Flicks Millionengeschäfte
Rezensiert von Andreas Möller · 20.01.2008
Der Flick-Konzern gehörte zu den großen Gewinnern des Zweiten Weltkriegs, kurbelten die Nationalsozialisten doch die Geschäfte des Stahl- und Rüstungsunternehmens an. Zwangsenteignungen von Konkurrenten und der Einsatz von Zwangsarbeitern kamen dem Unternehmen ebenfalls zupass. Der Historiker Christian Priemel untersucht in dem Buch "Flick" die Geschichte des Konzerns von seiner Gründung bis in die heutige Zeit.
Im September 2004 wurde in Berlin die "Flick Collection" eröffnet. Sie gilt als eine der bedeutendsten Sammlungen zeitgenössischer Kunst.
Bereits die Ankündigung, die Sammlung im Museum "Hamburger Bahnhof" zeigen zu wollen, hatte zu einer öffentlichen Kontroverse geführt. Der Streit drehte sich um die Herkunft jener Millionen, mit denen Friedrich Christian Flick seine Kunst erworben hatte. Stammten diese doch aus dem Erbe seines Großvaters, dessen Name bis heute nicht nur mit Rüstungswirtschaft und Zwangsarbeit während des "Dritten Reiches" verbunden ist, sondern mit dem Parteispenden-Skandal des Jahres 1985.
Der wohl prominenteste Redner an jenem Dienstagabend war der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sich durch seine Teilnahme demonstrativ hinter Flick stellte.
Nun liegt wenige Jahre nach der Ausstellungseröffnung eine voluminöse Untersuchung der Konzerngeschichte Flicks vor. Verfasst wurde sie vom jungen Historiker Kim Christian Priemel. Und obwohl man dem Buch seinen Charakter als wissenschaftliche Qualifizierungsarbeit anmerkt, leistet Priemel darin Außerordentliches.
Gestützt auf einen immensen Quellen-Fundus kann er nachweisen, wie Flick durch unternehmerisches Geschick auch im Umgang mit den politisch Mächtigen zum erfolgreichsten deutschen Industriellen des zwanzigsten Jahrhunderts aufsteigen konnte.
Gerade darin, im fast buchhalterisch geführten Nachweis der Verzahnung unternehmerischer und politischer Entscheidungen, liegt die Leistung des Buches. Denn es dokumentiert en détail, wie Flick die politischen Rahmenbedingungen bei seinen Expansionsplänen immer wieder zu nutzen verstand.
"Mehrfach waren es Folgen politischer Großereignisse, die dem Flick-Konzern entscheidende Expansionsmöglichkeiten eröffneten: 1920 als Folge des verlorenen Krieges in Oberschlesien, 1937 bis 1939 durch die aktive Beteiligung an der nationalsozialistischen ’Arisierungs’politik, die territoriale Expansion im Zweiten Weltkrieg oder die Übernahme entflochtener Chemie- und Stahlunternehmen in den fünfziger Jahren."
Nachdem sich Flick während des Ersten Weltkriegs einen Namen in der Stahlproduktion gemacht hatte, baute er seine Gewinne in den zwanziger Jahren vor allem durch Unternehmensbeteiligungen aus. Der entscheidende Schritt zur Etablierung seines Konzerns, der Friedrich Flick KG, gelang ihm durch die sogenannte "Gelsenberg-Affäre" im Jahr 1932, als er die Regierung Brüning zum Kauf eines seiner Werke bewegte. Bereits zu Beginn des Jahres 1933 hatte er keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass er sich auch mit den neuen Machthabern arrangieren würde. Er unterstrich dies mit einer großzügigen Spende für die NSDAP, die ihm politisch bislang eher suspekt gewesen war.
Diesen Pragmatismus beschreibt das Buch als ein zentrales Merkmal Flicks und anderer Wirtschaftsgrößen. Insofern überrascht es kaum, dass Flick auch bei der Übernahme ehemals jüdisch geführter Unternehmen wie den Lübecker Hochofenwerken oder den Gussstahlwerken Döbeln seine Finger im Spiel hatte.
"So gut der Verkauf von Eisen und Stahl, Waggons und Rüstungsgütern in den dreißiger Jahren auch lief - ohne die nationalsozialistische ’Arisierungs’politik wären diese Akquisitionen für die Friedrich Flick KG und ihre Tochterunternehmen kaum finanzierbar gewesen. Flick erkannte und nutzte die in der rassistischen Ausgrenzungspolitik liegende Chance, abseits marktwirtschaftlicher Determinanten von Wertermittlung und Konkurrenz zum Zuge zu kommen."
Zudem profitierte auch er von der Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs. So waren bei Flick mindestens 40.000 Zwangsarbeiter tätig. Der Autor verstärkt diese Zahl an einer Stelle, indem er schreibt, dass sie in keinem Unternehmen des Flick-Konzerns weniger als ein Drittel der Belegschaft ausmachten.
Zwangsarbeit gehörte vor dem Hintergrund der Massenziehungen an die Front in den meisten Fabriken zum Alltag. Im Hinblick auf die nachweislich mangelhafte Behandlung der Arbeiter mutet es jedoch umso frappierender an, dass sich Flick zeitlebens weigerte, Entschädigungszahlungen zu leisten. Man musste sie aus seiner Sicht als Schuldeingeständnis auffassen. Schließlich hatte man ihn 1947 in Nürnberg zwar vor Gericht gestellt, ihn 1950 jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Den letzten Teil von Priemels Buch macht deshalb Flicks sagenhaftes Comeback als Primus inter Paris der deutschen Nachkriegswirtschaft aus, das den Aufstieg während der zwanziger Jahre noch in den Schatten stellte. Dieses Kapitel trägt den bezeichnenden Titel: "Kein Wunder". Denn obwohl Flick einen Großteil seines Vermögens im Osten verloren hatte, gelang ihm erneut der Aufbau eines Firmenimperiums mit über 200.000 Mitarbeitern, zu dem später Unternehmen wie Daimler-Benz gehören sollten. Und so ironisch es klingen mag: Die Folgen von Krieg und Besatzung halfen Flick nach Meinung des Autors sogar, indem sie ihn zwangen, sein Geschäft radikal neu auszurichten.
"Es erscheint fraglich, ob die Konzernführung fast zehn Jahre vor der Bergbaukrise und mehr als zwei Jahrzehnte vor dem Strukturwandel in der Stahlindustrie aus eigenem Antrieb eine ähnlich umfassende und rapide Vermögensumschichtung in Wachstumsbranchen vorgenommen hätte, wie sie die alliierten Zwangsmaßnahmen 1945 bis 1952 nach sich zogen."
Das Fazit: Das Buch von Kim Christian Priemel ist keine Biografie im herkömmlichen Sinne. So erfährt der Leser keinerlei private Details über Friedrich Flick. Priemels Untersuchung ist vielmehr eine mit außerordentlicher Detailkenntnis verfasste Konzerngeschichte, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt.
Nach ihrer Lektüre erscheint die Allianz von Politik und Wirtschaft, wie sie in letzter Zeit auch für andere Unternehmerdynastien aufgearbeitet wurde, zwar nicht in einem neuen Licht. Nicht oft ist ihre Verbindung jedoch so faktenreich untersucht worden wie in diesem 800-Seiten-starken Buch. Es dürfte zum Standardwerk über die Geschichte des Flick-Konzerns werden.
Kim Christian Priemel: Flick.
Eine Konzerngeschichte vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik
Wallstein Verlag, Göttingen 2007
Bereits die Ankündigung, die Sammlung im Museum "Hamburger Bahnhof" zeigen zu wollen, hatte zu einer öffentlichen Kontroverse geführt. Der Streit drehte sich um die Herkunft jener Millionen, mit denen Friedrich Christian Flick seine Kunst erworben hatte. Stammten diese doch aus dem Erbe seines Großvaters, dessen Name bis heute nicht nur mit Rüstungswirtschaft und Zwangsarbeit während des "Dritten Reiches" verbunden ist, sondern mit dem Parteispenden-Skandal des Jahres 1985.
Der wohl prominenteste Redner an jenem Dienstagabend war der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sich durch seine Teilnahme demonstrativ hinter Flick stellte.
Nun liegt wenige Jahre nach der Ausstellungseröffnung eine voluminöse Untersuchung der Konzerngeschichte Flicks vor. Verfasst wurde sie vom jungen Historiker Kim Christian Priemel. Und obwohl man dem Buch seinen Charakter als wissenschaftliche Qualifizierungsarbeit anmerkt, leistet Priemel darin Außerordentliches.
Gestützt auf einen immensen Quellen-Fundus kann er nachweisen, wie Flick durch unternehmerisches Geschick auch im Umgang mit den politisch Mächtigen zum erfolgreichsten deutschen Industriellen des zwanzigsten Jahrhunderts aufsteigen konnte.
Gerade darin, im fast buchhalterisch geführten Nachweis der Verzahnung unternehmerischer und politischer Entscheidungen, liegt die Leistung des Buches. Denn es dokumentiert en détail, wie Flick die politischen Rahmenbedingungen bei seinen Expansionsplänen immer wieder zu nutzen verstand.
"Mehrfach waren es Folgen politischer Großereignisse, die dem Flick-Konzern entscheidende Expansionsmöglichkeiten eröffneten: 1920 als Folge des verlorenen Krieges in Oberschlesien, 1937 bis 1939 durch die aktive Beteiligung an der nationalsozialistischen ’Arisierungs’politik, die territoriale Expansion im Zweiten Weltkrieg oder die Übernahme entflochtener Chemie- und Stahlunternehmen in den fünfziger Jahren."
Nachdem sich Flick während des Ersten Weltkriegs einen Namen in der Stahlproduktion gemacht hatte, baute er seine Gewinne in den zwanziger Jahren vor allem durch Unternehmensbeteiligungen aus. Der entscheidende Schritt zur Etablierung seines Konzerns, der Friedrich Flick KG, gelang ihm durch die sogenannte "Gelsenberg-Affäre" im Jahr 1932, als er die Regierung Brüning zum Kauf eines seiner Werke bewegte. Bereits zu Beginn des Jahres 1933 hatte er keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass er sich auch mit den neuen Machthabern arrangieren würde. Er unterstrich dies mit einer großzügigen Spende für die NSDAP, die ihm politisch bislang eher suspekt gewesen war.
Diesen Pragmatismus beschreibt das Buch als ein zentrales Merkmal Flicks und anderer Wirtschaftsgrößen. Insofern überrascht es kaum, dass Flick auch bei der Übernahme ehemals jüdisch geführter Unternehmen wie den Lübecker Hochofenwerken oder den Gussstahlwerken Döbeln seine Finger im Spiel hatte.
"So gut der Verkauf von Eisen und Stahl, Waggons und Rüstungsgütern in den dreißiger Jahren auch lief - ohne die nationalsozialistische ’Arisierungs’politik wären diese Akquisitionen für die Friedrich Flick KG und ihre Tochterunternehmen kaum finanzierbar gewesen. Flick erkannte und nutzte die in der rassistischen Ausgrenzungspolitik liegende Chance, abseits marktwirtschaftlicher Determinanten von Wertermittlung und Konkurrenz zum Zuge zu kommen."
Zudem profitierte auch er von der Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs. So waren bei Flick mindestens 40.000 Zwangsarbeiter tätig. Der Autor verstärkt diese Zahl an einer Stelle, indem er schreibt, dass sie in keinem Unternehmen des Flick-Konzerns weniger als ein Drittel der Belegschaft ausmachten.
Zwangsarbeit gehörte vor dem Hintergrund der Massenziehungen an die Front in den meisten Fabriken zum Alltag. Im Hinblick auf die nachweislich mangelhafte Behandlung der Arbeiter mutet es jedoch umso frappierender an, dass sich Flick zeitlebens weigerte, Entschädigungszahlungen zu leisten. Man musste sie aus seiner Sicht als Schuldeingeständnis auffassen. Schließlich hatte man ihn 1947 in Nürnberg zwar vor Gericht gestellt, ihn 1950 jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Den letzten Teil von Priemels Buch macht deshalb Flicks sagenhaftes Comeback als Primus inter Paris der deutschen Nachkriegswirtschaft aus, das den Aufstieg während der zwanziger Jahre noch in den Schatten stellte. Dieses Kapitel trägt den bezeichnenden Titel: "Kein Wunder". Denn obwohl Flick einen Großteil seines Vermögens im Osten verloren hatte, gelang ihm erneut der Aufbau eines Firmenimperiums mit über 200.000 Mitarbeitern, zu dem später Unternehmen wie Daimler-Benz gehören sollten. Und so ironisch es klingen mag: Die Folgen von Krieg und Besatzung halfen Flick nach Meinung des Autors sogar, indem sie ihn zwangen, sein Geschäft radikal neu auszurichten.
"Es erscheint fraglich, ob die Konzernführung fast zehn Jahre vor der Bergbaukrise und mehr als zwei Jahrzehnte vor dem Strukturwandel in der Stahlindustrie aus eigenem Antrieb eine ähnlich umfassende und rapide Vermögensumschichtung in Wachstumsbranchen vorgenommen hätte, wie sie die alliierten Zwangsmaßnahmen 1945 bis 1952 nach sich zogen."
Das Fazit: Das Buch von Kim Christian Priemel ist keine Biografie im herkömmlichen Sinne. So erfährt der Leser keinerlei private Details über Friedrich Flick. Priemels Untersuchung ist vielmehr eine mit außerordentlicher Detailkenntnis verfasste Konzerngeschichte, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt.
Nach ihrer Lektüre erscheint die Allianz von Politik und Wirtschaft, wie sie in letzter Zeit auch für andere Unternehmerdynastien aufgearbeitet wurde, zwar nicht in einem neuen Licht. Nicht oft ist ihre Verbindung jedoch so faktenreich untersucht worden wie in diesem 800-Seiten-starken Buch. Es dürfte zum Standardwerk über die Geschichte des Flick-Konzerns werden.
Kim Christian Priemel: Flick.
Eine Konzerngeschichte vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik
Wallstein Verlag, Göttingen 2007
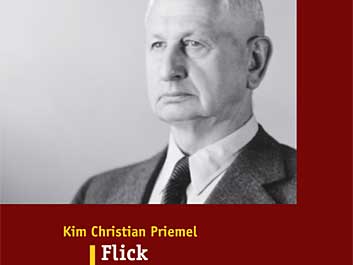
Kim Christian Priemel: Flick.© Wallstein Verlag
