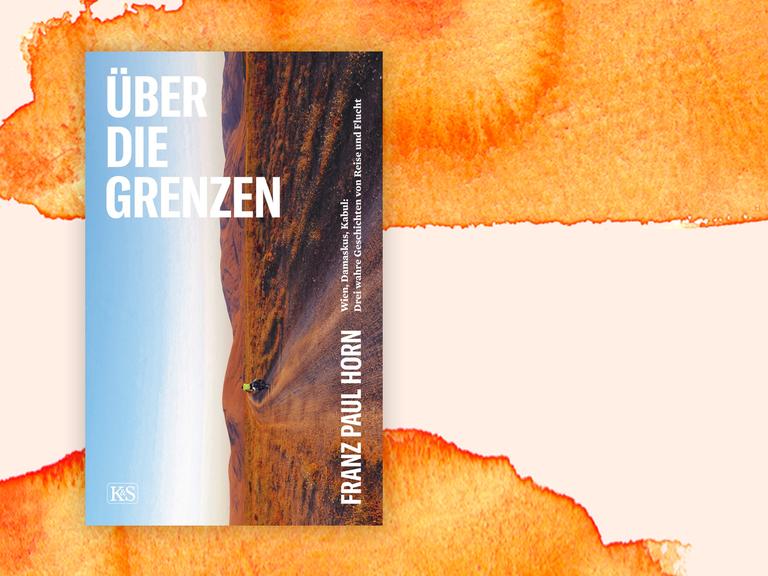Das Trauma Krieg
09:43 Minuten

In den USA nehmen sich im Durchschnitt 22 Veteranen pro Tag das Leben. Regisseur Florian Baron hat mit fünf Ex-Soldaten über ihre traumatischen Erlebnisse im Kriegseinsatz gesprochen und den Dokumentarfilm „Stress“ gedreht.
Susanne Burg: Sie heißen Joe, Torrie, Mike, James und Justin, wohnen in Pittsburgh und sie gehören zu den vielen Kriegsveteranen in den USA, die versuchen, wieder ein einigermaßen normales Leben zu führen. Nach Einsätzen in Afghanistan oder im Irak leiden sie unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Der Dokumentarfilm "Stress" lässt die fünf Veteranen erzählen, gibt Einblicke in ihre Kämpfe mit den Traumata:
"Ich lag im Krankenhaus und wünschte mir, dass meine Beine oder Arme oder mein Gesicht im Krieg zerbombt worden wären", sagt Joe. "Dann wüssten die Leute, dass ich Invalide bin, dass ich Schmerzen habe und für immer geprägt bin vom Krieg."
Burg: Ein Ausschnitt aus dem Film "Stress", der am Donnerstag bei uns ins Kino kommt. Der Regisseur des Films ist Florian Baron. Sie haben sich als deutscher Dokumentarfilmer um posttraumatische Belastungsstörungen bei amerikanischen Soldaten kümmert. Warum gerade die USA und warum Pittsburgh?
Baron: Ich habe eine Zeitlang in den USA gelebt, in Pittsburgh. Ich hatte so ein Stipendium nach dem Studium hier an der Filmhochschule und habe eher durch Zufall Leute in meinem Alter kennengelernt, die im Krieg waren nach dem 11. September, und war erst mal sehr überrascht davon, Leute meiner Generation zu finden. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie das ist für jemanden, der mit der gleichen Musik, mit den gleichen Filmen zur gleichen Zeit aufgewachsen ist wie ich und dann aber so eine Entscheidung getroffen und solche Erfahrungen gemacht hat – die aber jetzt auch da an der Uni sind und so ein normales Leben führen. Ich wollte einfach mehr darüber rausfinden, wie sich das anfühlt, nach so einer Erfahrung zurück in die heile Welt zu kommen.
Burg: Sie haben den Film in mehrere Kapitel unterteilt. Am Anfang erzählen die Veteranen davon, warum sie überhaupt in den Krieg gegangen sind. Das scheint als Motiv immer wiederzukehren, entweder waren ihre Eltern schon beim Militär – oder der wirtschaftliche, sozialökonomische Hintergrund?
Burg: Sie haben den Film in mehrere Kapitel unterteilt. Am Anfang erzählen die Veteranen davon, warum sie überhaupt in den Krieg gegangen sind. Das scheint als Motiv immer wiederzukehren, entweder waren ihre Eltern schon beim Militär – oder der wirtschaftliche, sozialökonomische Hintergrund?

Einst war Pittsburgh im Nordosten der USA eine Arbeiterstadt mit viel Stahl- und Kohleindustrie. © PARTISAN filmverleih
Baron: Das ist natürlich ein großer Anreiz in den USA, weil es so teuer ist, zu studieren an einer Uni. Wenn man sich beim Militär verpflichtet für einige Jahre, dann hat man danach die Möglichkeit, auf Kosten des Militärs zu studieren, was ein großer Anreiz ist für viele, die sich das sonst nicht leisten können oder die sich sonst hoch verschulden müssten.
Gerade in Pittsburgh spielt natürlich auch so eine gewisse Familienhistorie eine Rolle. Um Pittsburgh ist eine alte Arbeiterstadt, es gab viel Stahl-, Kohleindustrie und so ein Selbstverständnis von Arbeiterklasse. Dazu gehört auch, dass in ganz vielen Familien der Großvater im Zweiten Weltkrieg war, der Vater in Vietnam oder im ersten Golfkrieg, und dass das für viele junge Menschen dann wie so eine logische Schlussfolgerung war, jetzt bin ich an der Reihe.
Erst der Ton, dann das Bild
Burg: Gerade am Anfang, wenn die fünf Protagonisten sich vorstellen, zeigen Sie die Veteranen nur von hinten. Es dauert rund 20 Minuten, bis wir überhaupt ein Gesicht sehen. Warum diese Annäherung?
Baron: Tatsächlich habe ich angefangen, für den Film zu recherchieren und habe Audiointerviews gemacht, also die nur im Ton aufgenommen. Ich habe auch viel gehört und recherchiert zu Podcasts, oder es gibt auch so Oral-History-Archive, wo Veteranen diese Geschichten erzählen. Ich wollte eigentlich einen Film machen, der ein bisschen diese Atmosphäre oder diese Qualität erhält, dass man einer Person erst mal nur zuhört und nicht gleich ein Bild von der Person sieht, sondern sich das erst mal machen muss. Weil vieles von dem, was sie erzählen, sind vielleicht Sachen, die dem Zuschauer oder die mir erst mal sehr fremd sind oder vielleicht auch abstoßend sind auf eine Art Weise – also wenn die davon erzählen, was sie da im Krieg alles machen mussten.
Ich dachte, wenn ich die erst mal nicht sehe, sondern erst mal denen nur zuhöre, dann muss ich deren Geschichte einmal durch mich durchgehen lassen, bevor ich mir da ein Bild machen kann. In vielen anderen Filmen zu dem Thema habe ich das bei mir selber beobachtet, dass wenn ich da jemanden im Interview am Tisch sitzen sehe und der erzählt mir was… diese visuelle Ebene sorgt bei mir oft dafür, dass ich mich dann eher distanziere oder sagen kann, na ja, das ist halt so ein Amerikaner, das hat eigentlich mit mir nichts zu tun, und schon ist man irgendwie distanzierter. Ich wollte eigentlich so eine Qualität, auch von Radio oder von Podcasts in dem Film behalten, aber natürlich einen Film machen, der auch visuell anspruchsvoll ist.
Burg: Auch im Verlauf des Films ist sehr interessant, wie Sie da mit den visuellen Elementen spielen. Diese Bild-Text-Ebene ist total spannend. Die Soldaten erzählen zum Beispiel von Bomben in den Kriegen – in einem Kapitel erzählen sie von ihren Kriegserfahrungen, und Sie zeigen derweil Feuerwerk. Ich nehme an, das ist vom Nationalfeiertag, vom 4. Juli? Sie verzichten also auf Kriegsbilder. Auch genau aus dem besagten Grund, um nicht Bilder, die wir sowieso schon im Kopf haben, diese Erwartungen zu füttern?
Burg: Auch im Verlauf des Films ist sehr interessant, wie Sie da mit den visuellen Elementen spielen. Diese Bild-Text-Ebene ist total spannend. Die Soldaten erzählen zum Beispiel von Bomben in den Kriegen – in einem Kapitel erzählen sie von ihren Kriegserfahrungen, und Sie zeigen derweil Feuerwerk. Ich nehme an, das ist vom Nationalfeiertag, vom 4. Juli? Sie verzichten also auf Kriegsbilder. Auch genau aus dem besagten Grund, um nicht Bilder, die wir sowieso schon im Kopf haben, diese Erwartungen zu füttern?

Scheinbar heile Welt: Szene aus dem Film "Stress".© PARTISAN filmverleih
Baron: Genau. Gegenstand des Films ist ja dieses Zurück-nach-Hause-kommen nach dem Krieg. Die Herausforderung, die die Veteranen haben mit ihrem Trauma, ist im Alltag klarzukommen. Also das, was für uns die heile Welt ist, ist für die der Ort, wo ihre Symptome erst an die Oberfläche kommen – und eben oft getriggert durch so was wie eine Rakete, die irgendwo abgeschossen wird oder ein Knallkörper oder so was bei einem Feuerwerk.
Das war auch eine Parallele, die in den verschiedenen Interviews, in den Erzählungen immer wieder vorkam, dass Gerüche oder Geräusche auch solche Traumata oder Erinnerungen wieder hochholen können. Wir haben einfach nach Bildern gesucht, die dem Zuschauer das irgendwie verständlich machen. Also wir sehen den ganzen Film lang nur diese heile Welt, es gibt keine Bilder aus dem Krieg. Trotzdem merkt man, was da unter der Oberfläche liegt und was da vielleicht hochkommen kann.
"Dieses System war auch schon vor 20 Jahren überlastet"
Burg: Die meisten erzählen sehr offen davon, wie sie versuchen, mit ihren Traumata umzugehen. Ein Mensch, den Sie interviewt hatten, der hat es nicht geschafft, der hat vorher Selbstmord begangen, auch das kein ungewöhnliches Phänomen. Rund 22 Veteranen pro Tag nehmen sich das Leben in den USA. Man hört immer wieder, dass die Armee die Veteranen nicht angemessen unterstützt. Ist das auch was, was Sie immer wieder gemerkt haben bei Ihren Recherchen?
Baron: Diese Zahl der 22 Veteranen pro Tag, das ist natürlich eine unvorstellbare Zahl, wenn man sich das vor Augen führt. Das schließt natürlich Veteranen aus allen Kriegen ein, die noch am Leben sind, und ist natürlich eine erschreckend hohe Zahl. Es gibt in den USA ein eigenes Gesundheitssystem für die Veteranen, was auch für diese psychologische Nachsorge da ist. Aber wenn man sich jetzt eben vorstellt, die Menschen werden natürlich immer älter, und die USA waren ja immer wieder in Kriegseinsätzen, dieses System war dadurch auch schon vor 20 Jahren überlastet.
Burg: Ihr Film lief im letzten Jahr beim Dokumentarfilmfestival in Leipzig, und da gab es auch Schulvorstellungen, das heißt, Sie haben den Film auch Schülern und Schülerinnen gezeigt. Wie waren Ihre Erfahrungen? Ist es etwas, das man regelmäßiger einführen sollte?
Baron: Ich war tatsächlich sehr überrascht. Es gab Vorstellungen mit Schulklassen, also von verschiedenen Schulen, Oberstufe, ich glaube so zwischen 16, 17, 18 Jahre alt. Und ich dachte schon, das ist jetzt ein langer Dokumentarfilm auf Englisch mit deutschen Untertiteln, der Film nimmt sich natürlich auch Zeit, diese Geschichten zu erzählen, der ist von den Sehgewohnheiten weit weg von dem, was Jugendliche im Fernsehen sehen.
Ich hatte schon Bedenken, aber die Erfahrung war eine ganz andere: Von Anfang an haben die so konzentriert geguckt den ganzen Film über, und danach gab es wirklich ein sehr interessantes Gespräch, auch darüber, wie sich die Jugendlichen heute von Werbung der Bundeswehr angesprochen fühlen. Da gibt es natürlich diese Youtube-Spots, diese Werbekampagnen, die die Bundeswehr fährt, da sind die natürlich die Zielgruppe. Es war interessant, darüber zu sprechen. Mein Film zeigt eben eine andere Seite davon, was auch ein Teil davon ist, zum Militär zu gehen oder in den Krieg zu gehen. Die Jugendlichen haben sehr reflektiert darüber gesprochen, das war echt spannend.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.