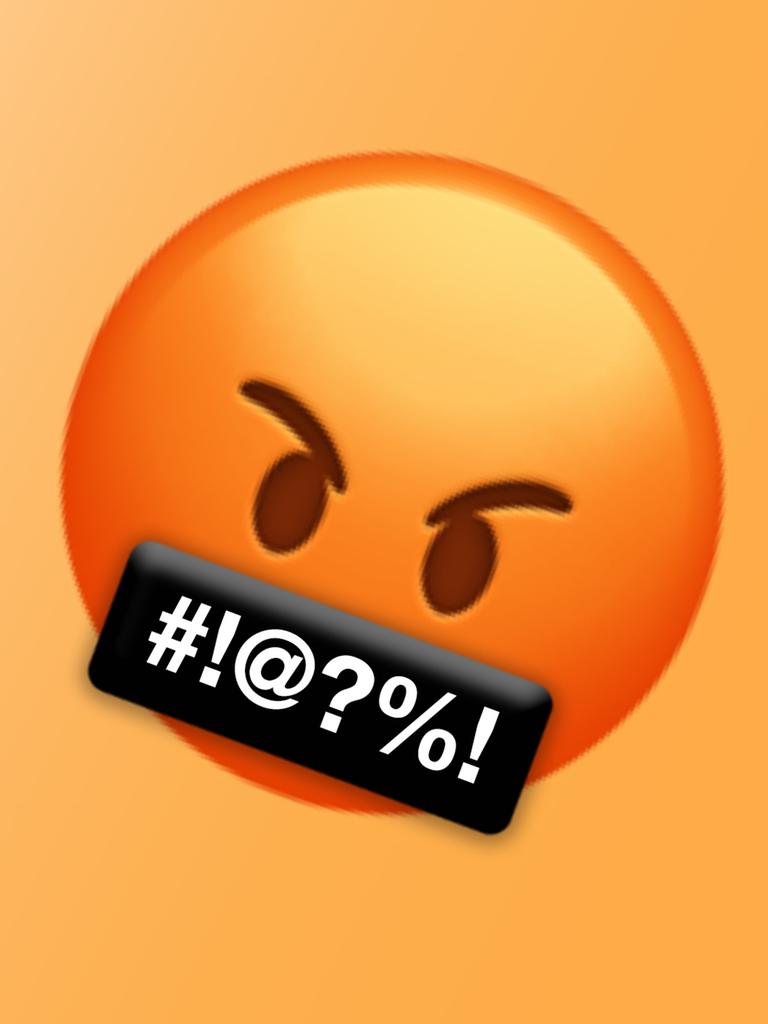Lob des Fluchens

"Du dumme Sau!" Klaus Kinski wollte nur über Jesus reden - doch das eskalierte zur legendären Publikumsbeschimpfung. © picture-alliance / dpa / dpa-Film
Schimpft, ihr Schwachmaten!

Fluchen gehört sich nicht. Doch tun wir es ständig. Aber nicht genug, obwohl es mehr nützt, als es schadet. Wir sollten der Wut verbal freien Lauf lassen, um uns abzuhärten, falls uns selbst mal ein böses Wort trifft.
Man muss heutzutage aufpassen, was man sagt. Heißt es. Als wäre das was Neues. Die Leute fühlen sich ja gleich von allem angegriffen, wenn man nur mal seine Meinung kundtut, zum Beispiel, dass sie - ganz objektiv betrachtet - Deppen sind. Ja, man darf heute eigentlich gar nichts mehr sagen. Auch ganz normale Kritik, dass die Dinge suboptimal laufen, um nicht zu sagen: bescheiden. Mehr trauen wir uns nicht.
Wir Weicheier! Warmduscher! Feiglinge!
Es ist bezeichnend, dass in Zeiten, in denen sich fast jeder als Opfer fühlt, gerade „Opfer“ ein Schimpfwort ist. Nicht im Sinne, dass man Opfer wird, sondern dass man sich zu einem machen oder sich das gefallen lässt. Opfer, wie einst das Opfertier auf dem Altar, das Lamm zur Schlachtbank. Ohne sich zu wehren.
Dabei ist Wehrhaftigkeit in diesen Zeiten geboten. Die Gefahren lauern im Straßenverkehr, bei der Arbeit, in der Politik und überhaupt überall, wo Menschen zusammenkommen. Die Gesellschaft ist gespalten, die Stimmung ist gereizt, wenn nicht aggressiv.
Wohin damit? Leute anschreien? Streit vom Zaun brechen? Schlägereien anzetteln? Nein, in solchen Fällen hilft auch ein milderes Mittel: das Fluchen.
Das Tabu brechen, das keins ist
Als Kinder haben wir gelernt, dass wir es nicht tun sollen – von Eltern, die es selbst getan haben. So macht es auch die nächste Generation. Aber warum sollte man sich daran halten?
Du sollst nicht fluchen – und alle tun es! Ständig! Überall! Selbst wer es nicht tut, würde gern und manch einer würde es wohl lieber öfter tun. Unschöne Wörter, die unschöne Dinge bezeichnen, vor allem Dinge aus dem Intimbereich.
Gerade die Deutschen scheinen besonders an der analen Phase zu hängen, was man auch am „Arsch“ und dem dazugehörigen Loch erkennt. Man kann nur mutmaßen, woran das liegt. So monothematisch es scheint, so vielseitig zeigt es sich: Ein Arsch darf auch als Gesicht dienen oder Geige spielen, als Karte gezogen oder zum Kriechziel werden.
Von Scheiße zu Scheibenkleister
Wobei wir bei den Fäkalien wären. Das heißt: Exkremente. Um nicht zu sagen: Stoffwechselendprodukte. Nein, ich meine nicht Kot und Urin. Nicht Stuhl oder Harn. Und es reicht auch kein Mist. Nein, verdammt!
Ich meine Scheiße. Sie ist allgegenwärtig, und wo sie noch nicht ist, kann man sie hinwerfen und dranhängen, ob vorne oder hinten: Scheißschule, Scheißarbeit, Scheißkerl oder Klugscheißer. Zur Abwechslung dürfen die Dinge auch gern kacke oder bekackt sein. Wem’s nicht passt, kann sich verpissen.
Das hat jetzt irgendwie gutgetan. Tatsächlich ist das keine Einbildung, weder Zeichen der Verrohung noch ein Rückfall in kindisches Trotzverhalten. Wer’s fürs Gewissen braucht, dem sei versichert: Schimpfen hat seinen Nutzen. Das ist sogar wissenschaftlich belegt.
Es hilft uns, Stress zu bewältigen, Schmerz zu ertragen, Kräfte zu mobilisieren, Leistung zu steigern, etwa wenn wir uns beim Sport selbst anspornen. Zetern ist ein emotionales Druckventil, das der mentalen Gesundheit dient. Es stärkt die inneren Abwehrkräfte, macht resilient.
Nein, „Scheibenkleister“ zischen reicht da nicht. Nichts ist schlimmer als Gefühle, die danach schreien, herausgefeuert zu werden, und dann bloß als Rohrkrepierer enden. Zum Henker mit den Hemmungen!
Wer fickt hier wen?
Fluchen muss man fühlen. Es muss kurz sein und knallen. Fluchen ist unmittelbar, vielleicht sogar die ehrlichste Ausdrucksform, die wir haben. Wie schwer tun wir uns mit dem kitschigen und abgedroschenen „Ich liebe dich“, aber wie leicht ist ein „Fick dich!" Klarer kann man einem nicht sagen, dass man anderer Meinung ist. Oder dass man Diskussionen abbrechen will.
Auch der importierte „Motherfucker“ ist nicht so eindeutig. Wer sagt denn, dass die eigene Mutter gemeint ist? Es kann ja irgendeine Mutter sein. Unbestritten ist es, dass auch dieses Wort dem Sprecher ausgesprochen guttut und gut klingt, obwohl – auch das belegen Studien – sich niemals befriedigender flucht als in der Muttersprache.
Doch am „Motherfucker“ zeigt sich auch die Vielseitigkeit von Flüchen. Das Wort kann je nach Kontext auch ein Lob sein. Zweimal minus ergibt plus: Ein „bad motherfucker“ kann einfach nur ein toller Typ sein, ein Draufgänger.
Die Kunst des Fluchens
Flüche scheren sich nicht um Tabus. Keifen wurde nicht zum Kuscheln erfunden. Wir sind so durchreguliert und gezähmt, dass sich immer wieder auch mal eine niedere Lust Bahn brechen muss. Was nicht heißt, ästhetische Ansprüche völlig zu vernachlässigen.
Fluchen kann auch Kunst sein. Ohne gäbe es wohl keinen Rap. Die modernen Dichter zeigen uns, wie es kreativ geht. Der Lyriker Robert Gernhardt hat bereits 1979 ein böses Sonett gegen Sonette geschrieben, dass fluchmäßig immer noch ziemlich up to date ist.
Und 1965 machte Peter Handke vor, wie „Publikumsbeschimpfung“ im Theater geht: „ihr Rotzlecker … ihr Schrumpfgermanen, ihr Ohrfeigengesichter … ihr Auswürfe der Gesellschaft … ihr Massenmenschen … ihr Geschmeiß … ihr Menschendarsteller …“ und noch weitere Unfeinheiten mehr, inklusive einiger, die beim Zitieren wehtun.
Sechs Jahre später beschimpfte dann Klaus Kinski das Publikum legendär mit freien Improvisationen, als er eigentlich nur was über Jesus vortragen wollte: „Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich sage.“ Hat nicht so gut geklappt.
Schimpfwörter nennt man nicht grundlos Kraftausdrücke. Da steckt Druck dahinter! Fast hätte ich „Wumms“ geschrieben, wenn es der Bundeskanzler nicht zum Unwort gemacht hätte.
Flüche gehören zum stärksten, was die Sprache zu bieten hat. Sie sind die schärfsten Waffen, mit denen wir uns verbal wehren können, auch wenn es nur darum geht, in einem wütenden Moment die Welt zu verdammen.
Auch in der Politik wird geflucht
Fluchen heißt auch Verfluchen. Dahinter steckt die magische Vorstellung, jemandem mit Worten schaden zu können. Ein alter Aberglaube, dass man jemandem die Pest an den Hals wünschen kann. Ja, schicken wir sie zum Teufel, die, die uns ärgern, die sich danebenbenehmen, die uns enttäuschen oder gefährlich werden.
Manche Worte können wirklich verletzen. Wie die grobe Beleidigung, das Schimpfwort, das einzig dazu dient, das Ego zu kränken oder den Ruf zu schädigen. Was zu weit geht, darüber gehen die Meinungen auseinander.
Joschka Fischer hat den Bundestagsvizepräsidenten 1984 immerhin gesiezt, als er ihn „Arschloch“ nannte und sogar um Erlaubnis gebeten („mit Verlaub“), wofür er aber keine bekam, sondern von der Bundestagssitzung ausgeschlossen wurde. Jahre später musste Renate Künast zunächst erfahren, dass „Drecks Fotze“ vom Landgericht Berlin zunächst nicht beanstandet wurde, was später aber wieder anders beurteilt wurde. Anschließend gab ihr das Kammergericht recht.
Was lernen wir daraus? Nicht alles, was man denkt, muss man sagen, schon gar nicht schreiben. Ebenso wäre viel gewonnen, nicht auf jede mögliche Beleidigung einzugehen. Am Ende sind es auch nur Worte, im Affekt gesprochen von emotionalen Wesen. In manchen Fällen kann das sogar eine Ehre sein, von Leuten beleidigt zu werden, denen man auch nichts Schöneres zu sagen hat.
Aber für alle, die nicht an sich halten können: Es gibt immer noch Safe Spaces, wo die absolute Redefreiheit gilt: im Auto, im Wald, in den eigenen vier Wänden – und vor allem: allein. Schimpfen wir wie die Rohrspatzen, fluchen wir wie die Bierkutscher, setzen wir auf die heilende Kraft der Tourette-Tirade! Härten wir uns ab, falls es uns mal trifft.