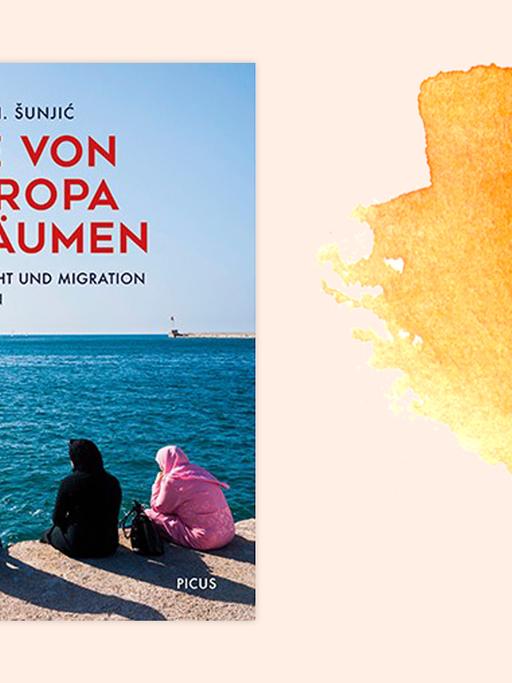In Turnschuhen über die Alpen
29:35 Minuten

Tausende Flüchtlinge passieren jedes Jahr die Alpen zwischen Italien und Frankreich. Je strenger die Kontrollen, desto gefährlicher die Fluchtwege. Freiwillige Helfer auf beiden Seiten geraten immer wieder selbst ins Visier der Grenzpolizei.
„Flüchtlinge, die von der Balkan-Route hier ankommen, haben häufig tiefe Wunden, am Körper aber auch in ihrer Psyche. Manche von ihnen wurden an der Grenze zwischen Bosnien und Kroatien geschlagen, manche haben Verbrennungen, Narben, offene Wunden. Menschen, die alles verloren haben, weil die Polizei verbrannt oder gestohlen hat, was sie besaßen.“
Die italienische Kleinstadt Oulx ist umgeben von einem beeindruckenden Bergpanorama. Zu allen Seiten erheben sich die schneebedeckten Alpen. Doch viele, die hier ankommen, wollen so schnell wie möglich weiter: Flüchtlinge auf dem Weg nach Frankreich. Oulx ist der letzte Bahnhof vor der Grenze. Und die Berggipfel sind ihre letzte große Hürde.
Die Pilgerherberge als Notunterkunft
„Sie kommen mit Babys an, die im Wald geboren wurden. Es gibt Kinder – drei, vier, fünf Jahre alt –, die ihr ganzes Leben auf dem Weg verbracht haben, im Wald und auf der Flucht vor der Polizei, auf der Suche nach einem Schlafplatz, frierend, hungrig.“
Nur einen Steinwurf vom Bahnhof von Oulx entfernt führt ein kleiner Weg zu einem weißen, schmiedeeisernen Tor. Dahinter steht ein altes zweistöckiges Steinhaus mit gelben Fensterläden, wie es hier in der Region überall stehen könnte. Früher kamen hier Pilger auf dem Jakobsweg unter. Heute ist das Haus eine privat betriebene Notunterkunft für Geflüchtete. „Sie haben Narben, Probleme mit den Zehen, können nicht mehr laufen. Und trotzdem ist es schwierig, sie zu überzeugen, hier zu bleiben. Sie wollen weiter, trotz ihrer Schmerzen. Oft haben sie nur ein Ziel: Deutschland.“
Sylvia Massara ist eigentlich Französischlehrerin im örtlichen Gymnasium. Jeden Mittwoch wechselt sie die Rollen und arbeitet ehrenamtlich in der Notunterkunft von Oulx. Was sie hier manchmal erleben muss – hier, mitten in Europa – ist für sie selbst nach den fünf Jahren ihres Engagements immer noch unvorstellbar.

Der Bahnhof von Oulx liegt mitten in den Alpen. Hier kommen jedes Jahr Tausende Flüchtlinge an, die weiter nach Frankreich wollen.© Deutschlandradio /Philipp Lemmerich
Die Geschichte der Flüchtlinge in Oulx beginnt Anfang 2016. In Europa sind damals Millionen Geflüchtete unterwegs. Doch die Stimmung dreht sich, viele Grenzübergänge werden streng überwacht, an vielen Stellen gibt es kein Durchkommen mehr. So auch in Ventimiglia am Mittelmeer, dem Transitort von Flüchtlingen auf dem Weg von Italien nach Frankreich. Die Flüchtlinge suchen sich andere Wege, weiter nördlich, durch die Alpen. Nach und nach wird das Susatal mit den Orten Oulx und Bardonecchia zur neuen Anlaufstelle. Es gibt einen Zug fast bis an die Grenze, die Alpenpässe sind weniger hoch als anderswo, und noch gibt es wenige Kontrollen.
„Damals strandeten viele junge Afrikaner in Bardonecchia. Der Schnee lag meterhoch, es gab Lawinen. Wir haben ihnen gesagt: Ihr dürft auf keinen Fall losgehen, das ist lebensgefährlich. Und die Antwort war dann: Ich habe das Meer überquert und überlebt, also werde ich auch das versuchen. Wenn ich sterbe, ist es Gottes Wille.“
Raus aus Italien
In Oulx, Bardonecchia und anderen Orten in der Umgebung bildet sich damals ein Netzwerk von Freiwilligen, die den Flüchtlingen ein Obdach geben, sie mit Essen versorgen und mit Kleidung ausstatten für den gefährlichen Weg über die Berge. Das ist fünf Jahre her. Was als Ausnahmesituation begann, ist heute Alltag. Statt Westafrikanern kommen heute mehr Afghanen, mehr Familien mit kleinen Kindern. Die Wünsche sind die gleichen geblieben: Raus aus Italien, weiter nach Europa hinein, an einen Ort, der Sicherheit verspricht. Geblieben sind auch die Gefahren: sich zu verlaufen im Schnee, vom Weg abzukommen, nachts, mitten im Hochgebirge, Gliedmaßen zu verlieren wegen der Kälte zu erfrieren. Deshalb machen die Freiwilligen weiter.

Sylvia arbeitet eigentlich als Französischlehrerin und engagiert sich ehrenamtlich in der Notunterkunft von Oulx.© Deutschlandradio / Philipp Lemmerich
Sylvias Einsatzort heute ist ein bis auf den letzten Zentimeter vollgestellter Raum im Erdgeschoss des Rifugio. Auf der linken Seite stehen etliche Pappkartons, fein säuberlich mit grünem und blauem Filzstift beschriftet: Mützen, Handschuhe, Schals, Babykleidung. Darüber und darunter stehen unzählige Schneeschuhe. Auf der rechten Seite hängen Anoraks in allen Farben und Größen. Es ist die Kleiderkammer des Rifugio.
Im Hof vor der Kleiderkammer hat sich am frühen Abend eine Traube gebildet. Ein Dutzend junger Männer will sich noch für den Weg über die Berge ausstatten.
„Brauchst du Kleidung für die Berge?“ – „Ja, für die Berge, für den Weg nach Frankreich.“ – „Welche Schuhgröße?“ – „42. Gibt es auch Sportschuhe?“ – „Ja, aber durch den Schnee kannst du damit nicht laufen. Mit Turnschuhen ist es zu gefährlich. Es gibt Leute, die haben in den Bergen Finger und Füße verloren.“
„Es gibt Leute, die drehen durch“
So ganz zu glauben scheint es der junge Mann noch nicht. Fragend schaut er in die Runde. Dann nimmt er doch die Skihose und die Schneeschuhe, die ihm Sylvia in die Hand drückt, und probiert sie an. Der junge Mann ist Algerier. Er soll hier Hacine heißen. Groß und schlank wie er ist, mit engen Jeans, Vollbart und modischer Wollmütze, könnte er auch in jedem Berliner Szene-Café sitzen. Dabei kommt er direkt von der Balkan-Route. Im Oktober 2019 machte er sich in Algerien auf den Weg.
„Ich wollte nach Frankreich, aber meine Visa-Anträge wurden abgelehnt. Also bin ich ohne Visum los. Der Weg über das Meer war mir zu gefährlich. Ich habe Familie, ich kann mein Leben nicht aufs Spiel setzen.“ Eine Entscheidung mit Folgen. Hacine nahm den Landweg: Nordafrika, Türkei, Griechenland, bis nach Bosnien-Herzegowina, dann ging nichts mehr. 16 Monate lang steckte er in Flüchtlingscamps an der kroatisch-bosnischen Grenze fest. Die Bedingungen dort – das erzählen alle hier – waren katastrophal. 13 Mal versuchte er die Grenze zu überwinden. Zwölf Mal wurde er zurückgeschickt. Beim 13. Mal klappte es. Nun trennt ihn nur noch eine letzte Grenze von seinem Zielort Paris.
„Es ist nicht leicht, das mental durchzuhalten. Ich habe viele Leute kennengelernt, die ihre Moral verloren haben, die harte Drogen nehmen, die ihre Erinnerung verloren haben. Es gibt Leute, die sind vor Verzweiflung durchgedreht, einfach verrückt geworden. Dieser Weg kann alles mit dir machen, wenn du nicht stark genug bist.“
Jeden Abend dasselbe Katz- und Mausspiel
Die Zeit drängt. Jeden Abend um Viertel vor Acht fährt der letzte Bus von Oulx in Richtung Grenze – ein blauer Linienbus, der eigentlich Touristen vom Bahnhof in die Skigebiete bringt. Doch dieses Jahr gibt es keine Touristen, die Skigebiete sind geschlossen. 20 Flüchtlinge steigen ein – alle in dicken Skijacken, Hosen und Stiefeln – und kaufen für zwei Euro eine Fahrkarte nach Clavière, dem letzten Örtchen in Italien, direkt an der Grenze. Sylvia, die Freiwillige aus dem Rifugio, hat sie bis zur Bushaltestelle begleitet und blickt ihnen jetzt hinterher.
„Jeden Abend fragt man sich, ob sie es schaffen werden. Vor allem müssen sie verstehen, dass die warme Kleidung notwendig ist. Die beiden Männer gerade, die in Sportschuhen losgehen wollten? Man muss ihnen klar sagen, dass das nicht geht, dass hier wirklich schon Leute ihre Füße verloren haben. Es ist schrecklich.“

Ein Linienbus bringt die Flüchtlinge bis zur Grenze.© Deutschlandradio / Philipp Lemmerich
Der Busfahrer scherzt noch, ob er Sylvia ein Stück mitnehmen solle. Man kennt sich. Denn es ist ja jeden Abend dasselbe Spiel, seit fünf Jahren. Vom Grenzörtchen Clavière bis nach Montgenèvre auf französischer Seite sind es gerade mal zwei Kilometer. Zwei Kilometer, die für Tausende Flüchtlinge jedes Jahr zu einem lebensgefährlichen Hindernis werden. Die Grenzkontrollen zwingen die Flüchtlinge zu Umwegen. Bei Nacht versuchen sie ihr Glück auf vereisten Trampelpfaden und menschenleeren Skipisten.
Tote, Verletzte und Amputationen
Mindestens fünf Geflüchtete sind hier seit 2016 erfroren. Dazu kommen unzählige Verletzungen und Amputationen. Deshalb machen sich auf französischer Seite jeden Abend Freiwillige auf den Weg in die Berge. Sie halten Ausschau nach Flüchtlingen, wollen Verletzte versorgen und sie sicher ins Tal begleiten. Die Grenzpolizei soll genau das verhindern. In den letzten Monaten ist sie besonders präsent, offiziell zur Terrorismusabwehr und wegen der Corona-Pandemie. Gespräche mit Journalisten sind ohne Genehmigung des Innenministeriums nicht möglich. Und so bleibt im Dunklen, welche Ziele Frankreich mit seiner Grenzpolitik verfolgt, wie es den Polizisten damit geht, mitten im Winter Flüchtlinge zurückzuschicken.
Der Grenzort Montgenèvre. 1900 Höhenmeter, die Temperatur unter null, außerhalb des Ortes liegt noch Schnee. Vor der Station der französischen Grenzpolizei PAF wird aufgeregt diskutiert. Die Stimmung ist angespannt. In Frankreich gilt in der Coronapandemie eine nächtliche Ausgangssperre. Wer nach 18 Uhr trotzdem unterwegs ist, braucht eine Sondergenehmigung. Für die Polizei ein Anlass, um die Freiwilligen immer wieder zu kontrollieren. Die haben zwar eine Genehmigung dabei, sie ist aus Sicht der Polizisten aber falsch ausgefüllt. Die Geldstrafe: 135 Euro pro Person. Alle Verhandlungsversuche scheitern.
„Es ist schon das dritte Bußgeld, das ich hier bekomme, alle von diesem Jahr. Bei dem ersten habe ich schon Widerspruch eingelegt. Als sie uns im Dezember kontrolliert haben, gab es keine Probleme.“
Flüchtlingsdrama im Skiparadies
Baptiste ist Anfang 30 und wohnt eigentlich in Paris. Vor eineinhalb Jahren war er zum ersten Mal nachts mit den Hilfsorganisationen Medecins du Monde und Tous Migrants hier in Montgenèvre unterwegs, um Flüchtlingen zu helfen. Seitdem kommt er regelmäßig, bleibt manchmal einen ganzen Monat lang. Montgenèvre ist eigentlich ein beliebter Ski-Ort. Doch im Corona-Winter ist er wie ausgestorben. Stattdessen findet jede Nacht ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Freiwilligen und der Grenzpolizei statt. Die einen wollen ankommende Flüchtlinge vor der Kälte retten und in Sicherheit bringen. Die anderen wollen sie festnehmen und zurück nach Italien schicken.

Langlauftouristen in Montgenèvre. Normalerweise ist der Ort ein beliebtes Skigebiet, aber in der Corona-Pandemie ist er menschenleer.© Deutschlandradio / Philipp Lemmerich
Die Maraudeurs, wie ehrenamtliche Bergretter wie Baptiste sich nennen, kennen die Wege durch die Berge aus dem Effeff. Während mehrere Gruppen jede Nacht zu Fuß hoch auf die Pässe steigen, bleiben andere unten im Ort und warten in Autos, um die Flüchtlinge dann so schnell wie möglich ins Tal zu bringen. Auch ein Arzt der humanitären Hilfsorganisation Médecins du Monde – Ärzte der Welt – ist jeden Abend dabei. Heute ist es Jean-Luc, neben ihm am Steuer sitzt Juliette, eine Studentin aus Briançon. Sie fahren Runden durch den Ort, um zu verstehen, wo gerade die Polizei patrouilliert.
„Keine Bullen.“ – „Wo sind sie nur? Sie sind doch in diese Richtung gefahren. Da sind sie. Dein Freund und Helfer. Was machen wir?“ – „Wir drehen um und dann fahren wir zum Parkplatz an der Apotheke.“
Die Helfer kommunizieren über verschlüsselte Chats
Oben, inmitten einer Skipiste, hält Baptiste zum ersten Mal an. Hier ist es dunkel genug, um vor der Polizei verborgen zu bleiben. Hektisch tippt er etwas in sein Smartphone. Über einen verschlüsselten Chat kommuniziert er mit den anderen Freiwilligen, die zeitgleich mit ihm in den Bergen sind. Sie halten sich ständig auf dem Laufenden. Die eigene Position. Die Bewegungen der Polizei. Wo Flüchtlinge vermutet werden.
Nach einer Weile stapft Baptiste weiter, schräg den Berg hinauf in Richtung Dunkelheit. Er überquert die Skipiste, einen Hang voller Geröll, dann einen Weg entlang. Wenn er spricht, flüstert er nur. Wenn er auf sein Handy schaut, geht er vorher in die Hocke und schirmt mit einer Hand das Display ab. Unten im Dorf, das sich von hier oben gut überblicken lässt, fahren im Minutentakt Polizeiautos Patrouille. Eine Szene wie in einem Krimi.

Die Ehrenamtlichen von Médecins du Monde – Ärzte der Welt – werden die ganze Nacht von der Polizei beschattet. Das schwarze Auto links ist ein ziviles Polizeifahrzeug.© Deutschlandradio / Philipp Lemmerich
„Wir sind am Ziel angekommen. Ich verstecke mich hier hinter diesem Pfeiler. Da unten ist der Grenzposten. Von hier aus können wir beobachten, was die Polizei macht. Wir sehen die Scheinwerfer, wenn sie im Ort herumfahren. Und direkt hier unterhalb kommt auch ein Weg aus Italien an. Den nehmen vor allem die Personen, denen es nicht so gut geht, weil er der leichteste Weg ist.“
Ein Team spielt den Lockvogel für die Polizei
Nun passiert lange nichts. Baptiste dokumentiert die Bewegungen der Polizei im Gruppenchat. Er atmet flach. Würde er sehen, dass mehrere Polizisten schnell zu ihren Autos laufen und losfahren, dann wüsste er: Es wurden Flüchtlinge gefasst. Dann würde er zum Grenzposten laufen und die Situation so gut es geht dokumentieren. Denn: Eigentlich haben die Flüchtlinge das Recht auf eine medizinische Untersuchung und auf einen Übersetzer.
Aber an der Grenze von Montgenèvre scheinen eigene Regeln zu gelten. „Vor Kurzem wurde eine schwangere Frau dort festgehalten. Die ganze Nacht hat die Polizei uns gesagt: Es ist alles in Ordnung, sie sind im Warmen, wir erklären ihnen alles, es ist kein Arzt nötig. Dabei standen die Ärzte von Médecins du Monde vor der Tür. Später haben wir erfahren, dass die Frau am nächsten Morgen entbunden hat.“
Nach einer halben Stunde Warten vibriert irgendwann das Handy. Das Team im kleinen Tal gegenüber hat eine Gruppe mit sieben Flüchtlingen gefunden. „Wenn sie in Schwierigkeiten sind, werden wir unsere Autos rufen und versuchen sie so schnell wie möglich ins Tal zu fahren. Wenn wir das machen, fahren wir unmittelbar an der Grenzpolizei vorbei. Das muss dann gut koordiniert sein.“
Unten im Ort machen sich Juliette und Jean-Luc bereit, um die Flüchtlinge ins Tal zu fahren. Juliette parkt unauffällig vor einem Wohnhaus, von wo aus man die Hauptstraße einsehen kann. „Wir verstecken den Wagen hier und warten jetzt, dass das andere Auto mit unseren Kollegen und den Flüchtlingen vorbeifährt. Wir sind der Lockvogel am Ende, okay? Also, wir folgen ihnen. Denn falls es eine Polizeikontrolle gibt, werden sie das letzte Auto von uns anhalten. Und da wir das Logo von Ärzte der Welt auf dem Auto haben, lieben sie es, uns zu kontrollieren. Mit ein bisschen Glück können die anderen dadurch unbehelligt ins Tal fahren.“
„Ich denke, wir haben gewonnen“
Wenige Minuten später ist es soweit. Als zwei Wagen in zivil vorbeifahren, hängt sich Juliette an ihre Fersen. Nun liegen noch 13 Kilometer vor ihnen, in denen sich die Landstraße ins Tal hinab schlängelt. In jeder Steilkurve könnte die Polizei auf sie warten.
„Schau mal, da ist ein Auto ganz dicht hinter uns. Ich weiß nicht, ob das nicht Bullen in zivil sind.“ – „Valérie schreibt: Ich bin das hinter euch. Lasst mich vorbei. Es sind also keine Bullen.“ – „Okay, aber warum ist sie denn hinter uns? Valérie sollte doch vorneweg fahren?“
Ein kurzer Moment der Verwirrung, mitten in den Serpentinen. Dann erreicht der Konvoi das Tal. Jean-Luc auf dem Beifahrersitz meldet im Sekundentakt, was die anderen im Chat schreiben.
„Die Bullen sind ins Tal gefahren, aber keine Spur von ihnen.“ – „Cool! Dann sind wir heute mal super früh an der Notunterkunft.“ – „Ortseingang Briançon: keine besonderen Vorkommnisse. Kreisverkehr: alles leer. Innenstadt Briançon. Ich denke, wir haben gewonnen.“
Erst beim Eintreffen an der Notunterkunft wird klar, wen sie heute Abend durch ihren Einsatz gerettet haben: Es ist eine Familie aus Afghanistan, darunter zwei kleine Kinder und ein Baby.
12.000 Geflüchtete in zwei Jahren
Wer es über die Grenze nach Frankreich und hinab ins Tal nach Briançon geschafft hat, landet fast immer im Refuge Solidaire – einer ehrenamtlich betriebenen Notunterkunft mitten in der Stadt. Es ist früher Morgen. Im Aufenthaltsraum, einem Zimmer mit kahlen Wänden und vielen Tischen und Stühlen, sitzen 20 Menschen bei Weißbrot mit Marmelade, heißer Milch und Tee.
Nebenan, in einem Zimmerchen, in das nur wenig mehr als ein Schreibtisch hineinpasst, sitzt Marie-Danielle, 71 Jahre alt, und sortiert Unterlagen. Seit einigen Jahren kümmert sie sich ehrenamtlich um die Betreuung von Neuankömmlingen. „Wenn Personen hier ankommen, erklären wir ihnen, dass sie hier übernachten können, dass wir uns um das Essen kümmern, dass wir sie beraten. Die Tickets zur Weiterfahrt können wir aber nicht bezahlen. Hier sind in zwei Jahren 12.000 Menschen vorbeigekommen. Das sind mehr, als Briançon Einwohner hat.“

Die 71-Jährige Marie-Danielle engagiert sich seit einigen Jahren in der Flüchtlingshilfe.© Deutschlandradio / Philipp Lemmerich
Eine staatlich organisierte Notunterkunft für Geflüchtete gibt es in Briançon nicht. Bis zur Kommunalwahl im letzten Jahr hatte das Refuge Solidaire zumindest die Unterstützung des Bürgermeisters. Doch der Wind hat sich gedreht. Der linke Amtsinhaber wurde abgewählt, sein Nachfolger schlägt härtere Töne in der Flüchtlingspolitik an. Im Frühjahr könnte dem Refuge sogar die Räumung bevorstehen. Momentan haben im Refuge Solidaire 80 Geflüchtete Unterschlupf gefunden – weit mehr, als offiziell Plätze zur Verfügung stehen. Deswegen wird improvisiert, mit Matratzenlagern auf dem Fußboden.
Bewegungsfreiheit gibt es für die Geflüchteten in Briançon nicht. Deshalb verbringen sie Tag für Tag auf dem Vorplatz, sitzen auf Treppenstufen, spielen Tischtennis auf zwei nebeneinander gestellten Biertischen. Solange, bis sie das Geld für die Weiterreise haben und ihr Zug oder ihr Bus abfährt, nach Grenoble, Marseille oder Paris.
Auch Ahmed, der in Wirklichkeit anders heißt, muss noch ein paar Tage warten. Er ist 25 Jahre alt und kommt, wie so viele hier, aus Afghanistan. „Man kann diesen Ort nicht mit anderen Flüchtlingslagern vergleichen. Das hier ist wie ein Hotel für mich. Ein sehr guter Ort. Es ist warm. Obwohl ich nur auf einer Matratze auf dem Zementboden schlafe, in einem Raum, der gleichzeitig Küche und Essenssaal ist. Es ist viel besser, als das, was wir auf unserer Reise erlebt haben. Wir haben tagelang im Wald geschlafen. Hier ist es viel, viel besser.“
„Hauptsache, du kommst nicht zurück“
In Afghanistan erlebte Ahmed Folter und Selbstmordattentate. Ein Bekannter wurde entführt, weil er Englisch sprach. Auch Ahmed spricht Englisch. Wäre er geblieben, hätte er nicht lange überlebt, davon ist er überzeugt. Mit seinen Eltern, die in Afghanistan geblieben sind, telefoniert er regelmäßig.
Anders als andere Flüchtlinge erzählte er seinen Eltern alles über seine Flucht: Wie er mit einem kleinen Schlauchboot auf Lesbos ankam, im Glauben, dass nun ein besseres Leben beginnen würde. Von den unvorstellbaren Zuständen im Flüchtlingslager Moria, in dem er ein Jahr lang ausharrte. Von den unzähligen Versuchen, sich auf eine Fähre Richtung Festland zu schmuggeln. Von dem Scheitern an der bosnisch-kroatischen Grenze, von der Gewalt der kroatischen Grenzpolizisten. Davon, wie er sich 16 Stunden lang an der Karosserie eines Lkw festklammerte, um unbemerkt die Grenze nach Italien zu passieren. Das alles hat er seinen Eltern erzählt. Und trotzdem sagte ihm sein Vater heute Morgen am Telefon: Hauptsache, du kommst nicht zurück. Hier ist es zu gefährlich für dich.
„Von Italien hierher war es nicht mehr schwer. Für euch Europäer sieht es hart aus, aber für uns war es einfach. Wir haben schon ganz andere Grenzen überquert. Ich bin bis zu den Knien im Schnee versunken. Drei, vier, fünf Stunden, wie lange es auch gedauert hat. Aber es hat mir nichts ausgemacht. Ich war glücklich. Ich wollte einfach ankommen. Diese Geschichten, dass jemand vom Weg abkommt, sich in den Bergen verläuft und erfriert oder einen Fuß verliert. Daran haben wir nicht gedacht. Wir wollten einfach nur ankommen.“
Mit jeder Grenze, die er überwindet, die ihn weiter von Afghanistan wegbringt und näher an sein Ziel, fühlt er sich sicherer, erzählt Ahmed. Für den kommenden Dienstag hat er ein Ticket für den Nachtzug nach Paris gekauft. Bezahlt hat es sein Onkel, das Geld verschickt über Western Union von Afghanistan nach Frankreich. Von Paris aus will Ahmed in ein Land, in dem er bleiben kann, in die Niederlande vielleicht oder nach Deutschland. Er wiegt den Kopf hin und her. Wenn er es sich genau überlegt, dann zu 80 Prozent nach Deutschland.
Eine Freiwillige wird zur Geburtshelferin
Im Refuge ist es bereits Mittag. Marie-Danielle packt im Büro ihre Sachen zusammen. Die Sprechstunde ist vorbei, gleich will sie das Essen abholen. Seit Marie-Danielle in Rente ist, widmet sie die meiste Zeit ihres Tages der Flüchtlingshilfe. Sie kocht, erledigt Behördengänge, berät bei Asylfragen und nimmt auch immer wieder Familien bei sich in ihrer kleinen Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung auf, wenn im Refuge der Platz fehlt. Sie hilft, obwohl sie weiß, dass es für viele Menschen, die hier ankommen, womöglich keine Zukunft in Europa geben wird, dass nur jeder dritte Asylbescheid in Frankreich positiv ist, dass sich viele von ihnen dann für ein Leben ohne Papiere entscheiden.
„Ich kümmere mich ein bisschen um eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die keine Papiere haben. Für sie ist das eine Katastrophe. Ich kenne sie seit zwei Jahren. Sie sind zu mir zum Abendessen gekommen. Ich habe der Frau bei der Geburt geholfen. Zu wissen, dass sie sich ohne Papiere durchschlagen müssen, ist furchtbar schwer. Wir halten Kontakt, ich schicke ihnen manchmal etwas Geld, aber was hilft das schon. Immerhin haben sie eine Unterkunft bekommen, weil sie zwei kleine Kinder haben. Der Mann hat auf der Straße Leute angesprochen und gefragt, ob sie Arbeit für ihn haben. Manchmal hat das geklappt. Manchmal haben sie ihn arbeiten lassen und ihn dann nicht bezahlt. Und jetzt, mit Covid, geht gar nichts mehr. Es ist sehr, sehr hart.“
Eine Brücke der Menschlichkeit
Am folgenden Samstag ist Montgenèvre von dichtem Nebel umhüllt. Ein eisiger Wind pfeift durch das Bergdorf. Es ist vormittags. Die Freiwilligen von Tous Migrants haben zu einer Demonstration gegen die französische Grenzpolitik aufgerufen. Mehrere Hundert Menschen sind gekommen. Agnes – eine kleine, resolute Frau in ihren Fünfzigern – ist eines der Gesichter von Tous Migrants in der Öffentlichkeit.
Seit Jahrzehnten engagiert sie sich in der Region für Flüchtlinge. Die Wut über die Zustände an der Grenze ist ihr anzusehen. „Die Blicke der Kinder, wenn wir sie in den Bergen aufsammeln, sie verfolgen dich bis nach Hause. Es ist schwer, ein normales Leben zu haben, wenn du diese Blicke gesehen hast. Du fährst abends zurück ins Tal, und wem läufst du da über den Weg? Den Nachbarn, die keine Ahnung haben, was hier vor sich geht. Was hier in Montgenèvre passiert, ist eine andere Welt. Eine Freundin von mir, eine Journalistin, hat mal gesagt: Wenn ich nach Montgenèvre fahre, um Reportagen zu machen, fühle ich mich wie eine Kriegsreporterin. So ähnlich geht es mir auch. Allein wie viel Polizei, wie viel Militär hier versammelt ist.“

Agnès Antoine ist eines der Gesichter von Tous Migrants.© Deutschlandradio / Philipp Lemmerich
In wenigen Minuten soll auch von italienischer Seite ein Demonstrationszug ankommen. Gemeinsam wollen sie den Grenzübergang blockieren. Eine Brücke der Menschlichkeit bilden, wie sie es nennen. Grenzpolizei und Gendarmerie scheinen von den Plänen zu wissen. Mit Dutzenden Einsatzwagen stehen sie am Rand. „Wir bekämpfen diese Mauern jeden Tag. Dafür zahlen unsere Gefährten den Preis. Einige von ihnen sind wegen Beihilfe zur illegalen Einreise angeklagt.“ Der Demonstrationszug setzt sich in Bewegung. Vorbei an den leeren Skihotels, den stehenden Sesselliften, die leere Straße hinab in Richtung Grenzposten. Dort haben sich schon Einsatzkräfte bereitgemacht. In Kampfmontur und mit Schlagstöcken stehen sie dort. Ein Polizist ist mit einer Tränengaspistole bewaffnet.
„Wir sprechen hier von schwangeren Frauen, von Kindern, die die Grenze passieren. Bei den Menschen hier findet das kaum Gehör. Was wäre, wenn es weiße Frauen wären? Dann gäbe es viel mehr Empathie. Dieser ganze Diskurs in den Medien, über Einwanderung, die ‚große Umvolkung‘. Die Leute haben so viel Angst vor diesen Menschen, die zu uns kommen. Sie haben so viel Angst, dass sie deren Existenz verleugnen. Man verweigert diesen Menschen das Recht zu sein.“
Zwei Fluchthelfer vor Gericht
Wenig später kommt der italienische Demonstrationszug an. Gemeinsam blockieren die Demonstranten den Grenzübergang. Für zwei Stunden kommt kein Auto vorbei. Die Polizei lässt sie gewähren.

Für zwei Stunden blockieren die Demonstranten den Grenzübergang. Die Polizei lässt sie gewähren.© Deutschlandradio / Philipp Lemmerich
„Am 19. November wurden zwei unserer Mitstreiter festgenommen – mit einer afghanischen Familie, einem Kleinkind, einer schwangeren Frau. Sie wurden auf französischem Boden festgenommen und verbrachten 24 Stunden in Untersuchungshaft. Ihnen wird am 22. April in Gap der Prozess gemacht. Kommt am 22. April dorthin, um für sie zu protestieren! Und um der Regierung und der Justiz klarzumachen, das rein gar nichts unsere Solidarität mit Geflüchteten stoppen kann.“
Der Nebel ist nun noch dichter als am Vormittag. Die Polizei beobachtet die Demonstranten ganz genau. Die Berge sind in diesem Moment unbewacht. Gut möglich, dass einige Flüchtlinge das als einmalige Chance begreifen.