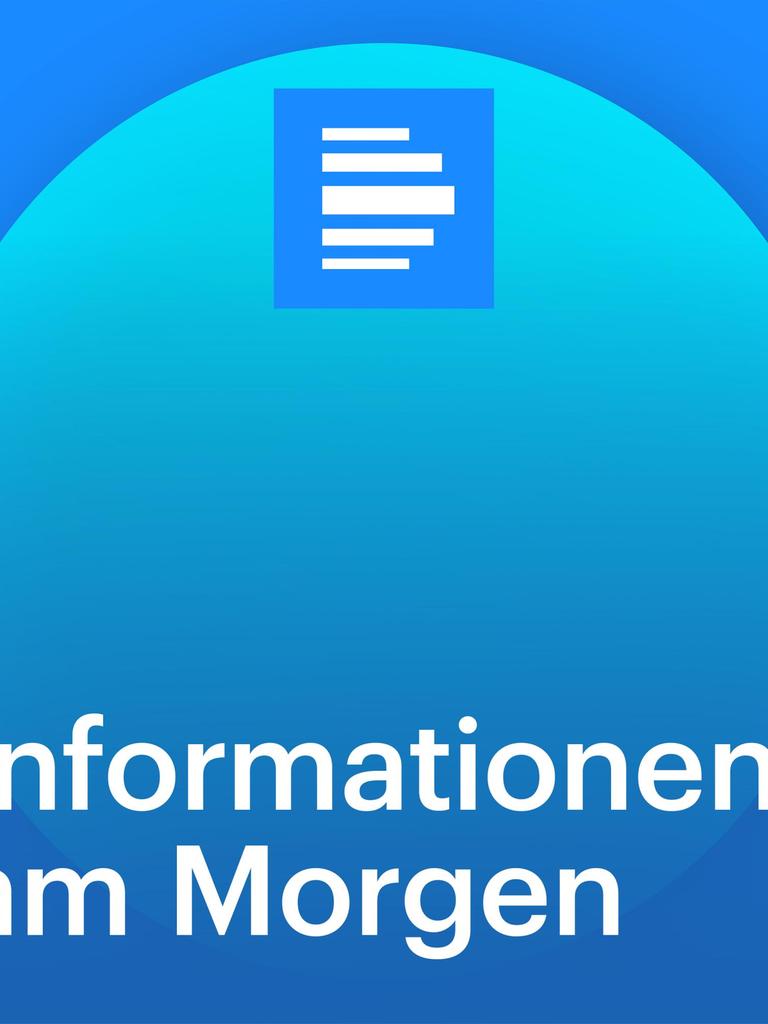Gewalt und Flucht in Afrika

Was sagen objektive Zahlen über das tatsächliche tägliche Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung aus? Nur sehr wenig, findet Afrikaexperte Tim Glawion. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Krista Larson
Zahlen allein können täuschen

Statistisches Zahlenmaterial verrät wenig über die Statistisches Zahlenmaterial verrät wenig über die alltägliche Gewalt in Afrikas Bürgerkriegsregionen. Um zu verstehen, warum Menschen von dort fliehen, muss deren subjektives Sicherheitsgefühl berücksichtigt werden, sagt Politologe Tim Glawion.
Ndélé ist eine entlegene Kleinstadt der Zentralafrikanischen Republik. Nur eine Staubpiste führt hierher. Ein gewöhnlicher Ort wie es sie zuhauf im ärmsten Land Afrikas gibt. Doch Ndélé ist alles andere als gewöhnlich: Seit Jahren kontrollieren Rebellen die Stadt.
Ein großes Kontingent der UN-Friedensmission hat sich deshalb in direkter Nähe einquartiert. Soldaten, die anderswo dringend gebraucht werden und so steht die Frage im Raum: Können sie abgezogen werden? Wichtige Grundlage der Entscheidung: die Sicherheitslage in dem Ort. Der erstaunliche Status, als ich 2019 dort Daten erhebe: null konfliktbezogene Tote in diesem Jahr. Und doch sagen mir die Menschen praktisch durch die Bank weg, dass sie sich unsicher fühlen. Paradox.
Was sagt die Zahl der Toten aus?
Subjektive Sicht und objektive Zahlen kommen also zu gegensätzlichen Einschätzungen der Lage Ndélés und damit auch zu widersprüchlichen Handlungsempfehlungen: Gilt Ndélé als sicher, kann man Friedenskontingente an dringendere Hotspots verlegen. Und Zahlen – in diesem Fall null Tote in einem Jahr – überzeugen Entscheider immer besonders schnell. Wichtig sei doch, wie viel Kriminalität oder Gewalt tatsächlich stattfindet, nicht wie die Menschen sich fühlen, heißt es häufig.
Diese objektive Sicherheit wird als das einzig Wahrhaftige angenommen. Subjektive Sicherheit hingegen nur als ein Ableger interpretiert. Als ein Blick, der durch die menschliche Unzulänglichkeit, unser begrenztes Wissen, manipulierende Nachrichten, oder eben unsere irrationalen Gefühle verzerrt würde. Eine Fehleinschätzung.
Unterschiedliches Verständnis von Sicherheit
Die objektive Sicht auf die Sicherheitslage blickt von der Vergangenheit bis hin zur Gegenwart. Selbst Aussagen über die Zukunft sind Fortschreibungen der Vergangenheit unter Annahme von Kausalität und Rationalität. Die subjektive Sicht hingegen umfasst häufig eine Erwartung für die Zukunft, die nicht zwingend aus dem bereits Erlebten abgeleitet wird, sondern mit Wünschen und Hoffnung verbunden wird.
Das Problem: Wenn Akteure mit unterschiedlichem Sicherheitsverständnis miteinander verhandeln, prallen zwei grundverschiedene Welten aufeinander. Jene, die die Welt der Vergangenheit in Zahlen beschreiben und jene, die die Zukunft mit ihren Empfindungen ausmalen. Missverständnisse und Frust liegen auf der Hand. Und die Priorisierung der objektiven Sicherheitslage kann zu Fehleinschätzungen führen.
Bevölkerung fühlte sich im Stich gelassen
Wie in Ndélé. Die Friedensmission vor Ort sah keinen Grund, gegen die herrschenden Rebellen vorzugehen. Im Gegenteil fürchteten hochrangige Kommandeure, eine Durchsetzung ihres Mandats würde Gewalt erst lostreten – es passierte ja de facto gerade nichts.
Die Bevölkerung hingegen protestierte gegen die Blauhelme, da sie ihr Unsicherheitsgefühl nicht ernst genommen sahen und sich keine Zukunft mit den Rebellen vorstellen konnten.
Subjektive Wahrnehmung als wichtige Ergänzung
Subjektive Unsicherheit sollte also niemals als Gefühlsduselei abgeschrieben werden. Häufig zeugt sie von tiefem Verständnis der herrschenden Verhältnisse und von dem, was kommen mag: Ein Jahr nach meiner Datenerhebung in Ndélé wurde die Stadt zum größten Konfliktherd des Landes, Dutzende Zivilisten wurden getötet und praktisch die gesamte Stadtbevölkerung floh.
Was also tun? Forschung und Politik, die objektiv messbare Kriminalität und Gewalt verstehen und reduzieren möchte, ist selbstverständlich wichtig. Aber sie muss durch die Erforschung der subjektiven Sicht mit angemessenen, qualitativen Methoden ergänzt werden. Nur eine Kombination beider Ansätze verheißt eine seriösere Beurteilung der jeweiligen Sicherheitslage. Und die ist in vielen Fällen für die politische Entwicklung eines Landes grundlegend.