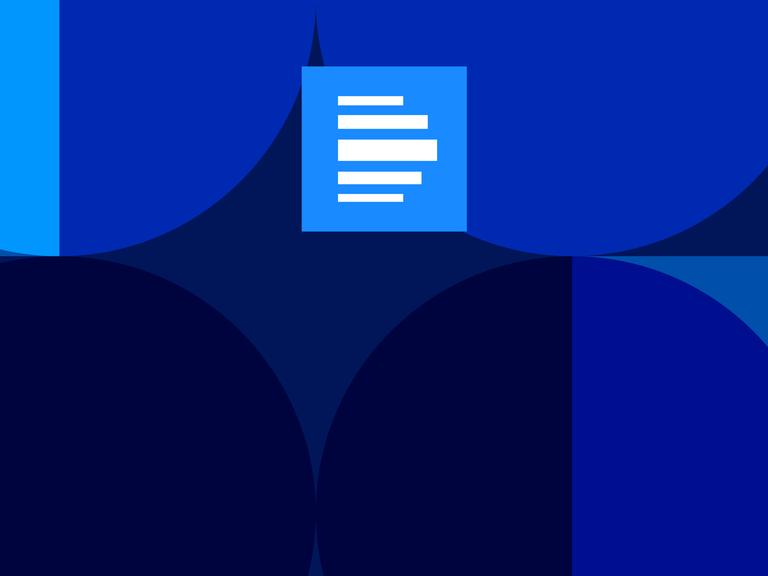"Wir müssen sie als Immigranten betrachten"
Langfristige Perspektiven bieten! Der Kölner Soziologe Jürgen Friedrichs fordert Städte und Gemeinden dazu auf, sich darauf einzustellen, Asylbewerber nicht nur kurze Zeit zu beherbergen. Allerdings sollten Unterkünfte mit Bedacht gewählt werden.
Der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab, immer mehr verzweifelte Menschen kommen nach Europa, um hier Sicherheit und Schutz vor Krieg, politischer Verfolgung oder bitterer Armut zu finden.
Auch Deutschland wird in den kommenden Wochen und weitere Flüchtlinge aufnehmen müssen. Doch sind die Kommunen überhaupt darauf vorbereitet? Nach Meinung des Kölner Soziologen Jürgen Friedrichs sollten sich die Städte und Gemeinden darauf einstellen, Asylbewerber nicht nur kurze Zeit zu beherbergen, sondern ihnen auch langfristige Perspektiven zu bieten.
"Ich denke, dass wir einen Riesenfehler machen, wenn wir diejenigen, die jetzt als Flüchtlinge zu uns kommen, als Personen betrachten, die nach kurzer Zeit wieder in ihr zerrüttetes Heimatland zurückkehren werden. Wir müssen sie als Emigranten betrachten."
Den soziale Frieden nicht gefährden
Friedrichs, dessen Spezialgebiet Stadtsoziologie ist, sagte: Viele Kommunen hätten jedoch große Probleme, geeignete Standorte für Flüchtlingsunterkünfte zu finden. Oft gebe es Protest seitens der Verwaltung, wenn lukrative Grundstücke, die an Investoren verkauft oder vermietet werden könnten, statt dessen für Unterkünfte genutzt werden sollten. Auch müsse darauf geachtet werden, dass in bestimmten Wohngebieten der Anteil der Flüchtlinge an der Bevölkerung nicht mehr als ein Prozent betrage, um den sozialen Frieden zu gewährleisten. Als gut geeignet hätten sich Mittelschichtswohngebiete herausgestellt.

In Hattersheim-Eddersheim im Main-Taunus-Kreis wird eine ehemalige Schule zu einem Flüchtlingsheim umfunktioniert.© imago stock & people
Ein Musterbeispiel für ein kluges, vorausschauendes Vorgehen sei die Stadt Münster, die frühzeitig
"in einer Diskussion zwischen Bürgermeister und einzelnen Dezernaten 27 Standorte in der Stadt auf ihre Tauglichkeit hin untersucht und davon elf ausgewählt hat. Und das Spannende ist, dass man geguckt hat: Was gibt es an der Stelle für eine Infrastruktur? Also, können die Leute von dort aus mit Verkehrsmitteln in die Innenstadt gelangen, gibt es Schulen in der Nähe, gibt es Kitas? Und man hat auch gefragt: Wie hoch ist das Konfliktpotenzial mit der Bevölkerung? Das ist sicherlich ein mustergültiges Verfahren."
Friedrichs sage weiter, er schließe auch ländliche Gebiete für die Unterbringung nicht aus - solange diese über vernünftige Infrastrukturen verfügten. Fest stehe:
"Die Kommunen müssen das Problem vordringlich behandeln, denn wir können die Leute ja nicht im Meer ertrinken lassen."
Das Interview im Wortlaut
Nana Brink: Wie auch immer die Unterbringung der Flüchtlinge nun vonstatten gehen soll, die EU-Innenminister haben sich ja gestern Abend nicht wirklich geeinigt, und es ist klar, es werden mehr kommen, und wir werden uns Gedanken machen müssen, wo und wie wir sie unterbringen. In Deutschland haben über 200.000 Menschen im letzten Jahr einen Asylantrag gestellt, und wir wissen, dass noch viele Hunderttausende im Libanon oder auch in Syrien darauf warten, nach Europa zu kommen. Wie also können wir diese schutzbedürftigen Menschen aufnehmen, ohne dass große Konflikte mit der Bevölkerung entstehen? Professor Jürgen Friedrichs ist ein Stadtsoziologe, er forscht derzeit genau zum Thema Flüchtlingsunterbringung. Ich grüße Sie, Herr Friedrichs!
Jürgen Friedrichs: Guten Morgen, Frau Brink!
Brink: Machen wir mal den Vergleich auf mit den 60er-Jahren. Da nannte man sie Gastarbeiter. Sie sind zu uns gekommen, auch um zu bleiben. Haben wir aus dieser Geschichte etwas gelernt?
Friedrichs: Ich hoffe. Im Augenblick bin ich sehr unsicher. Aus der Geschichte hatte man lernen können, dass sie eben nicht eine rotierende Gruppe von Arbeitern waren, die in schlechten Unterkünften Geld nach Hause schickten und dann nach drei Jahren wieder nach Hause gehen sollten, sondern dass ein großer Teil von ihnen in der Tat Immigranten waren und dann nachher ihre Familien nachzogen.
Und ich denke, dass wir einen Riesenfehler machen, wenn wir diejenigen, die jetzt als Flüchtlinge zu uns kommen, als Personen betrachten, die nach kurzer Zeit wieder in ihr zerrüttetes Heimatland zurückkehren werden. Wir müssen sie als Immigranten betrachten.
Brink: Nun haben wir ja das große Problem, oder wir hören von vielen Gemeinden, dass sie überfordert sind. Überfordert damit, Grundstücke zu finden, überfordert damit, auch die Flüchtlinge zu versorgen. Gibt es denn auch positive Beispiele, die irgendwie Hoffnung machen, wie so etwas funktionieren könnte?
Friedrichs: Also erst mal möchte ich betonen, was Sie sagen: Die Gemeinden sind überfordert, weil man über lange Zeit nicht geahnt hat, in den Zehnerjahren, dass eine solche Zahl von Flüchtlingen noch kommen würde. Man hat gedacht, der Flüchtlingsstrom ebbt ab. Es gibt sicher Beispiele, wo Kommunen das sehr gut hinbekommen.
Ein Beispiel möchte ich gern zitieren, das ist die Stadt Münster, die erstens einmal die große Chance hatte, im Jahr 2000 Grundstücke vorzuhalten für diesen Zweck, trotz der sinkenden Zahl der Flüchtlinge. Und dann in einem Verfahren der Mediation und der gemeinsamen Diskussion zwischen Bürgermeistern und einzelnen Dezernaten 27 Standorte in der Stadt untersucht hat auf ihre Tauglichkeit hin und davon elf ausgewählt hat. Und das Spannende ist, dass man nun gesagt hat, wir gucken, was gibt es an der Stelle für eine Infrastruktur, also, können die Leute von dort aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt gelangen? Gibt es Schulen in der Nähe, gibt es Kitas in der Nähe? Und hat auch gefragt, wie groß ist das Konfliktpotenzial mit der Bevölkerung.
Und unter diesen ganzen Merkmalen hat man dann die Standorte untersucht und dann von den 27 elf ausgewählt. Das ist sicher ein mustergültiges Verfahren.
Sozialen Sprengstoff vermeiden
Brink: Was heißt denn Problem mit der Bevölkerung? Wie passiert das?
Friedrichs: Da hat man mit Sozialarbeitern gesprochen und hat gesagt, es darf nicht mehr als ein Prozent der Wohnbevölkerung Flüchtlinge sein, und hat eben auch überlegt, ob man in Gebieten, in denen wir einen hohen Anteil von Arbeitslosen haben oder von ärmeren Bevölkerungsteilen haben, dass man in diese Gebiete nicht geht mit den Flüchtlingsheimen.
Und das, denke ich, ist eine richtige Überlegung, denn eine wichtige Erkenntnis aus der ganzen Migrationsforschung ist natürlich, dass je weniger gebildet eine Person ist und je eher es eine arbeitslose Person ist, desto eher hat sie das Gefühl der ethnischen Bedrohung, also der wirtschaftlichen und kulturellen Bedrohung durch die Minderheit. Also wird man in solche Gebiete nicht gehen können. Man wird im allgemeinen Sinne in Mittelschichtswohngebiete gehen.
Brink: Ich wollte nämlich gerade sagen, ich hätte jetzt das andere Beispiel aufgemacht, denn in sogenannten Villengegenden ist es doch wahrscheinlich auch problematisch.
Friedrichs: Das würden wir gerne wissen. Dazu haben wir keine Erfahrungen. Das Beispiel, das im Augenblick ansteht, ist ein Gebäude, ein ehemaliges Kreiswehrersatzamt in Hamburg-Harvestehude, wo in der Tat 200 Flüchtlinge in ein ausgesprochen oberes Mittelschichtswohngebiet mit Eigentumswohnungen um die 8.000 Euro pro Quadratmeter ziehen sollen. Und ob das klappt oder nicht klappt, wird man sehen. Ich bin skeptisch.
Brink: Nun haben Sie am Anfang gesagt, es ist eigentlich das A und O, diesen tauglichen Standort zu finden. Wie findet man den?
Friedrichs: Ich glaube, die meisten Kommunen haben das Problem, dass sie überhaupt nicht genügend Standorte haben, unter denen sie überhaupt nur wählen können. Im Augenblick geht es ja um Turnhallen, um Jugendheime und Hotels. Wie findet man den? Man wird einen Standort wählen müssen, indem man sagt, haben wir hier eine gemischte Wohnbevölkerung, von der man noch annehmen kann, dass sie toleranter sind, und von denen man auch annehmen kann, dass sie der Bevölkerung helfen.
Also man geht in eine gemischtes Wohngebiet erst mal generell und schneidet sozusagen die oberen und unteren Enden der Einkommenspyramide weg. Das wäre eine Lösung, vorausgesetzt, sie haben Standorte. Das ist das Problem der Kommunen, überhaupt Grundstücke oder Gebäude zu finden, in die sie die Flüchtlinge unterbringen können.
Die schwierige Suche nach einem Standort
Brink: Gibt es da auch Konkurrenz zu anderen Bauvorhaben dann, oder warum ist das so schwierig?
Friedrichs: Es ist deshalb sicher so schwierig, weil ja der Kämmerer sagen kann, wenn wir dieses Grundstück für ein Flüchtlingsheim nehmen, dann entgeht uns die Möglichkeit, es an einen Investor zu verkaufen, der dort Eigentumswohnungen baut. Oder entgeht uns die Möglichkeit, dort ein Altenheim zu errichten. Das heißt, es gibt immer konkurrierende Nutzungen, und natürlich ist die Nutzung, jetzt eine Flüchtlingsheim dorthin zu bauen, für die Stadt die schwierigste von allen. Weil sie sagt, das andere wäre vielleicht sinnvolle. Man könnte ja auch sozialen Wohnungsbau dort errichten. Aber danach geht es im Augenblick ja leider nicht.
Brink: Also wenn wir sagen, es gibt also größere Probleme in der Stadt, ist es dann eher sinnvoller, in ländliche Gebiete zu gehen?
Friedrichs: Das ist umstritten. Wahrscheinlich kann man das machen, wenn eine vernünftige Infrastruktur da ist, und das ist, denke ich, auch vorhanden. Also, wenn die Einkaufsmöglichkeiten da sind, Schulen da sind, Kinderspielplätze da sind, warum soll man dann nicht auch in ländliche Gegenden gehen? Insgesamt ist es aber wohl im Augenblick sinnvoll, in den Städten zu suchen und die Flüchtlinge in den Städten unterzubringen.
Brink: Was empfehlen Sie denn den Gemeinden, um dieses Problem auch irgendwie anzugehen?
Friedrichs: Langfristig zu planen, davon auszugehen, dass noch mehr Grundstücke und Gebäude benötigt werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren, und dass sie das Flüchtlingsproblem vorrangig behandeln müssen, denn wir können die Leute ja nicht im Meer ertrinken lassen.
Brink: Jürgen Friedrichs, Professor für Soziologie. Er beschäftigt sich seit Langem mit dem Thema Flüchtlingsunterbringung. Vielen Dank, Herr Friedrichs, für das Gespräch!
Friedrichs: Bitte!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.