Autor: Sven Kästner
Sprecherin und Sprecher: Nina West und Robert Frank
Regie: Klaus-Michael Klingsporn
Technik: Ralf Perz
Redaktion: Martin Mair
Wie die Wirtschaft die Wissenschaft beeinflusst
29:56 Minuten

Wirtschaftsunternehmen finanzieren Professuren an Universitäten oder bezahlen dort einzelne Forschungsprojekte. Nur so sei Spitzenforschung möglich, sagen Befürworter der Kooperationen. Aber gefährdet das nicht die Unabhängigkeit der Forschung?
Erbgutveränderungen per Gentechnik, die Welt der Plasmaphysik, unendliche schwarze Löcher oder Hörtests für Pinguine – die Welt der Wissenschaft ist vielfältig. Und sie ist aufwändig und teuer. Gut 18 Milliarden Euro haben allein die deutschen Hochschulen 2018 für Forschung ausgegeben. Aber die Zeiten sind vorbei, in denen die Bundesländer ihre Hochschulen komplett finanzierten. Woher also kommt das Geld für die Forschung?
Technische Universität München, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik: Das Reich von Gerhard Kramer. Der Professor für Nachrichtentechnik führt mit schelmischem Lächeln durch ein enges Büro: vier Schreibtische mit Computern, dazwischen Bücher- und Papierstapel. An der Wand hängen weiße Tafeln, übersät mit handgeschriebenen Formeln.
Technische Universität München, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik: Das Reich von Gerhard Kramer. Der Professor für Nachrichtentechnik führt mit schelmischem Lächeln durch ein enges Büro: vier Schreibtische mit Computern, dazwischen Bücher- und Papierstapel. An der Wand hängen weiße Tafeln, übersät mit handgeschriebenen Formeln.
"So klassische Messies – vier Doktoranden. Wenn Sie schauen: Die Bücher, die Sie sehen, sind Masterarbeiten, wissenschaftliche Paper, mathematisches Gekritzel. Übrigens Huawei-Projekt – sehr interessant." Mit Unterstützung der Industrie forscht die öffentliche Uni hier an stabileren Internetverbindungen. Die Wissenschaftler entwerfen Algorithmen, mit denen sie unter anderem die globale Datenübertragung per Kabel verbessern wollen. Erst vor Kurzem haben sie ein Projekt beendet.
"Hier war der Gewinn mehr in der Distanz, die man übertragen konnte. Was wichtig ist, wenn man Distanzen wie zum Beispiel durch den Pazifischen Ozean hat. Auch wenn man da nur zehn Prozent weiterkommt oder fünfzehn Prozent weiter, dann sind das mehrere tausend Kilometer."
"Hier war der Gewinn mehr in der Distanz, die man übertragen konnte. Was wichtig ist, wenn man Distanzen wie zum Beispiel durch den Pazifischen Ozean hat. Auch wenn man da nur zehn Prozent weiterkommt oder fünfzehn Prozent weiter, dann sind das mehrere tausend Kilometer."
Forschung braucht teure Technik
Solche Erkenntnisse sind für Telekommunikationsunternehmen bares Geld wert. Verschiedene Firmen der Branche entwickeln die Technologien. Oft kooperieren sie dabei mit Universitäten. Kramers Lehrstuhl an der TU München arbeitet etwa mit dem Netzwerkanbieter Nokia zusammen. Die Forschenden brauchen teure Technik, aber die öffentliche Finanzierung der Hochschulen ist knapp bemessen.
"Die Doktoranden waren dann auch an einem Labor in Stuttgart. Wo sie selber die Geräte haben, die sehr teuer sind. Das können wir uns nicht leisten. Auch die neuen Algorithmen, die entwickelt wurden, wurden auf diesem Equipment ausprobiert."
Nokia bezahlt regelmäßig zwei Doktoranden. Einen stellt das Unternehmen selbst an. Ein zweiter ist formal Mitarbeiter der Uni, die dessen Gehalt aber von Nokia bekommt. Diese sogenannten Industrie-Promotionen sind weit verbreitet – aus Sicht von Gerhard Kramer bieten sie Vorteile für beide Seiten.
"Die Doktoranden waren dann auch an einem Labor in Stuttgart. Wo sie selber die Geräte haben, die sehr teuer sind. Das können wir uns nicht leisten. Auch die neuen Algorithmen, die entwickelt wurden, wurden auf diesem Equipment ausprobiert."
Nokia bezahlt regelmäßig zwei Doktoranden. Einen stellt das Unternehmen selbst an. Ein zweiter ist formal Mitarbeiter der Uni, die dessen Gehalt aber von Nokia bekommt. Diese sogenannten Industrie-Promotionen sind weit verbreitet – aus Sicht von Gerhard Kramer bieten sie Vorteile für beide Seiten.
"Wir erhalten dafür ein gewisses Geld. Wofür wir dann auch gewisse Freiheiten gewinnen für verschiedenes: Möbel zu kaufen – als banales Beispiel. Weitere Promotionen zu betreuen unter Umständen. Diplomarbeiten werden dadurch generiert, Bachelorarbeiten, Kontakt zwischen den verschiedenen Forschern. Forschung ist ja eine Community-Arbeit. Und für die Firmen, die bekommen dann gute Mitarbeiter, haben Kontakte an die Universitäten. Und auch, klar, Patente und Ideen bekommen sie auch. Das ist ein Teil der Abmachung."

Ohne Drittmittel sei aufwendige Forschung oft nicht möglich, meint Ingenieur Gerhard Kramer. Er lehrt an der TU München.© Deutschlandradio / Sven Kästner
Wem gehören die Forschungsergebnisse?
Hier zeigt sich der erste Konflikt: Wem gehören die Forschungsergebnisse, wenn ein Unternehmen die wissenschaftliche Arbeit mitfinanziert?
Die Hochschuletats setzen sich aus verschiedenen Quellen zusammen. Für die Grundfinanzierung sind die Bundesländer zuständig. Sie überwiesen 2018 insgesamt gut 25 Milliarden Euro. Dazu kamen rund fünf Milliarden vom Bund. Damit bezahlen die Hochschulen ihre Lehre und einen Teil ihrer Grundlagenforschung. Weil die Studierendenzahlen seit Jahren steigen, wird der Finanzbedarf für die Lehre größer. Im Gegenzug sinkt der Anteil für die Forschung. Deshalb bemühen sich die Hochschulen um zusätzliche Quellen, sogenannte Drittmittel.
Die Hochschuletats setzen sich aus verschiedenen Quellen zusammen. Für die Grundfinanzierung sind die Bundesländer zuständig. Sie überwiesen 2018 insgesamt gut 25 Milliarden Euro. Dazu kamen rund fünf Milliarden vom Bund. Damit bezahlen die Hochschulen ihre Lehre und einen Teil ihrer Grundlagenforschung. Weil die Studierendenzahlen seit Jahren steigen, wird der Finanzbedarf für die Lehre größer. Im Gegenzug sinkt der Anteil für die Forschung. Deshalb bemühen sich die Hochschulen um zusätzliche Quellen, sogenannte Drittmittel.
Peter-André Alt kennt die Entwicklung aus seiner Zeit als Präsident der Freien Universität Berlin. Heute ist der Literaturwissenschaftler Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, die die Interessen der deutschen Hochschulen vertritt.

Drittmittel gewinnen immer mehr an Bedeutung, sagt Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. © picture alliance / Tagesspiegel / Thilo Rückeis
"Die Drittmittel spielen eine stetig wachsende Rolle in der Gesamtfinanzierung der Hochschulen. In der Forschung können die wenigsten Hochschulen die großen Projekte, die sie verfolgen wollen, aus ihren Grundmitteln bestreiten. Daher brauchen sie zusätzliche Förderung. Übrigens nicht nur durch öffentliche Stiftungen, sondern auch durch Wirtschaftspartner. Die spielen nicht eine so große Rolle wie in manchen anderen Ländern. Aber sie sind bedeutsam, auch in Deutschland."
Hochschulen sollten wettbewerbsfähiger gemacht werden
Bis in die 1990er-Jahre erhielten die staatlichen Hochschulen fast ihren gesamten Etat von den Bundesländern. Seither ist ein immer größerer Anteil an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) umgeleitet worden. Die Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft ist heute der größte Drittmittelgeber. Sie verteilt Geld aus den öffentlichen Haushalten, um das die Hochschulen mit konkreten Forschungsvorhaben konkurrieren müssen. Das war auch die politische Idee hinter dem Umbau des Finanzierungssystems.
"Ein Hochschulkonzept, das vor allen Dingen darauf abzielte, die Hochschulen auch wettbewerbsfähiger zu machen, international wettbewerbsfähiger. Und das ging davon aus, dass die Hochschulen eben ihre Forschungsleistungen mit Partnern erbringen sollen. Oder aber in einem Wettbewerb um öffentliche Förderung. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Partnerschaften mit der Wirtschaft, die ja auch eine Art Wettbewerb sind."
Aus den Unternehmenskassen flossen 2018 laut Statistischem Bundesamt 1,3 Milliarden Euro in Forschungsprojekte staatlicher Hochschulen. Das entspricht einem Fünftel aller Drittmittel für die Forschung. Auch um dieses Geld müssen sich die Wissenschaftler bewerben. Während DFG oder öffentliche Stiftungen oft Grundlagenforschung finanzieren, konzentrieren sich die Industrie und deren Stiftungen auf anwendungsnahe Forschungsprojekte aus dem technischen oder medizinischen Bereich.

Mehr Studierende bedeutet, mehr Geld für Lehre – und somit weniger öffentliche Gelder für Forschung.© dpa / Oliver Berg
Lidl-Stiftung finanziert zahlreiche Lehrstühle
Die TU München wirbt sehr erfolgreich um Geld aus privaten Quellen: Allein 2019 erhielt sie 88 Millionen Euro. Damit kam ein Viertel ihrer gesamten Drittmittel aus der Wirtschaft oder von anderen privaten Geldgebern. Zusätzlich flossen 16 Millionen für Stiftungsprofessuren. Das sind Lehrstühle, die eine Firma oder eine Stiftung über mehrere Jahre bezahlt. Keine Münchner Spezialität – deutschlandweit gibt es mehr als 800 solcher privat geförderteter Professuren.
"Wir müssten ja verrückt sein, wenn wir diese Chance nicht wahrnehmen für unsere jungen Leute, die auf diese Weise konditioniert werden für die Wirtschaft, wo sie später mal hingehen und ihr Geld verdienen. Das ist das normalste von der Welt", erklärte im Februar 2018 der damalige Präsident der TU München, Wolfgang Herrmann.
"Wir müssten ja verrückt sein, wenn wir diese Chance nicht wahrnehmen für unsere jungen Leute, die auf diese Weise konditioniert werden für die Wirtschaft, wo sie später mal hingehen und ihr Geld verdienen. Das ist das normalste von der Welt", erklärte im Februar 2018 der damalige Präsident der TU München, Wolfgang Herrmann.
Die Universität hatte gerade ihren bis dahin größten Deal mit der Dieter-Schwarz-Stiftung abgeschlossen. Der Lidl-Gründer finanziert über Jahrzehnte 20 Wirtschaftsprofessuren. Mit einem Schlag wuchs die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät auf 54 Lehrstühle. Doch um welchen Preis?
Arbeitgebernah und industriefreundlich
Christian Kreiß hat sich gegen eine Stiftungsprofessur entschieden. Der frühere Investmentbanker lehrt heute Volkwirtschaft an der Hochschule Aalen. Einen Lehrstuhl für Investmentbanking in München lehnte er vor einigen Jahren ab, weil dieser von einer Unternehmensberatung gestiftet wurde.
"Ich kannte dann zumindest die ersten zwei Bewerber. Das waren natürlich ganz starke Befürworter für Investmentbanking und von Unternehmensberatern. Da kamen zufällig keine Leute, die jetzt irgendwie das infrage stellen. Es gibt einfach viele, viele Beispiele, wo diese Stiftungsprofessuren, die von Industrieunternehmern oder von Arbeitgeberverbänden gesponsert sind, dass da Menschen letztlich drauf kommen, die sehr arbeitgebernah, sehr industriefreundlich sind."
In zwei Büchern hat sich Kreiß mit dem Einfluss von Unternehmen auf die Wissenschaft beschäftigt und teils haarsträubende Fälle dokumentiert. Er misstraut unter anderem der Pharmaforschung mittlerweile so sehr, dass er bei den sogenannten Querdenken-Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen auftritt. Sein Hauptkritikpunkt in Sachen Drittmittel: Die staatlichen Hochschulen seien immer stärker auf Geld aus der Industrie angewiesen.

Sieht die Verwendung von Drittmitteln kritisch: der Ökonom Christian Kreiß.© Deutschlandradio / Sven Kästner
Umweltorganisationen können keine Professur finanzieren
Andere Organisationen hätten nicht die finanziellen Möglichkeiten, eine Professur zu finanzieren – etwa im Bereich Umweltschutz oder fairem Handel.
"Das Geld, Herr Schwarz, die Lidl-Stiftung bestimmt dann letztlich unsere Forschungslandschaft. Und nicht mehr die Bürgerinteressen, nicht mehr die Politik. Sondern wir kriegen so ein geld-aristokratisches System: Worüber wird geforscht? Und vor allem: Worüber wird nicht geforscht?"
Die Kritik an den Lidl-Professuren konterte die TU München seinerzeit mit ihrem "Code of Conduct" – darin legte die Universität Grundsätze für Unternehmenskooperationen fest. Es geht um die Unabhängigkeit der Wissenschaft, um das Verhalten bei Interessenskonflikten oder um Wissenschaftsethik. Allerdings zeigte sich schnell: Dieses Regelwerk allein reicht offenbar nicht aus.
"An der Technischen Universität München wird es ein neues Institut geben, das sich mit ethischen Standards für Künstliche Intelligenz beschäftigt. Hauptsächlich finanziert wird es ausgerechnet von – Facebook."
"Das Geld, Herr Schwarz, die Lidl-Stiftung bestimmt dann letztlich unsere Forschungslandschaft. Und nicht mehr die Bürgerinteressen, nicht mehr die Politik. Sondern wir kriegen so ein geld-aristokratisches System: Worüber wird geforscht? Und vor allem: Worüber wird nicht geforscht?"
Die Kritik an den Lidl-Professuren konterte die TU München seinerzeit mit ihrem "Code of Conduct" – darin legte die Universität Grundsätze für Unternehmenskooperationen fest. Es geht um die Unabhängigkeit der Wissenschaft, um das Verhalten bei Interessenskonflikten oder um Wissenschaftsethik. Allerdings zeigte sich schnell: Dieses Regelwerk allein reicht offenbar nicht aus.
"An der Technischen Universität München wird es ein neues Institut geben, das sich mit ethischen Standards für Künstliche Intelligenz beschäftigt. Hauptsächlich finanziert wird es ausgerechnet von – Facebook."
Vereinbarungen werden geheim gehalten
Wie genau Künstliche Intelligenz, die selbst lernt und sich vernetzt, sinnvoll zu unserem Wohl eingesetzt werden kann, daran will das neue Institut forschen. Der Leiter Professor Christoph Lütge sieht kein Problem in der Finanzierung durch Facebook:
"Es gibt überhaupt keine Vorgaben und keine Auflagen seitens Facebook. Sondern wir bekommen dieses Geld, um unabhängige Forschung zu finanzieren. Sonst würde ich es auch nicht machen."
7,5 Millionen US-Dollar stellt Facebook dem neu gegründeten Institut in Aussicht. Und der Konzern verbindet damit klare Erwartungen. Eigentlich sollte die Vereinbarung mit der TU München geheim bleiben, doch sie kam Ende 2019 an die Öffentlichkeit. Darin heißt es:
"Wir erwarten, dass die TU München das Geschenk zum Aufbau von Grundlagenforschung und verbundener Lehre im TUM-Institut für Ethik in der Künstlichen Intelligenz nutzen wird. Prof. Dr. Christoph Lütge wird Gründungsdirektor."
"Schlüsselposition ist eben der Institutsleiter. Der setzt dann im Wesentlichen die Forschungsprogramme auf. Es gibt auch ein Gremium dazu, ja. Aber die Schlüsselfigur dazu ist trotzdem der Institutsleiter, der maßgeblich mitbestimmt, was auf die Forschungsagenda kommt – und was nicht auf die Agenda kommt."
7,5 Millionen US-Dollar stellt Facebook dem neu gegründeten Institut in Aussicht. Und der Konzern verbindet damit klare Erwartungen. Eigentlich sollte die Vereinbarung mit der TU München geheim bleiben, doch sie kam Ende 2019 an die Öffentlichkeit. Darin heißt es:
"Wir erwarten, dass die TU München das Geschenk zum Aufbau von Grundlagenforschung und verbundener Lehre im TUM-Institut für Ethik in der Künstlichen Intelligenz nutzen wird. Prof. Dr. Christoph Lütge wird Gründungsdirektor."
"Schlüsselposition ist eben der Institutsleiter. Der setzt dann im Wesentlichen die Forschungsprogramme auf. Es gibt auch ein Gremium dazu, ja. Aber die Schlüsselfigur dazu ist trotzdem der Institutsleiter, der maßgeblich mitbestimmt, was auf die Forschungsagenda kommt – und was nicht auf die Agenda kommt."
Wer zahlt, hat Einfluss
Aus Sicht von Christian Kreiß ist das nur einer der Hebel, mit dem Facebook in die Arbeit des Instituts eingreift. Der andere findet sich ebenfalls in der Vereinbarung zwischen dem US-Konzern und der TU München: Die Fördersumme gibt es nicht auf einmal, sondern in fünf jährlichen Raten.
"Nach der Zahlung für 2019 kann Facebook nach eigenem Ermessen fortfahren oder mit zukünftiger Wirkung kündigen. Facebook wird die finanzielle Unterstützung jedes Jahr vor dem 30. November für das folgende Jahr schriftlich bestätigen."
In dieser jährlichen Kündigungsmöglichkeit sieht Kritiker Kreiß ein finanzielles Druckmittel. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hätten so automatisch eine Schere im Kopf.
"Man kann sagen: Die Forscher sind vollkommen unabhängig, frei, können forschen, worüber sie wollen. Wir haben keinen Maulkorb. Wir haben keine Gängelung. Wir haben keine Kontrolle. Das stimmt alles. Weil: Die Konstruktion stellt von alleine schon sicher, dass niemals Ergebnisse rauskommen, die facebookkritisch sind. Vielleicht im fünften Jahr, wenn die Mittel ausgelaufen sind. Aber dann hofft man natürlich vermutlich in irgendeiner Form auf eine Anschlussfinanzierung."
"Nach der Zahlung für 2019 kann Facebook nach eigenem Ermessen fortfahren oder mit zukünftiger Wirkung kündigen. Facebook wird die finanzielle Unterstützung jedes Jahr vor dem 30. November für das folgende Jahr schriftlich bestätigen."
In dieser jährlichen Kündigungsmöglichkeit sieht Kritiker Kreiß ein finanzielles Druckmittel. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hätten so automatisch eine Schere im Kopf.
"Man kann sagen: Die Forscher sind vollkommen unabhängig, frei, können forschen, worüber sie wollen. Wir haben keinen Maulkorb. Wir haben keine Gängelung. Wir haben keine Kontrolle. Das stimmt alles. Weil: Die Konstruktion stellt von alleine schon sicher, dass niemals Ergebnisse rauskommen, die facebookkritisch sind. Vielleicht im fünften Jahr, wenn die Mittel ausgelaufen sind. Aber dann hofft man natürlich vermutlich in irgendeiner Form auf eine Anschlussfinanzierung."
Was aber bringt dem amerikanischen Social-Media-Riesen der Einfluss auf das deutsche Institut? Der Mainzer Philosoph Thomas Metzinger schrieb in einem Essay für den Berliner "Tagesspiegel", die Industrie organisiere ethische Debatten, um Zeit zu kaufen, die Öffentlichkeit abzulenken und auf diese Weise wirksame Regulierungen der Politik auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz zu verschleppen. Auch an der TU München wird vorsichtig Kritik an der Vereinbarung mit Facebook geäußert.
"Ich wünschte, diese Verträge wären auch ein bisschen vorsichtiger geschrieben worden. Weil: Es hatte schon Text, der leider da ein bisschen nicht so eindeutig war, wie wir es eigentlich haben wollten."
Gerhard Kramer ist seit Juli 2019 als geschäftsführender Vizepräsident auch für die Forschungsförderung zuständig.
"Man kann es auch gut verstehen, dass man von außen denkt: Ja, die Firma versucht jetzt nur, sich selber reinzuwaschen und durch eine Universität ihr Image zu verbessern. Auf der anderen Seite haben wir auch wieder unseren Auftrag, die Zusammenarbeit zwischen uns und auch Firmen – diesen haben wir wahrzunehmen."

Umstritten wegen Kooperationen zwischen Wirtschaft und Forschung: das neu gegründete Cyber Valley.© dpa / Marijan Murat
Wissenschaftsfreiheit in Gefahr
Wenn private Geldgeber direkten Einfluss auf die Gestaltung öffentlicher Forschung nehmen, widerspricht das der Wissenschaftsfreiheit. Auf die achtet unter anderem Transparency International. Peter Büttner pflegt für den Anti-Korruptionsverein das Portal Hochschulwatch, das Hunderte Projekte von Hochschulen und Industrie auflistet. Viele seien unproblematisch, sagt Büttner. Doch die Grenze zu Korruption ist fließend.
"Ich denke nicht, dass es allein dann Korruption genannt werden kann, wenn Geld fließt. Sondern wenn Vorteile gewährt werden, die im gewissen Maße also Prestige oder geldwerte Sachen darstellen. Und da gibt es genug Beispiele, dass die Anträge, die die Professoren stellen, bestimmte Themen zu fördern, davon abhängig sind, ob sie dafür externe, also industrielle Förderer finden."
Stiftung sichert sich weitreichende Mitbestimmungsrechte
Als grenzwertig bewerteten Kritiker auch die Details einer Kooperation der Uni Mainz mit der Boehringer Ingelheim Stiftung. Der gleichnamige Pharmahersteller finanziert mit 100 Millionen Euro das Uni-Institut für Molekulare Biologie – und sicherte sich zunächst weitreichende Mitbestimmungsrechte. Ein Journalist erzwang vor Gericht die Veröffentlichung des Vertrages. Erst daraufhin änderten die Kooperationspartner umstrittene Passagen.
"Jetzt kann man sagen: Ja, das ist die Spitze des Eisberges. Glaube ich nicht. Man kann sagen: Ja, das sind so Ausreißer. Glaube ich auch nicht. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Dass es immer wieder – auch wenn natürlich jeder Drittmittelgeber das für sich verneinen wird – Interessen gibt, die mit der Vergabe von Drittmitteln verbunden sind und die nicht eben nur wissenschaftsgeleitet sind, lässt sich gar nicht von der Hand weisen."
Michael Hartmer ist Geschäftsführer des Deutschen Hochschulverbandes. Der größte Interessensverband der Forschenden in Deutschland fordert, Kooperationen zwischen öffentlichen Forschungsinstituten und der Privatwirtschaft öffentlich zu machen. Doch das lehnen Industrie und oft auch die Spitzen der Hochschulen mit Verweis auf Geschäftsgeheimnisse ab.
"Jetzt kann man sagen: Ja, das ist die Spitze des Eisberges. Glaube ich nicht. Man kann sagen: Ja, das sind so Ausreißer. Glaube ich auch nicht. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Dass es immer wieder – auch wenn natürlich jeder Drittmittelgeber das für sich verneinen wird – Interessen gibt, die mit der Vergabe von Drittmitteln verbunden sind und die nicht eben nur wissenschaftsgeleitet sind, lässt sich gar nicht von der Hand weisen."
Michael Hartmer ist Geschäftsführer des Deutschen Hochschulverbandes. Der größte Interessensverband der Forschenden in Deutschland fordert, Kooperationen zwischen öffentlichen Forschungsinstituten und der Privatwirtschaft öffentlich zu machen. Doch das lehnen Industrie und oft auch die Spitzen der Hochschulen mit Verweis auf Geschäftsgeheimnisse ab.
"Das fängt schon bei Masterarbeiten an und setzt sich über Promotionsvorhaben fort und wird dann bis in die Drittmittelverträge hinein projiziert. Immer alles geheim, weil rituell behauptet wird, es seien wirtschaftliche Interessen des Drittmittelgebers tangiert. Das kann eben so nicht laufen. Denn das führt eben dazu, dass es eine Geheimforschung gibt mit öffentlichen Mitteln. Denn schließlich ist der ganze Apparat und auch der Hochschullehrer aus öffentlichen Mitteln finanziert."
Keine geheimen Vereinbarungen
Julia Reda von der Gesellschaft für Freiheitsrechte geht noch weiter. Der von Juristinnen und Juristen gegründete Verein tritt für Grund- und Menschenrechte ein. Und für Reda ist klar: Mögliche Geschäftsgeheimnisse dürfen keine Rolle spielen, wenn Unternehmen Geld für die Forschung an Universitäten bereitstellen wollen.
"Denn wenn das Unternehmen tatsächlich keinen inhaltlichen Einfluss auf die Forschung nehmen will, was ja nicht erlaubt wäre, was mit der Wissenschaftsfreiheit kollidieren würde, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund, warum die Offenlegung von solchen Kooperationsverträgen Geschäftsgeheimnisse berühren sollte."
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte fordert ein Gesetz, das Forschungskooperationen Grenzen setzt. Derzeit legen sechs Bundesländer immerhin die Eckdaten industrieller Forschungsförderung offen. Die Thüringer Hochschulen zum Beispiel führen seit 2017 ein öffentliches Register, in dem alle Projekte über 5000 Euro verzeichnet sind. Thema der Forschung, Drittmittelgeber, Förderzeitraum und Fördersumme – all das kann jeder im Internet abrufen. Doch auch die Länder stehen im Wettbewerb – um Drittmittel und damit Jobs in der eigenen Region.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte fordert ein Gesetz, das Forschungskooperationen Grenzen setzt. Derzeit legen sechs Bundesländer immerhin die Eckdaten industrieller Forschungsförderung offen. Die Thüringer Hochschulen zum Beispiel führen seit 2017 ein öffentliches Register, in dem alle Projekte über 5000 Euro verzeichnet sind. Thema der Forschung, Drittmittelgeber, Förderzeitraum und Fördersumme – all das kann jeder im Internet abrufen. Doch auch die Länder stehen im Wettbewerb – um Drittmittel und damit Jobs in der eigenen Region.
"Cyber Valley" für Unternehmen und Wissenschaftler
"Der digital Wandel wird durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Die Forschungsinitiative ‚Cyber Valley‘ ist ein Zusammenschluss von Land und acht Partnern aus der Industrie. Hier werden die Grundlagen für unsere digitale Zukunft gelegt."
Auf Youtube wirbt Baden-Württemberg für die Zusammenarbeit von öffentlichen Forschungseinrichtungen und der Industrie: Die Unis von Stuttgart und Tübingen sowie das Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme haben sich mit sieben Unternehmen zusammengetan. "Cyber Valley" nennt sich die Initiative zur Erforschung Künstlicher Intelligenz. Sie soll IT-Fachleute nach Baden-Württemberg locken, sagt Philipp Hennig, Professor für Methoden des Maschinellen Lernens an der Universität Tübingen.
"Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der Mangel an menschlichen Experten im Moment das größte Hindernis für den Erfolg und auch für die richtige Gestaltung dieser digitalen Revolution ist. Das gilt ganz besonders für Deutschland und für Europa. Und es braucht deswegen jetzt hier Standorte, die die nötige Strahlkraft haben, um diese Menschen zum einen hier neu auszubilden, zum anderen aber eben auch hier zu halten."
Auf Youtube wirbt Baden-Württemberg für die Zusammenarbeit von öffentlichen Forschungseinrichtungen und der Industrie: Die Unis von Stuttgart und Tübingen sowie das Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme haben sich mit sieben Unternehmen zusammengetan. "Cyber Valley" nennt sich die Initiative zur Erforschung Künstlicher Intelligenz. Sie soll IT-Fachleute nach Baden-Württemberg locken, sagt Philipp Hennig, Professor für Methoden des Maschinellen Lernens an der Universität Tübingen.
"Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der Mangel an menschlichen Experten im Moment das größte Hindernis für den Erfolg und auch für die richtige Gestaltung dieser digitalen Revolution ist. Das gilt ganz besonders für Deutschland und für Europa. Und es braucht deswegen jetzt hier Standorte, die die nötige Strahlkraft haben, um diese Menschen zum einen hier neu auszubilden, zum anderen aber eben auch hier zu halten."
Geld von Daimler, Bosch und Amazon
Wer auch an diesen Experten interessiert ist, und sie mit guter Bezahlung besser als die Universitäten locken kann, das zeigt ein Blick auf die Industriepartner: Daimler, Porsche, die Automobilzulieferer Bosch, ZF und iav sowie der Internetriese Amazon. Die Konzerne siedeln Teile ihrer Entwicklungsabteilungen neben der Tübinger Uni und dem renommierten Max-Planck-Institut an. Sie überweisen aber keine klassischen Drittmittel. Privates Geld fließt vorwiegend über einen Fonds in die öffentliche Forschung.
"Das ist der sogenannte Cyber-Valley-Research-Fonds, in den die Industriepartner insgesamt fünf Millionen Euro für fünf Jahre eingezahlt haben. Und Forscher aus den öffentlichen Partnereinrichtungen haben nun die Möglichkeit, sich mit ihren eigenen Forschungsideen auf einen Teil dieses Geldes zu bewerben."
Welche Projekte so finanziert werden, entscheidet ein Gremium, das zur Hälfte mit den Industriepartnern besetzt ist. Die Unternehmen können mitbestimmen, was Wissenschaftler der öffentlichen Einrichtungen erforschen. Doch dieses Modell hat ebenfalls Schwächen, sagt die Tübinger Informatik-Professorin Ulrike von Luxburg. Die Kooperationsverträge sind auch hier geheim. Die Spezialistin für maschinelles Lernen fordert, alle Vereinbarungen offen zu legen.
"Das ist der sogenannte Cyber-Valley-Research-Fonds, in den die Industriepartner insgesamt fünf Millionen Euro für fünf Jahre eingezahlt haben. Und Forscher aus den öffentlichen Partnereinrichtungen haben nun die Möglichkeit, sich mit ihren eigenen Forschungsideen auf einen Teil dieses Geldes zu bewerben."
Welche Projekte so finanziert werden, entscheidet ein Gremium, das zur Hälfte mit den Industriepartnern besetzt ist. Die Unternehmen können mitbestimmen, was Wissenschaftler der öffentlichen Einrichtungen erforschen. Doch dieses Modell hat ebenfalls Schwächen, sagt die Tübinger Informatik-Professorin Ulrike von Luxburg. Die Kooperationsverträge sind auch hier geheim. Die Spezialistin für maschinelles Lernen fordert, alle Vereinbarungen offen zu legen.
"Die Öffentlichkeit soll sehen, dass wir an der Uni – und am Max-Planck-Institut auch – keine Forschung betreiben, die irgendwelchen ethischen Prinzipien widerspricht. Oder auch uns von der Industrie reinreden lassen, welche Forschungsergebnisse wir produzieren, welche wir veröffentlichen, welche wir nicht veröffentlichen. Es muss einfach gewährleistet sein, was meiner Meinung nach auch der Fall ist, dass die Forschung frei stattfindet."
Attraktiv für Fachkräfte
Ein Weg nach Tübingen führt in diesen Corona-Monaten über ein Hochhaus mit Glasfassade im Berliner Bezirk Mitte. Hier hat der Internetriese Amazon mehrere Etagen gemietet.
Auf dem großen Bildschirm eines Konferenzraumes erscheint Michael Hirsch. Der KI-Spezialist arbeitete früher am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme und leitet jetzt ein Amazon-Forschungszentrum in Tübingen. Das soll in den kommenden Jahren kräftig wachsen, denn der Konzern erhofft sich Vorteile im schwäbischen "Cyber Valley".
"Viele von den Fachkräften sind hoch umworben von internationalen Playern. Viele in der Vergangenheit sind da tatsächlich aus Tübingen weggezogen; sei es nach Paris zu Facebook, nach London, Deepmind, oder auch in die USA. Und ein Ziel dieser Cyber-Valley-Initiative war es auch wirklich, dass Talent in dem Bereich, diese Expertise im Bereich KI, was wirklich als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts begriffen wird, in der Region zu halten. Natürlich: Amazon profitiert, aber natürlich auch andere Unternehmen in der Region."
Wissenschaft als Standortpolitik: Fast alle der beteiligten Firmen haben ihren Sitz in Baden-Württemberg. Und sie interessieren vor allem die Anwendungsmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz. Zum Verdruss von Peter Büttner von Transparency International.
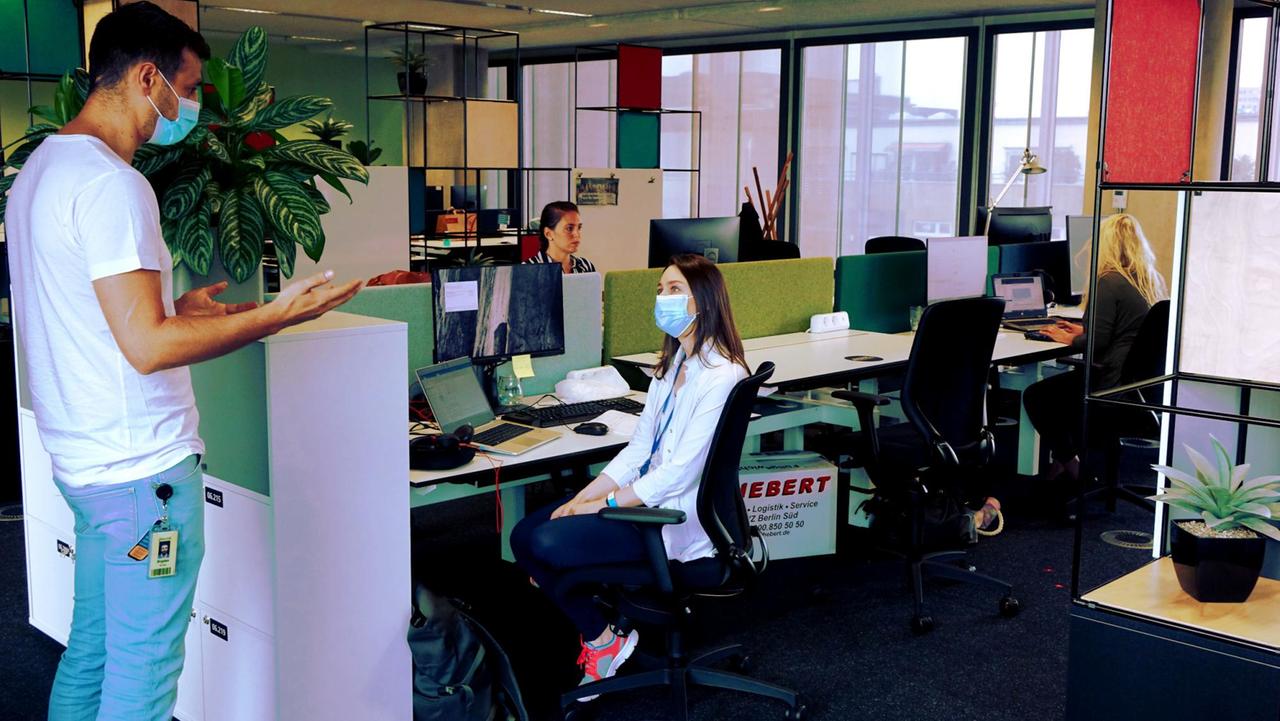
Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft: Forschungsstandort des Internetkonzerns Amazon.© Deutschlandradio / Sven Kästner
"Die fördern nicht Grundlagenforschung, sondern die wollen ihre Wettbewerbsfähigkeit in der Anwendung von KI-Systemen verbessern und sind froh, dass es diese konzentrierte Aktion gibt. Also, das halte ich für keinerlei Fortschritt in der Unabhängigkeit von Forschung."
Kaum Geld für Geisteswissenschaften
Von privatem Geld profitieren Forschungsbereiche sehr ungleichmäßig: Technische Hochschulen haben es leichter, Kooperationspartner zu finden. Auch medizinische Institute arbeiten häufig mit Pharmafirmen zusammen, die so auf neue Therapien hoffen. Geistes- und Sozialwissenschaft dagegen sind für private Geldgeber weniger interessant. Diese Wissenschaftsbereiche arbeiten vor allem mithilfe öffentlicher Drittmittel.
Christian Volk ist seit wenigen Wochen Professor für Theorie der Politik an der Berliner Humboldt-Universtität. Er hat Erfahrung darin, Geld von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, vom Europäischen Forschungsrat oder von öffentlichen Stiftungen zu beantragen.
Christian Volk ist seit wenigen Wochen Professor für Theorie der Politik an der Berliner Humboldt-Universtität. Er hat Erfahrung darin, Geld von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, vom Europäischen Forschungsrat oder von öffentlichen Stiftungen zu beantragen.
"Die strategische Formulierung oder grundsätzlich quasi das Genre 'Drittmittelantrag', das innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften, aber natürlich auch anderer Bereiche der universitären Forschung zu einem Genre geworden ist, dass man lernen und bestenfalls auch irgendwie beherrschen sollte. Und da ist es natürlich in der Tat relevant zu gucken: Was sind – sagen wir mal – gerade zentrale Begriffe? Was ist en vogue?"
Er selbst habe seine Forschungsfragen nie anhand von Drittmittelprogrammen ausgewählt, sagt Volk. Allerdings können bestimmte Förderprogramme die wissenschaftliche Karriere beeinflussen. Aus diesem Grund beantragte Volk Geld beim Europäischen Forschungsrat ERC.
"Weil ich genau weiß, dass damit bestimmte Lorbeeren auch einhergehen, also eine bestimmte Reputation einhergeht. Und dann stellt man sich schon die Frage: Okay, was ist eigentlich eine Forschungsfrage, für die ein ERC-Grant das richtige Format wäre? Das hängt sehr, sehr stark von den Förderformaten ab. Und nicht jedes Förderformat passt zu jeder Forschungsfrage."

Studierende haben einen Hörsaal in Tübingen besetzt, um gegen das Cyber-Valley zu protestieren.© dpa / Sebastian Gollnow
Kampf um die Karriere
Auf indirekte Weise kann also die Wahl eines bestimmten Themas den weiteren Karriereweg beeinflussen. Allerdings gilt das auch unabhängig von der Drittmittelverteilung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die es noch nicht bis zur Professur geschafft haben, müssen sich von einer befristeten Stelle zur nächsten hangeln. Die Arbeitsverhältnisse sind unter anderem deshalb so prekär, weil die Hochschulen diese Stellen oft nur aus den befristeten Drittmitteln finanzieren.
"Druck, den ich immer gespürt habe auf meine eigene Arbeit, der kam eher aus dem Damoklesschwert, das über mir schwebte mit Blick auf: Werde ich Wissenschaftler sein können, auch in Zukunft? Oder spuckt mich das System aus? Als jetzt zu sagen: Der Drittmittelantrag, diese Drittmittelkultur, die passt so überhaupt nicht zu meiner Forschung."
Wenn Hochschulen heute Professuren ausschreiben, ist ein Kriterium: Wie erfolgreich kann jemand Drittmittel einwerben. Ein Punkt, den Michael Hartmer vom Hochschulverband kritisiert.
"Jede Form von ausgeschriebenem Programm ist natürlich auch eine wie immer geartete Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Ich kann nicht mehr das forschen, was ich gerne möchte. Sondern ich muss sehen, dass ich mit meiner Forschung mich in bestimmte Programmlinien einfügen kann."
In den vergangenen Jahren hat der Bund in Zusammenarbeit mit den Ländern weitere Förderprogramme aufgelegt. Die inhaltliche Ausgestaltung führt regelmäßig zu Verteilungskämpfen zwischen den Wissenschaftsbereichen. Es geht um viel Geld, das über die Ausstattung einer Hochschule entscheidet.
"Dadurch ist eine gewisse Formatierung vorgegeben, vielleicht eine Engführung. Und wir haben es ja – das ist also allgemeine Meinung – mit dem Problem zu tun, dass wir dadurch Mainstreamforschung immer mehr unterstützen. Das bedeutet also, dass derjenige, der mit Außenseiterthesen und Außenseiterthemen sich profilieren will, dass der es in diesem System natürlich weitaus schwerer hat. Das ist eine inhaltliche Verengung."
"Druck, den ich immer gespürt habe auf meine eigene Arbeit, der kam eher aus dem Damoklesschwert, das über mir schwebte mit Blick auf: Werde ich Wissenschaftler sein können, auch in Zukunft? Oder spuckt mich das System aus? Als jetzt zu sagen: Der Drittmittelantrag, diese Drittmittelkultur, die passt so überhaupt nicht zu meiner Forschung."
Wenn Hochschulen heute Professuren ausschreiben, ist ein Kriterium: Wie erfolgreich kann jemand Drittmittel einwerben. Ein Punkt, den Michael Hartmer vom Hochschulverband kritisiert.
"Jede Form von ausgeschriebenem Programm ist natürlich auch eine wie immer geartete Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Ich kann nicht mehr das forschen, was ich gerne möchte. Sondern ich muss sehen, dass ich mit meiner Forschung mich in bestimmte Programmlinien einfügen kann."
In den vergangenen Jahren hat der Bund in Zusammenarbeit mit den Ländern weitere Förderprogramme aufgelegt. Die inhaltliche Ausgestaltung führt regelmäßig zu Verteilungskämpfen zwischen den Wissenschaftsbereichen. Es geht um viel Geld, das über die Ausstattung einer Hochschule entscheidet.
"Dadurch ist eine gewisse Formatierung vorgegeben, vielleicht eine Engführung. Und wir haben es ja – das ist also allgemeine Meinung – mit dem Problem zu tun, dass wir dadurch Mainstreamforschung immer mehr unterstützen. Das bedeutet also, dass derjenige, der mit Außenseiterthesen und Außenseiterthemen sich profilieren will, dass der es in diesem System natürlich weitaus schwerer hat. Das ist eine inhaltliche Verengung."
Ganz ohne Drittmittel geht es kaum
Trotz aller Kritikpunkte: Die Hochschulrektorenkonferenz wertet den Umbau der Wissenschaftsfinanzierung weg von rein staatlichen Zuschüssen hin zu Drittmitteln als Erfolg. Präsident Peter-André Alt:
"Die deutschen Hochschulen haben seit der 2000er-Wende internationale Reputation gewonnen und auch viel Forschungsdynamik entfaltet. Insbesondere, weil in Projekten kooperiert wird über Fächergrenzen hinweg, wie es die globale Forschung verlangt. Das ist insbesondere durch die Projektorganisation in der Forschung gelungen. Und da hat die Drittmittelkultur einen wesentlichen Anteil."
Auch viele Kritiker des Systems halten es für unrealistisch, dass Forschung ausschließlich aus Haushaltsmitteln der Länder finanziert wird. Doch sie fordern mehr Transparenz, damit die wissenschaftliche Arbeit von Hochschulen ihre Akzeptanz in der Gesellschaft behält.
"Die grundrechtliche Perspektive ist zunächst mal, wenn es solche privaten Förderungen gibt, dass dann über entsprechende Absicherungen der Wissenschaftsfreiheit, der Informationsfreiheit und der Pressefreiheit sichergestellt werden muss, dass diese Verfahren transparent sind."
"Immer, wenn Geheimhaltungsinteressen wahrgenommen werden, muss es eine Art von zweiter Instanz innerhalb der Hochschule geben. Das kann man auch durch eine wie auch immer geartete Kommission machen. Macht man ja in anderen Bereichen auch, mit einer Ethikkommission."
"Wir sind nicht dagegen, dass es solche Kooperationsverträge gibt. Aber erstens sollten sie veröffentlicht werden mit Ross und Reiter. Zweitens sollte sichergestellt werden, dass an öffentlichen Einrichtungen erarbeitete Ergebnisse auch veröffentlicht werden."
"Die deutschen Hochschulen haben seit der 2000er-Wende internationale Reputation gewonnen und auch viel Forschungsdynamik entfaltet. Insbesondere, weil in Projekten kooperiert wird über Fächergrenzen hinweg, wie es die globale Forschung verlangt. Das ist insbesondere durch die Projektorganisation in der Forschung gelungen. Und da hat die Drittmittelkultur einen wesentlichen Anteil."
Auch viele Kritiker des Systems halten es für unrealistisch, dass Forschung ausschließlich aus Haushaltsmitteln der Länder finanziert wird. Doch sie fordern mehr Transparenz, damit die wissenschaftliche Arbeit von Hochschulen ihre Akzeptanz in der Gesellschaft behält.
"Die grundrechtliche Perspektive ist zunächst mal, wenn es solche privaten Förderungen gibt, dass dann über entsprechende Absicherungen der Wissenschaftsfreiheit, der Informationsfreiheit und der Pressefreiheit sichergestellt werden muss, dass diese Verfahren transparent sind."
"Immer, wenn Geheimhaltungsinteressen wahrgenommen werden, muss es eine Art von zweiter Instanz innerhalb der Hochschule geben. Das kann man auch durch eine wie auch immer geartete Kommission machen. Macht man ja in anderen Bereichen auch, mit einer Ethikkommission."
"Wir sind nicht dagegen, dass es solche Kooperationsverträge gibt. Aber erstens sollten sie veröffentlicht werden mit Ross und Reiter. Zweitens sollte sichergestellt werden, dass an öffentlichen Einrichtungen erarbeitete Ergebnisse auch veröffentlicht werden."






