Francis Fukuyama: Identität. Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet.
Aus dem Englischen übersetzt von Bernd Rullkötter
Hoffmann und Campe, Hamburg 2019
240 Seiten, 22 Euro
Der doppelte Verrat der Linken
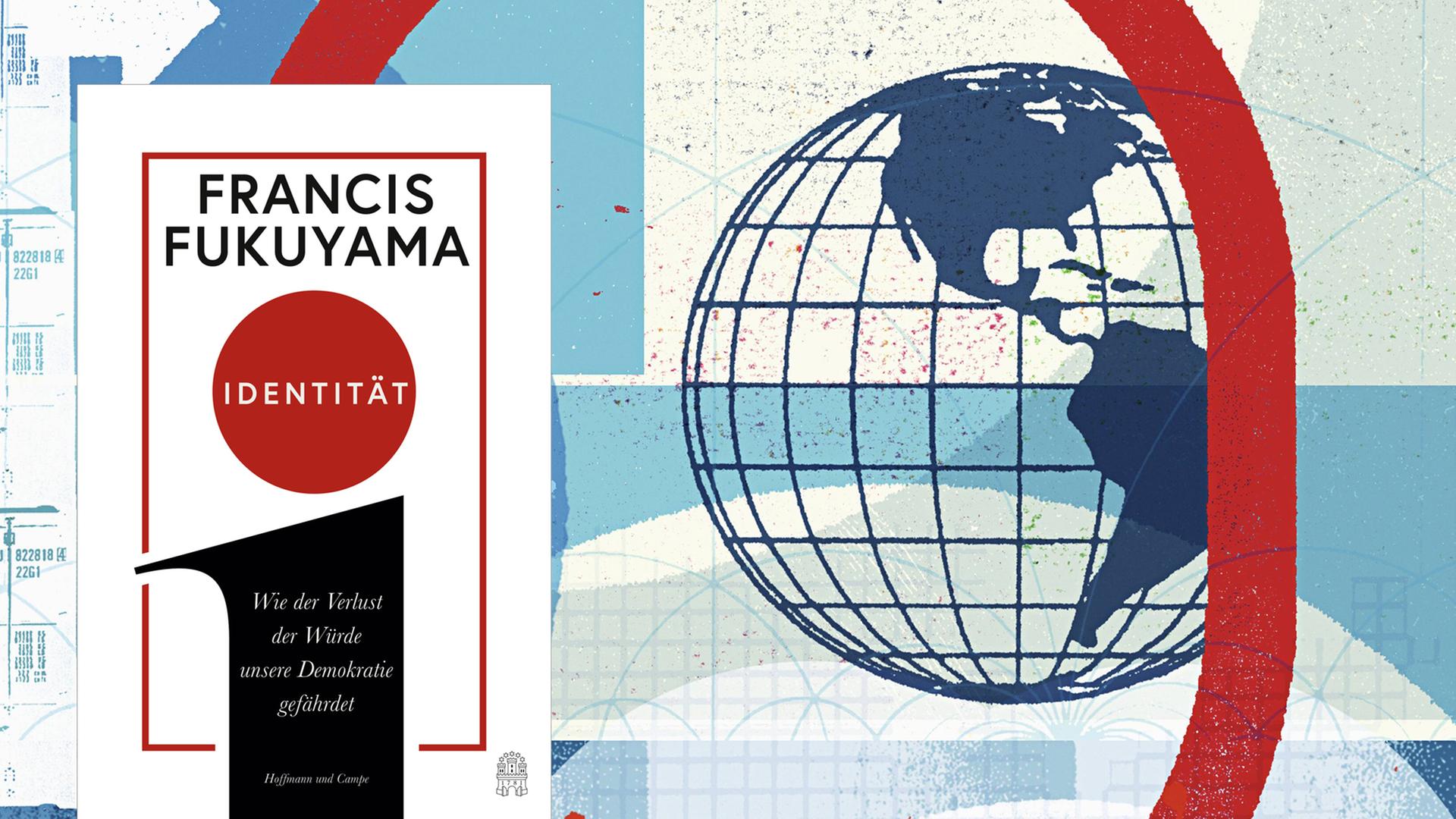
In den 90ern verkündete Francis Fukuyama noch den Sieg der liberalen Demokratie. Heute sind Rückschritte nicht zu übersehen. Schuld sei der Verrat der Linken am Klassen-Gedanken und am Universalismus der Würde, sagt der Philosoph.
Francis Fukuyama wurde weltberühmt, als er in den frühen 1990er Jahren den Sieg der liberalen Demokratie verkündete. Er unterstellte, es gäbe keinen "weiteren Fortschritt in der Entwicklung grundlegender Prinzipien und Institutionen" mehr.
Doch mittlerweile hat sich die Sache verkehrt: Es gibt massive Rückschritte. Die Anzahl liberaler Demokratien sinkt; in vielen Staaten wächst die populistische Rechte. Zugleich ist die Ein-Parteien-Diktatur China wirtschaftlich sehr erfolgreich. Deshalb wurde es zum Allgemeinplatz, dass sich Fukuyama geirrt hat.

Der Politikwissenschaftler Yoshihiro Francis Fukuyama.© picture alliance / dpa / Lynn Bo Bo
Ohne seinen Irrtum explizit zu machen, untersucht Fukuyama in "Identität" nun die Krise der Demokratie, deren wichtigste akute Ursache er in einer verfehlten Identitätspolitik sieht.
Kampf um Anerkennung
Fukuyama holt sehr weit aus. Er begreift den "Thymos" als jenen Teil der Seele, der sich "nach Anerkennung seiner Würde sehnt" und weist die Vorstellung zurück, der Mensch strebe bloß im Sinne eines "homo oeconomicus" nach rationaler Nutzenmaximierung. Er präsentiert von Luther über Rousseau bis Kant und Hegel eine Reihe universalistischer Denker, die trotz Differenzen "an die Gleichheit der Würde aller Menschen" geglaubt haben. Und er zeigt, dass es beim Kampf um Anerkennung im 19. Jahrhundert oft nicht mehr um Universalismus, sondern um nationalistische, ethnische, religiöse und kulturelle Merkmale ging – und heute ein weiteres Mal geht.
Für die neue Malaise macht Fukuyama vor allem die Linken verantwortlich. Er zeiht sie eines doppelten Verrats – am Klassen-Gedanken und am Universalismus der Würde: "Statt Solidarität mit breiten Bevölkerungsschichten wie der Arbeiterschaft oder wirtschaftlich Ausgebeuteten herzustellen, konzentriert sie sich auf immer kleinere Gruppen."
Diese Erklärung hat zur Zeit Hochkonjunktur und wird etwa von dem Politikwissenschaftler Mark Lilla deutlich differenzierter vertreten.
Auf der Suche nach der Bekenntnisidentität
Laut Fukuyama liegt das größte Problem der kleinteiligen linken Identitätspolitik darin, dass sie eine massive Gegenreaktion ausgelöst hat – erkennbar etwa an der politischen Korrektheit, deren Ablehnung zu einer "wichtigen Mobilitätsquelle" für die Rechten geworden sei. So kritisierten Trump-Anhänger, dass schwarze, homosexuelle oder lateinamerikanische Gruppen ihre Identität betonen dürfen, das Adjektiv "weiß" dagegen zur positiven Selbstidentifizierung unstatthaft sei. Die Folge: Es werde aus Unmut umso trotziger herausgestellt. Linke Identitätspolitik wird gleichsam rechts kopiert.
Und wie entkommt man der unseligen Separierung, die das Allgemeine vergisst? Fukuyama singt ein Loblied auf die wohlverstandene "nationale Identität". Sie sorge am besten für physische Sicherheit, für gute Regierungen und erfolgreiche Ökonomien, sie fördere das Vertrauen und die soziale Sicherheit. Sobald ein Land die "geeignete nationale Bekenntnisidentität" gefunden habe, sei es stabil und auch für Zuwanderung offen.
Freund des groben Pinselstrichs
Fukuyama liebt die groben Pinselstriche, seine Argumentation geht selten in die Tiefe. Er appelliert schlussendlich, nicht-separatistische Identität als "Heilmittel für die populistische Politik der Gegenwart" zu nutzen.
Allerdings erklärt er nicht, wie das funktionieren soll. Insofern bleibt dem weltweiten Auditorium, das Fukuyama auch mit dem neuen Buch erreichen dürfte, reichlich Stoff zum Weiterdenken.






